|
|
|
Umschlagtext
Der Schmetterling
Ich, Tschuang-Tschou, träumte einst, ich sei ein Schmetterling, ein hin und her flatternder Schmetterling, ohne Sorge und Wunsch, meines Menschenwesens unbewusst. Plötzlich erwachte ich; und da lag ich: wieder >>ich selbst<<. Nun weiß ich nicht: war ich da ein Mensch, der träumte, er sei ein Schmetterling, oder bin ich jetzt ein Schmetterling, der träumt, er sei ein Mensch? Tschuang-Tse Rezension
In Riesenschritten durch die Geschichte und Argumentationsfiguren der Philosophie - dass leistet dieses Buch, das zudem mit zahlreichen Illustrationen der Peanuts und Calvin und Hobbes illustrierend gespickt ist. Wer auf der Suche nach einleuchtenden und erfrischenden Figuren der Philosophie und Logik ist und dies noch didaktisch gut aufbereitet, der wird hier fündig. Aber auch für die eigenen Einarbeitung in die Philosophie taugt das Buch.
F.W., lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das Arbeitsbuch für den Philosophieunterricht in der Sekundarstufe II greift elementare und komplexe Lehrstücke aus der Erkenntnistheorie und der Logik auf. Schülerinnen und Schüler lernen, was schlüssige Argumentation ausmacht, und werden in die Lage versetzt abstruse Gedankengebäude zu durchschauen. Die gewählten Materialen – darunter passgenau ausgewählte Comics – sprechen die Schüler an und fordern sie, verbinden hohes Niveau mit größter Alltäglichkeit und Direktheit. Die Aufgaben zielen darauf, Grundlagen des Philosophierens einzuholen, Positionen probeweise zu beziehen, frühere Denker zur Rechenschaft zu ziehen ... Inhaltsverzeichnis
1.BEGRIFFE DEFINIEREN
Konfuzius: Der Edle muss die Begriffe richtig stellen 1.1. Unfertiges und Schlagfertiges 1.1.1. Annäherungsversuche: Was ist OBST? 11.2. Lexika-Definitionen: STUHL 1.1.3 ImmanueIKant:Was ist ein BUCH? 1.1.4. UNESCO: Definition des Begriffs BUCH 1.1.5. Schlagfertige Definitionen: MODE 1.2. Das Bestimmen des Begriffs 1.2.1. Platon: In Gedanken glaube ich es doch zu haben, was die Tapferkeit ist 1.2.2. Platon: So sag mir, worin alle Bienen sich gleich sind 1.2.3. Aristoteles: Plato und die Definition der Begriffe 1.2.4. Paul Feyerabend: Die typische Blindheit des Intellektuellen 1.3. Randunschärfen 1.3.1. Hugo von Hofmannsthal: Der Lord-Chandos-Brief 1.3.2. Ludwig Wittgenstein: Ein Begriff mit verschwommenen Rändern 1.3.3. Werner Heisenberg: Begriffe der gewöhnlichen Sprache 1.3.4. Adam Schaff: Unscharfe Ausdrücke und die Grenzen ihrer Präzisierung 1.3.5. Drei Definitionsverfahren - mit und ohne Unschärferelation 1.4. Das Subjekt im Objekt 1.4.1.Werner Heisenberg: Je genauer der Ort bestimmt ist, desto ungenauer ist 1.4.2. Fritjof Capra: Heisenbergs Unschärferelation 1.4.3. Rainer Jung: Tückender Live-Berichte 1.4.4. Aristophanes: Wieviel Flohfüß' weit ein Floh wohl hüpft? 1.4.5. Till Eulenspiegel: Wieviel Eimer Wasser sind im Meere? 1.5. Definition und Interesse 1.5.1. Rollenspiel: Definieren aus unterschiedlicher Position 1.5.2. Unterschiedliche LEXIKA-Definitionen: VERTEIDIGUNG, ENTEIGNUNG 1.5.3. UNO: Die Definition des Begriffs AGGRESSION 1.5.4. Diogenes Laertius: Der Mensch - ein federloses zweifüßiges Tier 1.5.5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Der Mensch - ein Tier mit Ohrläppchen 1.5.6. Johann Wolfgang von Goethe: Mephistopheles und die Definitionen 1.5.7. UNO: Die Definition der MENSCHENRECHTE 1.5.8. Sadik J. Al-Azm: Das Wahrheitsregime der Verbrecher 1.5.9. Volker Heins: Dialog als Stückwerk 2. SCHLÜSSE ZIEHEN Gregory Bateson: Menschen sind Gras 2.1. Syllogismus 2.1.1. Aristoteles: Ein Syllogismus ist ein logischer Ausdruck 2.1.2. Der Syllogismus inder Scholastik 2.1.3. Transformationen 2.1.4. Axiom 2.1.5. Tautologie 2.1.6. Thomas Hobbes: Vom Syllogismus 2.1.7. Arthur Schopenhauer: Vater und Mutter eines Kindes 2.1.8. Emile M. Cioran: Syllogismen der Bitterkeit 2.2. Induktion 2.2.1. Aristoteles: Oberste Begriffe und Grundsätze nur durch Induktion 2.2.2. Francis Bacon: Mit den Dingen selbst vertraut zu werden 2.2.3. David Hume: Die Behauptung, dass die Sonne morgen nicht aufgehen werde 2.2.4. Helmut Seiffert: Beobachtung, Protokoll, Hypothese und Gesetz 2.2.5. Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte 2.2.6. Johann Gottlieb Fichte: Die Bestimmung des Menschen 2.3. Analogie 2.3.1. Strukturelle und funktionale Analogie 2.3.2. Im Grunde genau dasselbe!? 2.3.3. Johannes Kepler: Meine vertrauenswertesten Lehrmeister 2.3.4. Ludwig Aurbacher: Der Quacksalber 2.3.5. Poesie - Vergleich und Metapher 2.3.6. Johann Wolfgang von Goethe: Analogie 2.3.7. Martin Heidegger: Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie 2.3.8. Sigmund Freud: Die Zensur 2.4. Argumentation 2.4.1. Argumentieren und schlussfolgern 2.4.2. Mephisto und das Logik-Studium 2.4.3 Fehlschlüsse 2.4.4 Standardvorwürfe 2.4.5. Operative Unterscheidungen 2.4.6. Aristoteles: Argument, Enthymem, Indiz und Beispiel 2.4.7 Dharmakirti: Feuer und Rauch 2.5. Gruppenarbeitsmaterialien 2.5.1. Indizienbeweise 2.5.2. Prognosen 25.3. Gleiches mit Gleichem vergelten 2.5.4. Variationen und Äquivalente 2.5.5. Das "ICH-AUCH"-Phänomen 2.5.6. Anth ropomorphismus 2.5.7. Das Analogie-Verbot im Strafrecht 3. GEGENSÄTZE BEGREIFEN Jorge Luis Borges: Das Problem, das wir niemals lösen können 3.1. Identität und Veränderung 3.1.1.Heraklit: In dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht 3.1.2. Platon: Nachdenken aber musst du, denn du bist jung und hast noch Zeit 3.1.3. Aristoteles: Der Satz vom Widerspruch 3.1.4. Ovid:Metamorphosen 3.1.5. Rainer Maria Rilke: So ist klar, dass ich keine Bekannten habe 3.1.6. Paul Valery: Genau das wäre das Chaos 3.1.7. Bertolt Brecht: DasWiedersehen 3.1.8. Karl R. Popper: Zurück zu den Vorsokratikern 3.2. Sein ohne Zeit 3.2.1. Parmenides: So ist Entstehen verlöscht und Vergehen verschollen 3.2.2. Hans-Georg Gadamer: Ein Grundgedanke 3.2.3. Luciano de Crescenzo: Zenons uneinholbare Schildkröte 3.24. Hermann Diels: Das Denken wird dabei "schwindelig" 3.2.5. Gottfried Benn: Es wird nichts und es entwickelt sich nichts 3.2.6. Wolfgang Silvanus: Zeit gibt es nicht 3.3.Sein und Schein 3.3.1. Tschuang-Tse: Der Schmetterling 3.3.2. Parmenides: Alles bloßer Name 3.3.3. Platon: Das Höhlengleichnis 3.3.4. Friedrich Schiller: Poesie des Lebens 3.3.5. Friedrich von Gentz: Die Eitelkeit 3.3.6. Hans Joachim Störig: Der Universalienstreit 3.3.7. Charles M. Schulz: Du – ein Doktor? 3.3.8. Johann Wolfgang von Goethe: Goldnes Zeitalter 3.3.9. Zum Universalienstreit in der Gegenwart 3.3.10. Immanuel Kant: Die Erscheinungen und die Dinge an sich 3.3.11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist 3.3.12. Friedrich Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne 3.4. Relativismus 3.4.1. Xenophanes: Die Äthiopen behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig 3.4.2. Nikolaus von Kues: Der Mensch kann nicht anders als nur menschlich urteilen 3.4.3. Protagaras: Aller Dinge Maß ist der Mensch 3.4.4. Platon: Protagaras sagt nämlich, der Mensch sei das Maß aller Dinge 3.4.5. Platon: Wiedererinnerung -der Erwerb der Vernunfterkenntnis. 3.4.6. Rene Descartes: Zum Beispiel dieses Stück Wachs 3.4.7.Sextus Empiricus: Die Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Argumente 3.4.8. Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Gigant und der Ideenfreund 3.4.9. Etienne Bonnot de Condillac: Denn Leben ist eigentlich genießen 3.4.10. Hippolyte Taine: Gespräch mit einem "eingefleischten Sensualisten" 3.4.11. Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum 3.4.12. Immanuel Kant: Von dem ersten Gebot aller Pflichten gegen sich selbst 3.4.13. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Erkenne dich selbst, dies absolute Gebot 3.4.14. Charles S. Peirce: Meinungen 3.4.15. Paul Feyerabend: Erkenntnistheoretischer Anarchismus 3.4.16. Jürgen Habermas: Die Einheit der Vernunft als Quelle der Vielfalt ihrer Stimmen 3.5. Zufall und Notwendigkeit 3.5.1. Heraklit: Verhängnis 3.5.2. Aristoteles: Entsteht doch aus denselben Buchstaben die Tragödie wie die Komödie 3.5.3. Adolf Lasson: Über den Zufall 3.5.4. Julien Offray de La Mettrie: Der Mensch eine Maschine 3.5.5. Pierre Simon Laplace: Gäbe es einen Verstand, der... 3.5.6. Werner Heisenberg: Können wir die Zukunft berechnen? 3.5.7. Arthur Schopenhauer: Über die Freiheit des Willens 3.5.8. GeorgWilhelm Friedrich Hegel: Der freie Wille 3.5.9. Jürgen Habermas: Glauben und Wissen 3.5.10. Karl Valentin: Sie ham halt a andre Weltanschauung 3.6. Dialektik - zwei Varianten 3.6.1. Aristoteles: Dialektik 3.6.2. Johann Gottfried Herder: Dialektik - ein gelehrtes Turnier- und Ritterspiel 3.6.3. Immanuel Kant: Ein dialektischer Kampfplatz, wo rüstige Ritter viel Siege erfochten 3.6.4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Die Einheit des Seins und Nichts 3.6.5. Arthur Schopenhauer: Die größte Frechheit im Auftischen baren Unsinns 3.6.6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Das Unbegreifliche 3.6.7. Anton Friedrich Koch: Der Torwart hat den Ball und hat ihn nicht - das Fangen 3.6.8. Ernst Bloch: Fangfragen 3.6.9. Cicero: Sorites - der Haufenschluss 3.6.10. Nikolaus von Kues: Das Kleinste koinzidiert also mit dem Größten 3.7. "Wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches" geht 3.7.1. Friedrich Schiller: Unsere verlorene Kindheit 3.7.2. Heinrich von Kleist:DieFabel ohne Moral 3.7.3. Heinrich von Kleist: Über das Marionettentheater 3.7.4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Gegensätze aufzuheben ist das einzige Interesse 3.7.5. Honore de Balzac: Theorie des Gehens 3.7.6. Ludwig Klages: Der Geist als Widersacher der Seele 3.7.7. Eugen Herrigel: Zen in der Kunst des Bogenschießens 3.7.8. Fritjof Capra: Herrigels kleines Buch "Zen in der Kunst des Bogenschießens" 3.7.9. Was ist der Weg? 3.7.10. Robert M. Pirsig: Das Ausschalten körperlicher, geistiger und emotionaler Aktivität 3.7.11. Mystik 3.7.12. Meister Eckhart: Die Armutspredigt ANHANG: Das Personal in den Cartoons PEANUTS und CALVIN UND HOBBES |
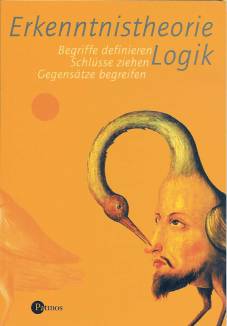
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen