|
|
|
Umschlagtext
Dem Leser werden wichtige Kenntnisse der grundlegenden elektronischen Schaltungen vermittelt. Systematische Darstellung und Anschaulichkeit stehen im Vordergrund. Wirkungsweisen und Anwendungsmöglichkeiten von Schaltungen sind an praxisnahen Beispielen dargestellt. Obwohl in erster Linie als unterrichtsbegleitendes Lernmittel für Schulen und Fortbildungskurse konzipiert, ist ein Selbststudium ohne weiteres möglich.
Das Oszilloskop als vielseitiges Messgerät Gleichrichterschaltungen Verstärkerschaltungen Schaltungen zur Stabilisierung von Spannungen und Strömen Transistor-Schalterstufen Schaltungen mit Mehrschichtdioden Diac und Triac Kippschaltungen Generator- und Impulsformerschaltungen Einführung in die Digitaltechnik Digitale Codes/digitale Zähl- und Speichertechnik Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Das Oszilloskop als vielseitiges Messgerät 1.1 Kenndaten eines Oszilloskops 1.1.1 Empfindlichkeit- Ablenkkoeffizient 1.1.2 Anstiegszeit 1.1.3 Bandbreite. 1.1.3.1 Y-Verstärker 1.1.3.2 Zeitbasis 1.1.3.3 X-Verstärker 1.1.4 Eingangswiderstand 1.1.5 Eingangskapazität 1.2 Tastköpfe 1.2.1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Tastköpfen 1 2.1.1 1:1-Tastkopf 1.2.1.2 10:1-Tastkopf 1.2.1.3 Gleichrichter- Tastkopf 1.2.2 Abgleich von Tastköpfen 1.3 Ausführungsformen von Oszilloskopen 1.3.1 Zweistrahloszilloskop 1.3.2 Zweikanaloszilloskop 1.3.3 Speicheroszillograph 1.4 Einsatzmöglichkeiten des Oszilloskops 1.4.1 Darstellung und Messung von periodischen Spannungen 1.4.2 Darstellung und Messung von einmaligen Spannungssprüngen 1.4.3 Frequenzmessung und Phasenmessung 1.4.3.1 Verwendung der Zeitbasis 1.4.3.2 Auswertung der Lissajous-Figuren 1.4.4 Darstellung einer Kennlinie 1.4.5 Wobbeln eines Filters 2 Gleichrichterschaltungen 2.1 Allgemeines 2.2 Netzgleichrichterschaltungen 2.2.1 Grundschaltungen 2.2.2 G1eichrichterschaltungen mit ohmscher Belastung 2.2.2.1 Einweg-Gleichrichterschaltung (Einpuls-Mittelpunktschaltung M1) 2.2.2.2 Brücken-Gleichrichterschaltung (Zweipuls-Brückenschaltung B2) 2.2.2.3 Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung (Zweipuls-Mittelpunktschaltung M2) 2.2.3 Gleichrichterschaltungen mit kapazitiver Belastung 2.2.4 Gleichrichterschaltungen mit induktiver Belastung 2.3 Siebschaltungen 2.3.1 Ladekondensator 2.3.2 Siebglieder 2.3.2.1 RC-Siebglieder 2.3.2.2 LC-Siebglieder 2.4 Dimensionierung von Netzgleichrichterschaltungen 2.5 Spannungsverdoppler-Schaltungen 2.5.1 Delon-Schaltung (Zweipuls-Verdopplerschaltung D2) 2.5.2 Villard-Schaltung (Einpuls-Verdopplerschaltung D1) 2.6 Spannungsvervielfacher-Schaltungen 2.7 Schaltnetzteile 2.7.1 Schaltnetzteil-Prinzip 2.7.2 Primärgetaktete Schaltnetzteile 2.7.2.1 Durchflusswandler 2.7.2.2 Sperrwandler 2.7.3 Sekundärgetaktete Schaltnetzteile 2.7.4 Schaltnetzteile mit Gegentaktflusswandler 3 Verstärkerschaltungen 3.1 Grundschaltungen des Transistors 3.2 Ersatzschaltung des Transistors bei Kleinsignalaussteuerung 3.2.1 Differentieller Eingangswiderstand rBE 3.2.2 Differentieller Ausgangswiderstand rCE 3.2.3 Rückwirkung 3.2.4 Eingangs- und Ausgangskapazität 3.2.5 Ersatzschaltbild nach Giacoletto 3.2.6 h-Parameter-Ersatzschaltbild 3.3 Emitterschaltung 3.3.1 Arbeitspunkteinstellung 3.3.1.1 Arbeitspunkteinstellung mit Spannungsteiler 3.3.1.2 Arbeitspunkteinstellung mit Vorwiderstand 3.3.2 Arbeitspunktstabilisierung 3.3.2.1 Stabilisierung durch Temperaturkompensation 3.3.2.2 Stabilisierung durch Gegenkopplung 3.3.2.2.1 Gleichstromgegenkopplung 3.3.2.2.2 Gleichspannungsgegenkopplung 3.3.3 Kleinsignalverhalten der Emitterschaltung 3.3.3.1 Verstärkung der Emitterscha1tung 3.3.3.2 Eingangs- und Ausgangswiderstand. 3.3.3.3 Ankopplung des Verbraucherwiderstandes 3.3.3.4 Berechnung einer Emitterschaltung 3.3.4 Kleinsignalyerha1ten der Emitterschaltung mit Strom und Spannungsgegenkopplung. . . 3.3.4.1 Stromgegenkopplung 3.3.4.2 Spannungsgegenkopplung 3.3.5 Anwendung der Emitterschaltung 3.4 Kollektorschaltung 3.4.1 Arbeitspunkteinstellung 3.4.2 Kleinsignalverhalten der Kollektorschaltung 3.4.2.1 Verstärkung 3.4.2.2 Eingangs- und Ausgangswiderstand 3.4.3 Kollektorschaltung als Impedanzwandler 3.4.4 Bootstrap-Schaltung 3.4.5 Darlington-Schaltung 3.5 Basisschaltung 3.5.1 Arbeitspunkteinstellung 3.5.2 Kleinsignalverhalten der Basisschaltung 3.5.2.1 Eingangs- und Ausgangswiderstand 3.5.2.2 Verstärkung 3.6 Wechselspannungsverstärker 3.6.1 Kenngrößen des Wechselspannungsverstärkers 3.6.1.1 Verstärkung 3.6.1.2 Spannungsfrequenzgang 3.6.1.3 Phasenverschiebung 3.6.1.4 Signalverzerrungen - Klirrfaktor 3.6.1.5 Störspannungen 3.6.2 Mehrstufige Verstärker 3.6.2.1 Verstärkung und Bandbreite 3.6.2.2 Kopplung mehrstufiger Verstärker 3.6.3 Breitbandverstärker 3.6.3.1 Untere Grenzfrequenz 3.6.3.2 Obere Grenzfrequenz 3.6.3.3 Erhöhung der Bandbreite durch Gegenkopplung 3.6.4 Nf-Vorverstärker 3.6.4.1 Anforderungen 3.6.4.2 Schaltungsbeispiele mit bipolaren Transistoren 3.6.4.2.1 Zweistufiger Verstärker ohne Signalgegenkopplung 3.6.4.2.2 Zweistufiger Verstärker mit Signalgegenkopplung 3.6.4.3 Schaltungsbeispiele mit Feldeffekt-Transistoren 3.6.5 Nf-Leistungsverstärker 3.6.5.1 Anforderungen 3.6.5.2 Verstärkerarten 3.6.5.2.1 Eintaktverstärker 3.6.5.2.2 Gegentaktverstärker 3.6.5.3 Kollektorschaltung als Leistungsverstärker im A-Betrieb 3.6.5.4 Kollektorschaltung im Gegentaktbetrieb 3.7 Gleichspannungsverstärker 3.7.1 Anforderungen 3.7.2 Differenzverstärker 3.7.2.1 Grundschaltung des Differenzverstärkers 3.7.2.2 Asymmetrischer Ausgang 3.7.2.3 Anwendungen des Differenzverstärkers 3.8 Operationsverstärker 3.8.1 Betriebsal1en des Operationsverstärkers 3.8.2 Kenngrößen des Operationsverstärkers 3.8.2.1 Ruhegleichstrom - Stromoffset 3.18.2.2 Eingangs- und Ausgangswiderstände 3.8.2.3 Frequenzgang der Leerlaufverstärkung 3.8.2.4 Spannungsoffset 3.8.2.5 Gleichtaktverstärkung und Gleichtaktunterdrückung 3.8.2.6 Zusammenfassung der Eingangsspannungen 3.8.2.7 Aussteuerbereich des OPV 3.8.2.8 Maximale Anstiegsgeschwindigkeit 3.8.2.9 Zusammenstel1en von Datenblattwel1en 3.8.3 Grundschaltungen der Gegenkopplung 3.8.3.1 Gegenkopplungsarten des OPV 3.8.3.2 Wirkungsweise der Gegenkopplung 3.8.3.3 Schleifenverstärkung - Grenzen der Gegenkopplung 3.8.3.4 Linearität. Bandbreite und Phasenverschiebung des gegengekoppelten Verstärkers 3.8.3.5 Stabilität des gegengekoppelten Verstärkers 3.8.4 Ausgewählte gegengekoppelte Schaltungen 3.8.4.1 Nichtinvel1ierender Verstärker (Elektrometerverstärker) 3.8.4.2 Invel1ierender Verstärker 3.8.4.3 Summierverstärker 3.8.4.4Subtrahierverstärker- Differenzverstärker 3.8.4.5 Umschalten von invertierenden Betrieb auf nichtinvertierenden Betrieb 3.8.4.6 Einfache Filterschaltungen 3.8.4.7 Integrierverstärker 3.8.4.8 Stromquellen und Stromverstärker 3.8.4.9 Prinzip des Regelverstärkers 3.8.4.10 Instrumentierungsverstärker 3.8.4.11 Transimpedanzverstärker 4 Schaltungen zur Stabilisierung von Spannungen und Strömen 4.1 Einführung 4.2 Konstantspannungsquelle 4.3 Konstantstromquelle 4.4 Stabilisierung 4.4.1 Spannungsstabilisierung 4.4.1.1 Kenngrößen der Stabilisierung 4.4.1.2 Parallelstabilisierung 4.4.1.2.1 Z-Dioden-Stabilisierung 4.4.1.2.2 Stabilisierung mit Z-Diode und Quertransistor 4.4.1.2.3 Parallelstabilisierung mit Operationsverstärker 4.4.1.3 Serienstabilisierung 4.4.1.3.1 Stabilisierung mit Z-Diode und Längstransistor 4.4.1.3.2 Stabilisierung mit Z-Diode und Operationsverstärker 4.4.1.3.3 Stabilisierung mit Regelverstärker 4.4.1.3.4 Stabilisierung mit Regelverstärker für veränderliche Ausgangsspannung 4.4.1.3.5 Stabilisierung mit Regelverstärker bei großer Ausgangsleistung 4.4.2 Stromstabilisierung 4.4.2.1 Transistoren als Stromquelle 4.4.2.1.1 Bipolarer Transistor 4.4.2.1.2 Feldeffekt-Transistor 4.4.2.2 Stromquelle mit Operationsverstärker 4.4.2.3 Stromquelle für höhere Ströme 4.4.3 Strombegrenzung 4.4.3.1 Überstromsicherung 4.4.3.2 Strombegrenzung durch Widerstand 4.4.3.3 Stromregelung 4.4.4 Spannungsstabilisierung mit Schaltregler 4.4.4.1 Prinzip eines Schaltreglers mit Speicherdrossel (Durchflusswandler) 4.4.4.2 Schaltregler nach dem Sperrwandlerprinzip 4.4.4.3 Regelung des Tastverhältnisses 4.4.4.4 Integrierte Festspannungsregler 5 Transistor-Schalterstufen 5.1 Allgemeines 5.2 Betriebsarten 5.2.1 Nichtübersteuerter Betrieb 5.2.2 Übersteuerter Betrieb 5.3 Schaltvorgänge und Schaltzeiten 5.3.1 Schalten in den Durchlasszustand 5.3.2 Schalten in den Sperrzustand 5.3.3 Beeinflussung der Schaltzeiten 5.4 Schalten bei verschiedenartiger Belastung 5.4.1 Schalten bei ohmscher Belastung 5.4.2 Schalten bei kapazitiver Belastung 5.4.3 Schalten bei induktiver Belastung 5.4.4 Schalten von Heiß- und Kaltleitern 5.5 Belastbarkeit 5.5.1 Höchstzulässige Verlustleistung 5.5.2 Mittlere Verlustleistung 5.5.3 Impulsverlustleistung 5.6 Mehrstufiger Transistorschalter 6 Schaltungen mit Mehrschichtdioden, Diac und Triac 6.1 Vierschichtdiode als elektronischer Schalter 6.2 Thyristor als elektronischer Schalter 6.2.1 Zündschaltungen 6.2.1.1 Allgemeines 6.2.1.2 Phasenanschnittsteuerung. 6.2.1.3 Vollwellensteuerung (Wellenpaketsteuerung) 6.2.2 Anwendungen des Thyristors 6.2.2.1 Vollweg-Leistungssteuerung 6.2.2.2 Einstellbarer Gleichrichter 6.2.2.3 Vollwellenschaltung 6.3 Diac und Triac als elektronische Schalter 6.3.1 Phasenanschnittsteuerung 7 Kippschaltungen 7.1 Bistabile Kippstufe 7.1.1 Arbeitsweise 7.1.2 Ansteuerungsarten 7.1.3 Bistabile Kippstufen mit besonderen Eigenschaften 7.1.4 Anwendungsbeispiele 7.1.4.1 Bistabile Kippstufe als Frequenzteiler 7.1.4.2 Bistabile Kippstufe als Signalspeicher 7.1.5 Bemessung bistabiler Kippstufen 7.2 Monostabile Kippstufe 7.2.1 Arbeitsweise 7.2.2 Monostabile Kippstufe mit Schutzdiode 7.2.3 Ansteuerungsarten 7.2.4 Anwendungsbeispiele 7.2.4.1 Schaltung zur Impulsver1ängerung 7.2.4.2 Schaltung zur Impulsregenerierung 7.2.5 Schaltzeichen 7.2.6 Bemessung monostabiler Kippstufen 7.3 Astabile Kippschaltung (Multivibrator) 7.3.1 Arbeitsweise 7.3.2 Schaltungsaufbau und Impuls-Pausen- Verhältnis 7.3.3 Bemessung von astabilen Kippschaltungen 7.3.4 Anwendungsbeispiele 7.3.4.1 Impulsgeber 73.4.2 Rechteckgenerator. 7.3.4.3 Einfache Blinkschaltung 7.3.5 Synchronisierte astabile Kippschaltung 7.3.6 Schaltzeichen 8 Generatorschaltungen 8.1 Prinzip einer Generatorschaltung 8.1.1 Allgemeine Schwingbedingungen 8.2 Erzeugung rechteckförmiger Spannungen 8.3 Erzeugung von sägezahnförmigen Spannungen 8.3.1 Sägezahngenerator mit Stromquelle 8.3.2 Miller-Integrator 8.3.3 Sperrschwinger 8.3.4 Synchronisierung eines Sägezahngenerators 8.4 Erzeugung sinusförmiger Spannungen 8.4.1 LC-Generatoren 8.4.1.1 Meißner-Oszillator 8.4.1.2 Induktive Dreipunktschaltung 8.4.1.3 Kapazitive Dreipunktschaltung 8.4.2 Quarzgeneratoren 8.4.3 RC-Generatoren 8.4.3.1 Phasenschiebergenerator 8.4.3.2 Wien-Robinson-Generator 9 Impulsformerschaltungen 9.1 Zeitfunktionen von Strom und Spannung 9.2 Begrenzerschaltungen 9.2.1 Begrenzerschaltungen mit Dioden 9.2.2 Begrenzerschaltungen mit Transistoren 9.3 Integrierglied 9.3.1 Arbeitsweise des RC-Gliedes 9.3.2 Mathematische und elektrische Integration 9.4 Differenzierglied 9.4.1 Arbeitsweise des CR-Gliedes 9.4.2 Mathematische und elektrische Differentiation 9.5 Schmitt-Trigger 9.5.1 Arbeitsweise 9.5.2 Bemessung eines Schmitt-Triggers 9.5.3 Anwendungsbeispiele 9.5.3.1 Schwellwertschalter 9.5.3.2 Sinus-Rechteck-Spannungswandler 9.5.4 Schaltzeichen 10 Grundlagen der Regelungstechnik 10.1 Allgemeines 10.1.1 Begriffe der Regelungstechnik 10.1.2 Darstellung des Regelkreises 10.2 Zeitverhalten der Regelkreisglieder 10.2.1 Unstetige Regeleinrichtungen 10.2.2 Stetige Regeleinrichtungen 10.2.2.1 Proportionale Regeleinrichtung 10.2.2.2 Integrierende Regeleinrichtung 10.2.2.3 PI-Regeleinrichtung 10.2.2.4 D-Regeleinrichtung 10.2.2.5 PD-Regeleinrichtung 10.2.2.6 PID-Regeleinrichtung 10.3 Beispiele für einfache Regelkreise 10.3.1 Temperaturregelung 10.3.2 Drehzahlregelung von Kleinmotoren 11 Einführung in die Digitaltechnik 11.1 Grundbegriffe 11.1.1 Analoge und digitale Signale 11.1.2 Logische Zustände "0" und "l" 11.2 Logische Verknüpfungen 11.2.1 UND-Verknüpfung 11.2.2 ODER-Verknüpfung 11.2.3 Verneinung 11.2.4 NAND-Verknüpfung 11.2.5 NOR-Verknüpfung 11.3 Schaltungen logischer Glieder 11.3.1 Schaltungen in Relais-Technik 11.3.2 Schaltungen in DTL- Technik 11.3.3 Schaltungen in TTL-Technik 11.3.4 Schaltungen in MOS-Technik 11.4 Pegelangaben “Low” and "High” 11.4.1 Allgemeines 11.4.2 Positive Logik 11.4.3 Negative Logik 11.5 Schaltungsanalyse 11.5.l Allgemeines 11.5.2 Soll-Verknüpfung 11.5.3 Ist-Verknüpfung 11.6 Schaltalgebra 11.6.1 Grundlagen 11.6.2 Bestimmung der Funktionsgleichung einer Schaltung 11.6.3 Darstellung der Schaltung nach der Funktionsgleichung 11.6.4 Funktionsgleichung und Kontaktschema 11.6.5 Nutzungsmöglichkeiten der Schaltalgebra 11.7 Schaltungssynthese 12 Digitale Kodes und digitale Zähl- und Speichertechnik 12.1 Darstellung von Ziffern und Zahlen 12.1.1 Duales Zahlensystem 12.1.2 BCD-Kode(8-4-2-I-Kode) 12.1.3 Weitere Binär-Kodes 12.2 Schaltungen zum Kodieren und Dekodieren 12.2.1 Umsetzen von Dezimalziffern in Dualzahlen 12.2.2 Umsetzen von Dualzahlen in Dezimalziffern 12.3 Rechnen mit Dualzahlen 12.3.1 Umwandlung von Zahlen 12.3.2 Addition von Dualzahlen 12.3.3 Subtraktion von Dualzahlen 12.4 Speichern und Verschieben digitaler Signale 12.4.1 Flipflop-Arten 12.4.2 Schieberegister. 12.4.3 Flipflop-Speicher 12.4.4 Magnetkernspeicher 12.5 Zählerschaltungen 12.5.1 Frequenzteiler 12.5.2 Vorwärtszähler 12.5.3 Rückwärtszähler 12.5.4 Zähldekaden Stichwortverzeichnis |
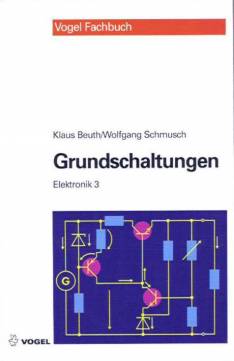
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen