|
|
|
Umschlagtext
Siehe Informationstext.
Rezension
Ist digitale Technik wertneutral? Besitzt der Menschen im digitalen Zeitalter keinen freien Willen? Leben wir in einem Zeitalter des Wahrheitsrelativismus? Gefährdet die Digitalisierung die Demokratie? Welches sind die zentralen Werte einer KI-Ethik? Führen Algorithmen zur Diskriminierung bestimmter sozialer Gruppen? Sollte es Rechte für Roboter geben? Lassen sich Emotionen durch KI simulieren?
Alle diese Fragen beziehen sich auf die digitale Ethik, die sich nach Dagmar Fenner unterteilen lässt in digitale Medienethik und KI-Ethik. Der ausdifferenzierte Diskurs über Ethik und Digitalisierung wird in den Medien breit rezipiert. Zur eigenen reflektierten Urteilsbildung in der Debatte bedarf es einer ethischen Kartographie dieses komplexen Problemfelds der Moral. Diese gelingt Dagmar Fenner (*1971) hervorragend in ihrem neuen Buch „Digitale Ethik“, erschienen als UTB-Band des Tübinger Narr Francke Attempto Verlags. Die Titularprofessorin für Philosophie an der Universität Basel identifiziert präzise Pro- und Contra-Argumente bei ethischen Problemen, analysiert diese gekonnt und überprüft differenziert ihre Tragfähigkeit unter Bezugnahme auf „normative Bezugsgrößen“ wie das gute Leben, Willens- und Handlungsfreiheit, Gerechtigkeitsformen und Nichtdiskriminierung sowie die Kategorien Privatsphäre und Nachhaltigkeit. Zurecht kritisiert sie die Wertneutralitätsthese von Technik und den digitalen Determinismus der Transhumanisten. Fenner plädiert für die Kontrolle des Menschen über die Technik sowie die Förderung von „digitaler (Medien-)Kompetenz“, „AI Literacy“ und „kritischem Bewusstsein“ in der Schule. Fenner, bekannt u.a. durch ihre lesenswerten Überblickswerke „Ethik. Wie soll ich handeln?“(2008), „Einführung in die Angewandte Ethik“(2010), „Religionsethik. Ein Grundriss“(2016), „Selbstoptimierung und Enhancement. Ein ethischer Grundriss“ (2019) leistet mit ihrem neuen Buch einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der Debatten innerhalb der digitalen Ethiken, im besten Sinne zur „ethisch-moralischen Urteilsbildung in praktischer Absicht“ - dem Hauptziel des Ethikunterrichts in Baden-Württemberg nach dem Bildungsplan 2016. Lehrkräfte der Fächer Philosophie, Ethik, Religionslehre oder Technik, die sich in einzelnen Unterrichtsstunden oder in einem fächerübergreifenden Projekt mit diesen aktuellen Fragestellungen der digitalen Ethik problemorientiert auseinandersetzen möchten, können sich mittels des Bandes grundlegendes Orientierungswissen sehr gut aneignen. Fazit: Wer sich fachwissenschaftlich fundiert, umfassend und zugleich didaktisch fokussiert über zentrale Positionen und Argumentationen der interdisziplinären Debatten der digitalen Ethik informieren möchte, dem sei Dagmar Fenners Buch „Digitale Ethik“ unbedingt zur Anschaffung empfohlen. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die rasch voranschreitende Digitalisierung und der damit verbundene tiefgreifende Kulturwandel erfordern dringend ethische Reflexionen und mehr gesellschaftliche Gestaltung. In dieser Einführung werden wichtige Grundbegriffe und normative Leitideen geklärt. Im ersten Teil Digitale Medienethik geht es um Probleme wie Fake News, Emotionalisierung und Hassrede in Online-Medien. Dies führt zur Frage, ob das Internet die Demokratie eher fördert oder gefährdet. Der zweite Teil KI-Ethik reflektiert die Gefahren von Datafizierung und Big-Data-Analysen, z. B. Diskriminierung oder Verlust von Freiheit. Zudem wird beleuchtet, wie der vermehrte Einsatz von Robotern unser Leben und unser Menschenbild verändert. Gegeben wird ein kritisch abwägender Überblick über das hochkomplexe aktuelle Themenfeld mit klarer Struktur und vielen Übersichten. Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung 11
1 Einleitung und ethischer Grundriss 15 1.1 Begriffsklärungen und kultureller Hintergrund 20 1.1.1 Bedeutungsebenen der Digitalisierung 20 1.1.2 Algorithmen, Internet und Künstliche Intelligenz 28 1.1.3 Polarisierung in der Digitalisierungsdebatte 33 1.1.4 Kritik am digitalen Technikdeterminismus 37 1.1.5 Einfluss der Science-Fiction 40 1.2 Normative Grundlagen Digitaler Ethik 44 1.2.1 Vermeintliche Neutralität der Technik 44 1.2.2 Ethik, Moral und Recht 51 1.2.3 Konsequentialismus, Deontologie und Tugendethik 59 1.2.4 Digitale Ethik als Bereichsethik der Angewandten Ethik 67 1.2.5 Partizipation, Diskurs und Verantwortung 75 1.3 Allgemeine ethische Leitideen 80 1.3.1 Freiheit 91 1.3.2 Glück und gutes Leben 102 1.3.3 Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung 112 1.3.4 Privatsphäre 118 1.3.5 Nachhaltigkeit 125 2 Digitale Medienethik 133 2.1 Grundlagen der Digitalen Medienethik 133 2.1.1 Digitale Medien und ihre Kommerzialisierung 137 2.1.2 Verantwortungsteilung beim Medienhandeln 143 2.1.3 Leitideen der Medienethik 154 2.1.3.1 Wahrheit und Wahrhaftigkeit (1) 156 2.1.3.2 Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit (2) 164 2.1.3.3 Relevanz und kritische Öffentlichkeit (3) 166 2.1.3.4 Angemessene Präsentation ohne Sensationalisierung (4) 170 2.1.3.5 Achtung von Persönlichkeitsrechten und Diskursorientierung (5) 171 2.2 Konfliktfelder der Online-Kommunikation 174 2.2.1 Informationsflut: schnelles Denken und Emotionalisierung 174 2.2.2 Desinformation: Fake News und Verschwörungstheorien 194 2.2.3 Fragmentierung: Filterblasen und Echokammern 217 2.2.4 Digitale Gewalt: Online-Hassrede und Cybermobbing 228 2.3 Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Demokratie 249 3 Kl-Ethik 281 3.1 Grundlagen der Kl-Ethik 287 3.1.1 Menschliche und Künstliche Intelligenz 287 3.1.2 Maschinelles Lernen und das Black-Box-Problem (Andreas Klein) 294 3.1.3 Leitideen der Kl-Ethik 299 3.1.3.1 Transparenz 299 3.1.3.2 Sicherheit 302 3.1.3.3 Menschliche Aufsicht 304 3.2 Konfliktfelder der Datafizierung und Big-Data- Analyse 306 3.2.1 Dataismus: Objektivitätsglaube und Quantifizierung 312 3.2.2 Überwachung: Privatheitsverlust und Manipulation 320 3.2.3 Diskriminierung: Klassifikation und Biases 348 3.2.4 Algorithmische Steuerung: Sozialkredit-System und Algokratie 364 3.3 Konfliktfelder Kl-basierter Roboter und virtueller Akteure 377 3.3.1 Moralischer Status: moralische Akteure und Roboterrechte 389 3.3.2 Künstliche Moral: Moralimplementierung und Dilemmasituationen 412 3.3.3 Soziale Robotik: künstliche Gefährten und emotionale KI 443 3.3.4 Ersetzbarkeit: Arbeitsplatzverlust und generative KI 477 3.4 Chancen und Risiken vermehrter Mensch-Maschine-Interaktionen 493 4 Schluss und Ausblick 515 Bibliographie 531 Sachregister 569 Personenregister 581 |
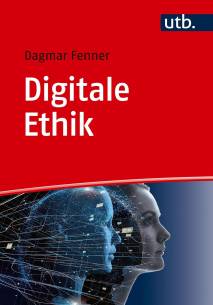
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen