|
|
|
Umschlagtext
Frankreich und Deutschland sind die wichtigsten Partner in Europa. Ohne sie gibt es keine wirklichen Fortschritte in der Europäischen Union. Aber immer wieder kommt es zwischen beiden Ländern zu Konflikten. Sind sie zu verschieden, um wirklich ein deutsch-französischer Motor zu sein? Das Buch beschreibt die vielfältigen, oft wenig bekannten Facetten der bilateralen Beziehungen. Es erklärt Potenziale, Grenzen und Probleme einer spannungsreichen, aber konstruktiven Partnerschaft.
Europa ist der eigentliche Horizont der bilateralen Kooperation. Das zeigt sich besonders in der Wirtschafts- und Währungspolitik. Das Buch zeigt auf, wie unterschiedliche Interessen und Positionen den Alltag der bilateralen Beziehungen und der EU bestimmen. Die wertvolle Leistung beider Länder ist es, durch harte gemeinsame Arbeit tragfähige europäische Kompromisse zu erarbeiten. Aber dies gelingt immer seltener. Ein weiterer Schwerpunkt behandelt die wechselseitigen kulturellen Einflüsse und die zahlreichen gesellschaftlichen Beziehungen. Städte-, Schul- oder Vereinspartnerschaften, Austauschprogramme für junge Menschen, integrierte Studiengänge: Der Beitrag dieser zivilgesellschaftlichen Partnerschaften und Netzwerke ist wenig bekannt und oft unterschätzt worden. Dabei sind sie längst zu einem prägenden, weltweit einmaligen Fundament der deutsch-französischen Beziehungen geworden.So entsteht das Bild einer lebendigen, kooperativen, aber auch spannungsvollen Beziehung. Henrik Uterwedde beleuchtet die zentrale Rolle beider Länder für die europäische Integration, geht den Erfolgen, aber auch den Schwierigkeiten und Grenzen der bilateralen Kooperation nach. Damit bietet er dem Leser solides Grundlagenwissen, aber auch problemorientierte Zusammenhänge und erklärt das schwierige Zusammenspiel von Frankreich, Deutschland und Europa. Prof. Dr. Henrik Uterwedde, zuvor stellvertretender Direktor am Deutsch-Französischen Institut (dfi); bis 2013 Universitäten Stuttgart und Osnabrück, assoziierter Wissenschaftler am dfi, Ludwigsburg Rezension
Heute selbstverständlich: zahlreiche Städte-, Schul- oder Vereinspartnerschaften, Austauschprogramme für junge Menschen, integrierte Studiengänge: Die deutsch-französischen Beziehungen gehören zum Zentralsten, was Europa in den letzten 200 Jahren beschäftigt und geprägt hat. Die alte Feindschaft mit 23 Kriegen in den vergangenen 400 Jahren ist seit den 1960er Jahren allmählich einer deutsch-französischen Freundschaft gewichen, die einen wesentlichen Beitrag zur Europäischen Union geleistet hat. Das Buch beschreibt die vielfältigen, oft wenig bekannten Facetten der bilateralen Beziehungen. Es erklärt Potenziale, Grenzen und Probleme einer spannungsreichen, aber konstruktiven Partnerschaft. Europa ist der eigentliche Horizont der bilateralen Kooperation. Das zeigt sich besonders in der Wirtschafts- und Währungspolitik.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das Buch bietet dem Leser solides Grundlagenwissen, aber auch problemorientierte Zusammenhänge. Damit hilft es, das schwierige Zusammenspiel von Frankreich, Deutschland und Europa besser zu verstehen. Zahlreiche Schlüsselzitate, Tabellen und Abbildungen sowie Literatur und Internethinweise bieten die Möglichkeit zur Vertiefung. dfi_aktuell 5/2019 Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Ein besondere und schwieriges Verhältnis 11
1. Geschichte einer spannungsreichen Nachbarschaf 15 1.1 Romania und Germania 15 1.2 Von der Französischen Revolution zum Deutsch-Französischen Krieg 19 1.3 Vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg 23 1.3.1 Der Erste Weltkrieg 23 1.3.2 Der Zweite Weltkrieg: Besatzung, Kollaboration, Résistance 24 1.4 Ein fundamentaler Neuanfang seit 1945 26 1.4.1 Welches Deutschland soll es sein? 26 1.4.2 Zivilgesellschaftliche Initiativen 27 1.4.3 Der Elysée-Vertrag von 1963 29 2. Warum Deutschland und Frankreich? 33 2.1 Kritik an der Partnerschaft 34 2.1.1 Zweifel am Partner 34 2.1.2 Deutsch-französische Dominanz? 36 2.2 Frankreich ist wichtig für Deutschland 37 2.3 Zwei Kernstaaten in Europa 40 2.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten 42 3. Europa – Ausgangspunkt und Zielhorizont 47 3.1 Ein neuer Rahmen für die Beziehungen 48 3.2 Frankreich: Europapolitik als Deutschlandpolitik 49 3.2.1 Politik der kooperativen Einbindung 50 3.2.2 Prekäres Gleichgewicht 51 3.3 Europa als Horizont der bilateralen Kooperation 53 3.4 Deutschland, Frankreich und Osteuropa 54 4. Deutsch-französischer Motor:Gibt es ihn? Was kann er leisten? 59 4.1 Die institutionalisierte Kooperation 59 4.1.1 Ein dichtes Netz an Kontakten 60 4.1.2 Positive Wirkungen 63 4.2 Der Motor: Voraussetzungen, Wirkungen, Probleme 65 4.2.1 Vive la diférence! Vom intelligenten Umgang mit Unterschieden 67 4.2.2 Nicht ohne uns: Die Einbindung der EU-Partner 68 4.2.3 Die Last der Innenpolitik 70 4.3 Welche Führungsrolle in Europa? 72 5. Wirtschaf: Vom Motor zum Spaltpilz? 75 5.1 Eine enge Verfechtung 75 5.1.1 Privilegierte Handelsbeziehungen 76 5.1.2 Unternehmen im Nachbarland 78 5.1.3 Industrielle Kooperationen 80 5.1.4 Wirtschaftsbeziehungen: mehr als Ökonomie 83 5.2 Partner und Konkurrenten 84 5.2.1 Rivalitäten 84 5.2.2 Deutsch-französisches Wirtschaftsgefälle? 85 5.3 Wirtschaftspolitik: Kooperation mit Hindernissen 86 5.3.1 Unterschiedliche Grundansätze der Wirtschaftspolitik 86 5.3.2 Vom Umgang mit den Diferenzen 90 6. Ein Euro, zwei Visionen? 93 6.1 Der lange Weg zur gemeinsamen Währung 93 6.1.1 Eine bewegte Vorgeschichte 94 6.1.2 Eine schwere Geburt: der Vertrag von Maastricht 95 6.2 Deutsch-französische Divergenzen 97 6.2.1 Unterschiedliche Grundansätze 97 6.2.2 Die Währungsunion im Maastricht-Vertrag: deutsche Handschrift 99 6.3 Konfikte, Krisen, Kompromisse 101 6.3.1 Streit über Griechenland 101 6.3.2 Streit um Reformen 104 6.3.3 Einigung auf Reformen 105 6.3.4 Ungeliebte Kompromisse 107 7. Die gesellschafliche Basis der Beziehungen 111 7.1 Zivilgesellschaftliche Akteure 112 7.1.1 Eine junge Entwicklung 112 7.1.2 Pioniere der Aussöhnung nach 1945 112 7.1.3 Eine vielfältige Akteurslandschaft 114 7.2 Kommunalpartnerschaften – für ein Europa der Bürger 117 7.2.1 Eine Erfolgsgeschichte 118 7.2.2 Ein breites Profl der Aktivitäten 120 7.2.3 Probleme und Erneuerung 122 7.3 Warum die Zivilgesellschaft wichtig ist 124 8. Kulturelle Beziehungen und Wechselwirkungen 129 8.1 Strukturwandel der Kulturbeziehungen 129 8.1.1 Kulturelle Wechselwirkungen 130 8.1.2 Ein neuer Kulturbegrif 131 8.1.3 Eine Vielzahl von Akteuren 132 8.2 Das Deutsch-Französische Jugendwerk 134 8.2.1 Eine originelle Gründung 135 8.2.2 Weitreichende Wirkungen 137 8.3 Der schwierige Weg zur europäischen Öfentlichkeit 138 8.3.1 Bilder vom Nachbarn 138 8.3.2 Eine transnationale Öfentlichkeit? 140 8.3.3 Arte: Vorreiter oder Nischenprojekt? 143 9. Bildung und Wissenschaft 147 9.1 Bildung und Ausbildung: Kooperation mit Grenzen 148 9.1.1 Sprachlose Freundschaft? 148 9.1.2 Qualitative Sprünge 151 9.1.3 Stiefkind berufiche Bildung? 152 9.2 Hochschulen und Wissenschaft: dynamische Vernetzung 154 9.2.1 Ein dichtes Kooperationsnetz 155 9.2.2 Führungskräfte für Europa: die integrierten Studiengänge 156 9.2.3 Netzwerke in Wissenschaft und Forschung 158 10. Perspektiven 163 10.1 Erfolge und Grenzen der Kooperation 163 10.1.1 Merkmale einer produktiven Partnerschaft 163 10.1.2 Mehr Bürgernähe? 164 10.2 Gelebte Nachbarschaft: die grenznahen Regionen 166 10.2.1 Grenzregionen – Nahtstellen in Europa 167 10.2.2 Die Frankreich-Strategie des Saarlandes 169 10.3 Parlamentarische Initiativen 171 Weiterführende Literatur und Quellen 175 Gesamtdarstellungen 175 Nützliche Internetquellen 176 Verzeichnis der Abkürzungen 177 |
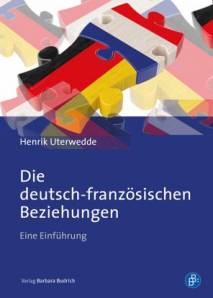
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen