|
|
|
Umschlagtext
Zwischen dem 4. und dem 16. Jahrhundert gehört die Verkündigung an Maria in Italien zu den am häufigsten dargestellten Themen der christlichen Kunst. Grundlage der Darstellungen ist der Bericht des Lukasevangeliums. Aber wie läßt sich ein Text ins Bild umsetzen, der fast nur aus einem Gespräch besteht? Und zwar aus einem Gespräch, bei dem jedes Wort für den Gläubigen wichtig und bedeutungsvoll ist? Bei dem jede Generation von Theologen weitere Bedeutungen und Bezüge entdeckt hat? Immer neue Bildzeichen und immer komplexere Verknüpfungen hat die Bildende Kunst entwickelt, um in ihrer Sprache von der Verkündigung zu erzählen, das Geschehen zu erläutern, seine Bedeutung vor Augen zu führen und den Betrachter zum rechten Gebrauch des Bildwerks anzuleiten. Die vorliegende Arbeit macht dem heutigen Betrachter diese Symbolsprache wieder zugänglich, sie erläutert ihre Herkunft und ihren historischen Wandel. Sie führt dann in einer Reihe von exemplarischen Bildbeschreibungen vor, wie mit diesem Wissen das einzelne Kunstwerk und seine je eigene „Predigt" wieder verständlich wird.
Rezension
Über viele Jahrhunderte hin hat die Kunst im Dienst der Verkündigung der Kirche gestanden; die Bilder dienten dem Wort. Dabei war das Verhältnis von Bild und Wort in der biblisch-kirchlichen Tradition von jeher extrem umstritten zwischen Ikonodulen und Ikonoklasten; Phasen von Bilderfeindschaft und Bilderstürmerei vom Dekalog bis hin zum linken Flügel der Reformation haben sich immer wieder mit Phasen der Bilderverehrung abgelöst. Erst mit der konstantinischen Wende (4. Jhdt.) kann die christliche Bildproduktion eigentlich beginnen und ein frühes und überaus häufiges Motiv stellt die sog. Verkündigung an Maria dar, in der gemäß Lukas 1,26-38 der Engel Gabriel der Jungfrau verkündet: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären ... . Das vorliegende Buch erläutert an diesem Motiv exemplarisch auf hervorragende Art und Weise, wie die Bildende Kunst der Verkündigung dienstbar gemacht worden ist, wie das Bild den Text umsetzen soll, wie das Bild immer stärker mit Symbolsprache zum Zwecke der Prdigt angereichert wird und sich so eine dem heutigen Betrachter nicht selten verschlossene umfängliche allegorische Symbolsprache im Bild entwickelt. Dem Buch kommt dabei das große Verdienst zu, exemplarisch am Motiv der Verkündigung an Maria zwischen 4. und 16. Jhdt. die historische Entwicklung und Bedeutung dieser Bildsymbolik aufzuzeigen und sie überzeugend an abschließenden Bildbeispielen anzuwenden. Hier läßt sich überzeugend lernen, was Ikonographie bedeutet. Detailliert, substantiell und verständlich gearbeitet bietet das Buch auch formal alles Notwendige zum Verstehen des Sachverhalts (schriftliche Quellen, Bildmaterial, Sekundärliteratur etc.).
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Einleitung 11 I. Die schriftlichen Quellen der Darstellung 17 1. Die Evangelien 17 2. Das "Protoevangelium des Jakobus" 19 3. Die Kirchenväter 23 4. Das "Pseudo-Matthäus-Evangelium" 27 5. Theologen des frühen Mittelalters 30 6. Marienlyrik 32 7. Bernhard von Clairvaux 33 8. Die "Legenda Aurea" des Jacobus de Voragine 37 9. Die franziskanische Marienverehrung und die "Meditationes Vitae Christi" 38 10. Dantes "Göttliche Komödie" 42 11. Die Verkündigung im geistlichen Spiel 43 II. Die ikonographischen Elemente 47 1. Allgemeines 47 2. Maria und Gabriel 48 Verkündigung an der Quelle, am Brunnen 48; Maria spinnt die Purpurwolle 49; Maria mit Buch 50; das Wort im Bild 51; Maria sitzend, stehend oder kniend 52; Gabriel fliegend 53; Gabriel stehend oder kniend 54; Maria erhöht über Gabriel 54; Hoheitszeichen Marias 55; Stern 55; Marias Kleidung 56; Marias bedecktes Haupt 57; Teint und Haarfarbe Marias 57; Nimben 57; Gabriels Kopfschmuck 58; Gabriels Kleidung 58; Gabriel geflügelt 59; Zeichen seines Botenamtes 59; Gabriels Gesten 59; Marias Gesten 61; das ganze Geschehen - die Stationen der Handlung 61 3. Andere Beteiligte 63 Die Taube des Heiligen Geistes 63; Gott - Vater und Sohn 63; Jesuskind 64; Aussendung Gabriels 65; weitere Engel 65; Dienerinnen Marias 66; Josef 66; Eva 66; Propheten 66; Heilige 67; Stifter 67 Exkurs: Rechts und Links 67 4. Architektonische Elemente 70 Palast und Tempel 71; Säulen 71; Tabernakel 71; Tor 71; Abgrenzung von himmlischer und irdischer Sphäre 72; Marias Raum 73; Fenster 73 5. Möblierung und Ausstattung 74 Sitzmöbel 74; Pult, Bett 75; Vorhang 75; Teppich 76; Vase 76; Karaffe, Schachtel, Salbgefäß 77; Leuchter 77 6. Garten und Pflanzen 78 Garten 78; Brunnen 78; Pflanzen 78; Bäume 78; Palme 79; Ölbaum, Myrte 80; Zeder, Zypresse, Lorbeer 81; Baumstumpf 81; Zweig 81; Blumen 81; Lilie 81; Schwertlilie 82; Rose, Pfingstrose, Nelke 83; Heilpflanzen 84; Frühlingsblumen 84; Früchte 85 7. Tiere 85 Muschel 85; Schnecke 86; Hund 86; Vogel 86; Vogelkäfig 86; Schwalbe, Taube, Pfau 86 8. Landschaft 87 Straße, Weg, Brücke 87; Hafen, Festung, Stadt 88 9. Schlussbemerkungen 89 III. Bildbeispiele, Beschreibung exemplarischer Kunstwerke 91 1. Deckenbild in der Priscilla-Katakombe, Rom 91 2. Relief des Pignatta-Sarkophags, Ravenna 93 3. Mosaik in Santa Maria Maggiore, Rom 94 4. Elfenbeindiptychon im Domschatz von Mailand 99 5 Trivulzio-Elfenbein, Castello Sforzesco, Mailand 101 6. Mosaik in der Martoranakirche, Palermo 103 7. Pietro Cavallini, Santa Maria in Trastevere, Rom 106 8. Giotto, Arena-Kapelle, Padua 112 9. Pacino di Buonaguida, Arbor Vitae, Accademia, Florenz 118 10. Bernardo Daddi, Louvre, Paris 120 11. Simone Martini, Uffizien, Florenz 122 12. Ambrogio Lorenzetti, Pinacoteca Nazionale, Siena 127 13. Lorenzo Veneziano, Accademia, Venedig 131 14. Donatello, Santa Croce, Florenz 132 15. Fra Angelico, Museo Diocesano, Cortona 136 16. Domenico Veneziano, Fitzwilliam Museum, Cambridge 140 17. Fra Filippo Lippi, Galleria Nazionale di Arte Antica, Rom 143 18. Alessio Baldovinetti, Uffizien, Florenz 145 19. Piero della Francesca, San Francesco, Arezzo 147 20. Benedetto Bonfigli, Galleria Nazionale deH'Umbria, Perugia 153 21. Francesco Cossa, Gemäldegalerie, Dresden 155 22. Leonardo da Vinci, Uffizien, Florenz 158 23. Carlo Crivelli, National Gallery, London 161 24. Sandra Botticelli, Uffizien, Florenz 168 25. Domenico Ghirlandaio, Santa Maria Novella, Florenz 170 26. Pinturicchio, Santa Maria Maggiore, Spello 171 Anhang: Schriftliche Quellen im Wortlaut 177 1. Aus dem Evangelium des Lukas 177 2. Aus dem "Protoevangelium des Jakobus" 178 3. Aus dem "Pseudo-Matthäus-Evangelium" 179 4. Aus der "Legenda Aurea" des Jacobus de Voragine 180 5. Aus den "Meditationes Vitae Christi" 185 Literaturverzeichnis 189 1. Quellentexte 189 2. Forschungsliteratur 193 Abbildungsverzeichnis 207 Abbildungsnachweis 209 |
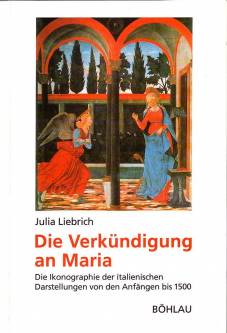
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen