|
|
|
Umschlagtext
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte
Im Auftrag des Vereins für Reformationsgeschichte herausgegeben von Irene Dingel Band 88 Rezension
Das Täufertum als radikaler Flügel der Reformation brachte in der westfälischen Stadt Münster für einige Monate um das Jahr 1534 herum eine autoritäre Herrschaft hervor, die ihresgleichen sucht. Apokalyptisch geprägter Aufbruch und Radikalismus führten zu Intoleranz und Kampf gegen Katholizismus und Luthertum gleichermaßen, - und wurde von eben diesen Kräften zerrieben, so dass der sog. linke Flügel der Reformation komplett aus Deutschland vertrieben wurde und Zuflucht nur in den Niederlanden und später den USA und Russland fand. - Der hier anzuzeigende Band aus der renommierten Reihe "Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte" ist freilich keine allgemein-verständliche Gesamtdarstellung der Täuferherrschaft in Münster, sondern eine wissenschaftliche Darstellung zu einer spezifischen Fragestellung in diesem Kontext: die reichspolitische Dimension des Konflikts um die Täuferherrschaft. Der voluminöse Band zeigt unter Verwendung neu erschlossener Quellen in diversen Archiven, wie König, Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädte in das Geschehen in Münster involviert waren.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Günter Vogler, geboren 1933, studierte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und war dort von 1969 bis 1996 ordentlicher Professor (Frühe Neuzeit). Er ist Autor von Publikationen zur deutschen und brandenburg-preußischen Geschichte. Monographien und wissenschaftliche Beiträge beschäftigen sich besonders mit Themen der Reformations- und Bauernkriegsgeschichte, u.a. mit Thomas Müntzer und dessen Rezeption. Eine detaillierte Darstellung, die neue Akzente setzt In der neueren Literatur wurde eingehend untersucht, wie die Täuferherrschaft in Münster schrittweise Konturen gewann. Weniger interessierte dagegen die reichspolitische Dimension des Konflikts. Günter Vogler zeigt nun anhand bisher nicht oder nur selektiv genutzter Quellen aus zahlreichen Archiven, auf welche Weise König Ferdinand, Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädte mit dem Geschehen in Münster konfrontiert wurden. Als eine wachsende Zahl von Reichsständen zur Unterstützung der Belagerung Münsters aufgefordert wurde, fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Ausführlich wird zudem dargestellt, aus welchen Gründen die beschlossenen Hilfsmaßnahmen nur zögerlich umgesetzt wurden und die Stadt erst durch Verrat erobert werden konnte. Mit der detaillierten Darstellung werden neue Akzente gesetzt. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
I. Die Täufer und die Täuferherrschaft in Münster Eine Einführung 13 1. Die Täuferherrschaft – ein Stein des Anstoßes 13 2. Die Täuferherrschaft, das Reich und die Reichsstände 17 3. Täufergemeinden und ihre Lebensweisen 22 4. Nächstenliebe und Gütergemeinschaft 28 5. Endzeit und neue Ordnung 30 6. Verketzerung und Verfolgung 33 7. Münster – Restitution und Neues Jerusalem 37 8. Politische und religiös-konfessionelle Konstellationen im Reich 43 II. Von Orsoy bis Neuß Die Anfänge des Kampfes gegen die Täuferherrschaft in Münster 50 1. Beginn der Belagerung und erste Hilfeersuchen 50 2. Der Tag zu Orsoy 58 3. Die Einschaltung König Ferdinands 62 4. Informationsaustausch über täuferische Aktivitäten 68 5. Die Intensivierung der Bemühungen um Hilfe und der erste Tag zu Neuß 72 6. Der erste Sturmangriff und sein Fehlschlagen 77 7. Die neue Situation und der zweite Tag zu Neuß 87 III. Von Neuß bis Oberwesel Ein neuer Anlauf zur Eroberung der Stadt und die Folgen 93 1. Verhandlungen mit weiteren Fürsten 93 2. Der zweite Sturmangriff und die Errichtung der Blockhäuser 104 3. Der Kurfürstentag zu Mainz und die Folgen 113 4. Der Tag zu Essen 122 5. Der Tag der Rheinischen Einung in Oberwesel 128 6. Eine kurze Zwischenbilanz 134 IV. Das Reichstagsprojekt und der Tag zu Koblenz Vorbereitungen, Beratungen und Beschlüsse 137 1. Überlegungen zur Einberufung eines Reichstags 137 2. Vorbereitung des Koblenzer Tags 145 3. Der Verlauf des Tags zu Koblenz 154 4. Der Koblenzer Abschied 164 V. Zwischen Koblenz und Worms Reichstagsprojekt, Wortkrieg und Umsetzung der Koblenzer Beschlüsse 168 1. Stellungnahmen zum Reichstagsprojekt 168 2. Vorbereitung der Zusammenkunft in Worms 180 3. Der »Wortkrieg« zwischen Belagerten und Belagerern 182 4. Hoffnung auf Entsatz und Vorkehrungen der Gegner 191 5. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Koblenzer Beschlüsse 199 6. Ein Vermittlungsversuch von Hansestädten 212 7. Der Städtetag in Esslingen 215 VI. Vorbereitung des ersten Tags in Worms Einladungen, Instruktionen und Geldnot 223 1. Vorbereitung des ersten Tags in Worms (I) 223 2. Geldnot im Feldlager 228 3. Vorbereitung des ersten Wormser Tags (II) 237 4. Instruktionen des Königs und des Bischofs von Münster 239 5. Weitere fürstliche Instruktionen 245 6. Vorbereitungen im fränkischen Reichskreis 253 7. Vorbereitungen im schwäbischen Reichskreis 257 VII. Der erste Tag zu Worms Verlauf und Ergebnisse 265 1. Die Quellenlage 265 2. Ankunft der Botschaften und separate Beratungen 267 3. Werbungen des Königs und des Bischofs von Münster 275 4. Der Beginn der Beratungen 278 5. Die Arbeit des Ausschusses und weitere Debatten 283 6. Anhaltender Widerstand der Reichsstädte 288 7. Diskussion weiterer Fragen 294 8. Letzte Beratung des Abschieds 299 9. Der Abschied und weitere Dokumente 304 VIII. Nach dem ersten Wormser Tag Probleme bei der Umsetzung der Beschlüsse 314 1. Die Lage in Münster und der anhaltende »Wortkrieg« 314 2. Der Geldmangel im Feldlager 320 3. Die Aufbringung der beharrlichen Hilfe 324 4. König Ferdinand und die Wormser Beschlüsse 330 5. Die Situation im Feldlager und in Münster 335 6. Probleme eines Legeorts – das Beispiel Nürnberg (I) 341 7. Die Einladung zum zweiten Tag in Worms 346 8. Letzte Vorbereitungen auf den zweiten Wormser Tag 350 IX. Die Eroberung Münsters und die Folgen Die Verbreitung der Nachricht und der zweite Tag in Worms 354 1. Die Nachricht von der Eroberung der Stadt 354 2. Probleme eines Legeorts – das Beispiel Nürnberg (II) 361 3. Die künftige Ordnung für die Stadt Münster 364 4. Vorbereitung des zweitenWormser Tags – Hessen und Kursachsen 367 5. Vorbereitungen weiterer Reichsstände 371 6. Die zweite reichsständische Versammlung in Worms 375 7. Der Beginn der Beratungen 377 8. Die Werbung des Stifts Münster und die Repliken der Reichsstände 381 9. Der Abschied des zweitenWormser Tags 384 X. Debatten über die zukünftige Ordnung für Münster Die dritte Zusammenkunft in Worms 388 1. Die Situation nach dem zweitenWormser Tag 388 2. Befürchtung neuer Täuferunruhen 390 3. Einladung zum dritten Wormser Tag 394 4. Instruktionen für die Beratungen 396 5. Die dritte reichsständische Versammlung in Worms 403 6. Debatten über die zukünftige Ordnung für Münster 410 7. Der Abschied des dritten Wormser Tags 417 XI. Eine neue Ordnung für Münster Die Eigenmächtigkeit des Bischofs 420 1. Nach dem dritten Wormser Tag 420 2. Reaktionen des Bischofs von Münster auf den Abschied 424 3. Das Ringen um eine Ordnung für die Stadt Münster 427 4. Der Tag zu Münster 432 5. Die letzten Aktionen und die Kosten der Belagerung 441 XII. Reichsstände versus Täuferherrschaft Rückblick auf den Konflikt 449 1. Die Täuferherrschaft und ihre Gegner 450 2. Der Beginn der Belagerung 452 3. Neuorientierung nach den misslungenen Angriffen 454 4. Das Projekt eines Reichstags 455 5. Die reichsständischen Versammlungen in Koblenz und Worms 458 6. Die neue Situation nach der Eroberung Münsters 460 7. Information und Kommunikation 461 8. Probleme bei der Umsetzung der Beschlüsse 463 9. Krieg, »Wortkrieg« und Diplomatie 464 10. Differierende Interessen 467 11. Warum konnten die Täufer in Münster sich so lange behaupten? 468 Chronologische Übersicht 471 Abkürzungsverzeichnis 476 Quellen- und Literaturverzeichnis 477 Register 497 Vorwort Als ich in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts im Staatsarchiv Nürnberg arbeitete, fand ich – mehr zufällig, als gezielt gesucht – Akten zur Geschichte der Täuferherrschaft in Münster. Die Frage lag nahe: Warum werden in der von Westfalen weit entfernt gelegenen Reichsstadt in Franken Quellen zu dem Thema verwahrt? Eine Antwort war schnell gefunden, denn als die Reichsstände im April 1535 in Worms tagten und eine Hilfe vereinbarten, um den Bischof von Münster bei der Belagerung der Stadt finanziell zu unterstützen, wurde – neben Frankfurt, Köln und Koblenz – Nürnberg als Legeort benannt, an dem die Gelder von den Reichsständen eingezahlt werden sollten. Seitdem war mein Interesse an dem Thema geweckt, und ich war neugierig geworden, ob in weiteren Archiven Akten zu finden sind, die Auskunft über die reichspolitische Dimension des Konflikts um Münster geben. Bislang stützten sich Publikationen, die diesen Aspekt berücksichtigten, vornehmlich auf die Bestände der Archive in Münster, Düsseldorf und Marburg. Nicht absehen konnte ich allerdings, wie aufwändig (und manchmal auch abenteuerlich) unter den Bedingungen der deutschen Zweistaatlichkeit die Archivarbeit werden würde. Die Archive in der DDR aufzusuchen, war kein Problem, und die erforderlichen Reisen finanzierte meine damalige Arbeitsstätte, die Humboldt-Universität zu Berlin. Den Aufenthalt in Wien ermöglichte ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Aber die meisten interessierenden Archive befanden sich in den alten Bundesländern. Auch bei diesen Reisen wurde ich von der Humboldt- Universität unterstützt, so dass ich die Bestände in Bamberg, Düsseldorf, Köln, München, Münster, Nürnberg und Würzburg und mit Hilfe eines zweiten Stipendiums des DAAD die Akten in Marburg einsehen konnte. Für weitere Archivbesuche nutzte ich gelegentlich die Teilnahme an Tagungen, indem ich den Aufenthalt um wenige Tage verlängerte, wenn das bescheidene Reisebudget es erlaubte. Selbst ein geübter Leser von Handschriften des 16. Jahrhunderts ist nicht in der Lage, in einer begrenzten Zeit alles zu notieren, was für die Erarbeitung einer Darstellung von Bedeutung sein kann. Er ist also von Kopien abhängig. Wollte ich solche erwerben, kam nur die Bezahlung am jeweiligen Arbeitsort infrage, und ich konnte immer mit dem Verständnis der Mitarbeiter für meine Situation rechnen. War es nicht möglich, Kopien oder Mikrofilme während meines Aufenthalts im Archiv in Empfang zu nehmen, wurden sie auf meine Bitte an die Staatliche Archivverwaltung der DDR in Potsdam geschickt und von dort an mich weitergeleitet. Auch in dieser Hinsicht haben die Mitarbeiter der Archive mich unterstützt. Schließlich habe ich einigen Kollegen zu danken, die Materialien für mich in Empfang nahmen und mir bei späterer Gelegenheit übergaben. Diese Umstände erklären nicht zuletzt, warum es so lange Zeit brauchte, ehe ich mit der Erarbeitung der Darstellung beginnen konnte. Hinzu kam, dass – angesichts meiner Verpflichtungen als Hochschullehrer (die Möglichkeit des Freisemesters gab es in der DDR nicht) –, die Zeit begrenzt war, um das umfangreiche Material zu sichten. Mit und nach der Wende von 1989/90 traten zudem andere Probleme in den Vordergrund. So sind einige Jahrzehnte vergangen, ehe ich die Arbeit endlich abschließen kann. Ich beanspruche nicht, eine in jeder Hinsicht neue Darstellung über die Dimensionen des Konflikts um die Täuferherrschaft in Münster vorzulegen. Einige Untersuchungen haben sich dem Thema bereits in der Vergangenheit zugewandt. Ich nenne exemplarisch nur die knappe, aber anregende Studie von Ludwig Keller von 1880 oder die bahnbrechende Untersuchung von Karl-Heinz Kirchhoff über die Belagerung und Eroberung Münsters von 1962. Doch die Akten bisher nicht berücksichtigter Archive ermöglichen es, das bisherige Bild zu vervollständigen und zu vertiefen, so dass die Konturen der reichspolitischen Dimension des Konflikts in politischer, religiös- konfessioneller und militärischer Hinsicht sich deutlicher abzeichnen. Um ein repräsentatives Bild zu gewinnen, wurden vor allem die Akten des Wiener Hofs und des Mainzer Erzkanzlers, von Kurfürsten (vor allem Kurköln und Kursachsen), weltlicher (Hessen, Sachsen, Kleve) und geistlicher Fürsten (Bamberg, Würzburg) sowie einiger Reichsstädte (Frankfurt, Köln, Nürnberg, Ulm) eingesehen. Die Schwierigkeit bestand zunächst darin, die ursprünglichen Zusammenhänge herzustellen, denn die einzelnen Dokumente sind an verschiedenen Standorten überliefert. Meine Darstellung beabsichtigt, den chronologischen Ablauf möglichst im Detail zu rekonstruieren. Damit setze ich mich vielleicht dem Vorwurf aus, das Faktische zu stark zu betonen. Dem halte ich entgegen: Historische Prozesse erschließen sich nur mittels des Faktischen, und gravierende Tendenzen können nur aus der Summe der Fakten erschlossen werden. Die Geschichtserzählung ist insofern nicht Konstruktion, sondern Ergebnis der Suche nach dem möglichst realen Bild. Nur ein Beispiel: Hinsichtlich der reichsständischen Zusammenkünfte der Jahre 1534/35 beschränken sich Darstellungen bisher zumeist darauf, die Fragen zu benennen, mit denen sie sich beschäftigten, und auf die Abschiede zu verweisen, die das Ergebnis der Verhandlungen dokumentieren. Doch zahlreiche Korrespondenzen, protokollarische Aufzeichnungen und andere Dokumente, die von der Forschung bisher nicht oder kaum berücksichtigt wurden, ermöglichen es, die Vorbereitung und den Verlauf von Verhandlungen detailliert zu verfolgen, so dass Interessenlage, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung nachvollzogen werden können. Gleiches gilt für die anhaltenden Bemühungen, den Mangel an Geld, das zur Finanzierung der Belagerung Münsters nötig war, zu beheben. Deshalb wird in der Darstellung manches bewusst wiederholt, um deutlich zu machen, dass dies für die Belagerer ein Dauerthema war. Ermöglicht werden so Einblicke in den Alltag und die Arbeitsweise der damaligen Akteure. Ein Wort ist zum Umgang mit den Quellen erforderlich. Zum einen beabsichtigte ich ursprünglich, die Darstellung durch einen Quellenband zu ergänzen, weil zahlreiche aufschlussreiche Dokumente bisher nicht ediert wurden. Aus Altersgründen habe ich aber inzwischen davon Abstand genommen, eine solche Edition zu erarbeiten. Deshalb gebe ich – gleichsam als Ersatz – den Inhalt vieler Dokumente ausführlicher wieder. Zum anderen zitiere ich Texte häufig im Original, weil die Sprache viel über das Denken der Menschen dieser Zeit aussagt. Archivalische Quellen werden normalisiert, indem die Konsonantendopplungen getilgt, die Großschreibung nur bei geographischen Bezeichnungen beibehalten und die Zeichensetzung modernisiert wird. Auch werden in den Anmerkungen oftmals mehrere Standorte nachgewiesen, weil es ein Hinweis ist, in welchem Maß ein Austausch an Informationen erfolgte. Auf Quellen und Literatur wird in gekürzter Form verwiesen. Die vollständigen Titel finden sich im Quellen- und Literaturverzeichnis. Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. Thomas Kaufmann, Vorsitzender des Vereins für Reformationsgeschichte, und Frau Prof. Dr. Irene Dingel, Herausgeberin der ›Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte‹, für die Aufnahme meiner Untersuchung in diese Schriftenreihe. Dem Mennonitischen Geschichtsverein danke ich für einen finanziellen Beitrag zu den Druckkosten. Erkner, am 25. März 2013 Günter Vogler |
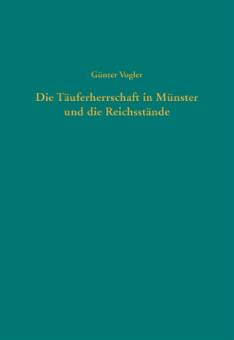
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen