|
|
|
Umschlagtext
Diese Arbeit untersucht quellennah die Erziehung schwieriger Kinder im Rauhen Haus in Hamburg durch Johann Heinrich Wichern. Zugleich werden die pädagogischen und theologischen Grundlagen der Pädagogik Wicherns aufgearbeitet. Der als Theologe und Gründer der Inneren Mission bekannte Wichern muß mindestens gleichermaßen als Pädagoge gesehen werden, der eine für seine Zeit ungewöhnlich freiheitliche und moderne Erziehung praktizierte.
Mit dieser Arbeit werden erstmals Wicherns verstreute pädagogische Schriften systematisiert und teilweise „ übersetzt", um sie dem heutigen Leser zugänglich zu machen. Hinsichtlich seiner Theorie der Erziehung muß er als Schüler Schleiermachers verstanden werden. Damit setzt er die eigentlich pädagogische Tradition in der Erziehung schwieriger Kinder fort, die diesen Kindern nicht nur mit Strafen und Einschränkungen, sondern mit Unterstützung und der Öffnung alternativer Lebensperspektiven begegnet. Interessant ist auch der Blick darauf, daß einige Elemente seiner Erziehung heute noch praktiziert werden, während andere Elemente aus der täglichem Praxis verschwunden sind. Dr. Bettina Lindmeier, geboren 1967, ist Sonderpädagogin (M.A.) und in einem Forschungsprojekt zur Enthospitalisierung geistig behinderter Menschen.aus den psychiatrischen Kliniken in Bayern an der Universität Würzburg beschäftigt. Rezension
Johann Hinrich Wichern ist nicht nur der Gründer des "Rauhen Hauses" in Hamburg, er ist auch einer der Gründungsväter evangelischer Diakonie im 19. Jhdt. und damit einer Neuausrichtung der (praktischen) Theologie angesichts der aufkommenden Industrialisierung und ihrer erheblichen Verwahrlosungsfolgen, von denen insbesondere auch Kinder und Jugendliche betroffen waren, derer sich Wichern in besonderer Weise annimmt und im "Rauhen Haus" ein eigenständiges Konzept zur Erziehung schwieriger Kinder entwickelt. Dieses Buch setzt sich Quellen-orientiert umfassend mit der Pädagogik des Rauhen Hauses und Johann Hinrich Wicherns auseinander.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Geleitwort 11
1. Einleitung13 I. Stand der Forschung und methodologische Überlegungen17 2. Quellen17 2.2 Die Jahresberichte18 2.3 Weitere Quellen 22 3. Sekundärliteratur 23 3.1 Biographische Darstellungen zur Person Wicherns25 3.2 Darstellungen zum Rauhen Haus oder zu pädagogischen Fragen 26 3.3 Kritik an Wichern28 4. Historiographie 30 4.1 Neuere Entwicklung der pädagogischen Historiographie30 4.2 Schwerpunkte sonder- und sozialpädagogischer Historiographie 34 4.2.1 Institutionengeschichtlicher Zugang36 4.2.2 Periodisierung 37 4.3 Geschichtsdarstellungen in der Sonder- und Sozialpädagogik39 4.3.1 Pädagogik als Eingliederungshilfe39 4.3.2 Sozioökonomische Positionen43 4.3.3 Einzelne weitere Deutungen 48 II. Formen und Gründe außerfamiliärer Erziehung55 5. Geschichte des Umgangs mit fürsorgebedürftigen Kindern55 5.1 Waisenerziehung55 5.2 Rettungshausbewegung 59 6. Die zeitgeschichtliche Situation 66 6.1 Der Verfall bisher gültiger Lebensformen66 6.2 Verwahrlosung69 6.3 Typische Formen des Engagements73 III. Das Erziehungskonzept Wicherns74 7. Die Entstehung der Pädagogik Wicherns 74 7.1 Leben und Werk Wicherns74 7.2 Der Einfluß Schleiermachers 82 7.2.1 Die Bedeutung der Familie bei Schleiermacher und Wichern84 7.2.2 Schleiermachers und Wicherns Pädagogik im Vergleich 87 8. Wicherns Konzept einer 'rettenden Erziehung'100 8.1 Ausgangsbedingungen 100 8.1.1 Erziehung und Rettung 101 8.1.2 'Die Ursachen der so vielfach erfolglosen Bemühungen in der heutigenKindererziehung'102 8.1.3 Standortbestimmung der Rettungshäuser innerhalb der pädagogischen Einrichtungen 108 8.2 Christliche Erziehung 109 8.2.1 Reich Gottes109 8.2.2 'Gut' und 'böse' als menschliche Kräfte! 11 8.2.3 Das Verhältnis zwischen Erzieher und 'sittlich entartetem' Kind l 14 8.2.4 Freiheit und Zwang115 8.2.5 Vermittlung des christlichen Glaubens117 8.2.6 Entscheidung zwischen zwei Lebensformen 119 8.3 'Neues Leben' als Grundkategorie von Wicherns Erziehung 120 8.3.1 Neubeginn121 8.3.2 Festigung des neuen Lebens124 8.3.3 Das 'Böse' als Macht, mit der die Erziehung zurechnen hat 134 8.3.4 Vermittlung mit dem 'alten Leben' und Vorbereitung auf die Zukunft139 IV. Klientel und Organisation des Rauben Hauses 142 9. Die Hintergründe der Aufnahme von Kindern in das Rauhe Haus 142 9.1 Familienzerrüttung als Grund der Verwahrlosung142 9.2 Unterbringungsmöglichkeiten für verwahrloste Kinder 145 9.3 Eigenschaften der aufgenommenen Kinder 147 10. Die äußere Organisation des Rauhen Hauses 153 10.1 Die sozial-räumlichen Bedingungen des Rauhen Hauses155 10.2 Wohnen158 10.3 Tagesablauf162 10.4 Lebensstil und Ernährung 165 10.5 Noviziat und Gruppenbildung 172 10.6 Ausdehnung der Einrichtung 178 V. Das Familienprinzip als Orientierungsprinzip 181 11. Familienleben 185 12. Arbeit188 12.1 Die Arbeit als Teil des menschlichen Lebens188 12.1.1 'Gesegnete Armut' und 'schamlose Armut'189 12.1.2 Verdienst und Arbeit192 12.1.3 Einschätzung des Wandels in der Arbeitswelt194 12.2 Erziehung zur Arbeit195 12.2.1 Arbeit in Rettungshäusern 197 12.2.2 Arbeit als Erziehungsmittel200 12.2.3 Häusliche Arbeit 201 12.2.4 Werkstättenarbeit 202 12.2.5 Fleiß 207 12.3 Buchdruckerei und -binderei210 12.3.1 Druckerei210 12.3.2 Agentur und Buchbinderei214 13. Schule 215 13.1 Erziehung undUnterricht216 13.2 Organisation des Unterrichts in den ersten Jahren218 13.3 Didaktische Prinzipien222 13.4 Bibliothek226 13.5 Pensionat228 13.6 Lehrerseminar 229 14. Freizeit231 14.1 Die Bedeutung des Spiels 234 14.2 Einzelne Spiele und Beschäftigungen236 14.3 Geselligkeit 238 14.4 Weihnachten und andere Feste239 14.5 Gegenseitige Erziehung 242 15. Religiöse Erziehung243 15.1 Grundsätze der religiösen Erziehung 243 15.2 Andacht245 15.3 Sonntagsfeier247 15.4 Religiöser Unterricht248 15.5 Seelsorge durch die Hauseltern251 15.6 Wicherns Umgang mit den Kindern 253 VI. Weitergehende Betreuung 256 16. Elternarbeit 256 16.1 Die Aufnahme der Kinder256 16.2 Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern258 16.3 Die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kindern260 16.4 Die Vermittlung zwischen Eltern und Kindern durch die Rettungsanstalt261 16.4.1 Aufnahmekontrakt 261 16.4.2 Besuche in den Familien262 16.4.3 Erziehungsberatung265 17. Entlassung und weitere Fürsorge267 17.1 Berufsbildung269 17.2 Fürsorge 274 17.2.1 Die Fürsorge während der Lehrzeit274 17.2.2 Weitergehende Fürsorge 277 17.3 Schwierigkeiten der Berufsbildung278 17.3.1 Die Situation der Handwerker278 17.3.2 Besondere Erschwernisse281 17.3.3 Auswanderung 289 18. Erziehungserfolg291 18.1 Erfolg der Berufsbildung für die Lebensbewährung292 18.2 Sozialstatistische Daten 294 18.3 Die Aufrechterhaltung des Kontaktes298 VII. Weitergehende Aspekte des Erziehungskonzepts Wicherns 305 19. Brüder 305 19.1 'Gehilfeninstitut' oder 'Brüderanstalt' 306 19.2 Ziele und Aufgaben der Brüderanstalt 308 19.3 Der Beginn der Brüderausbildung312 19.4 Die Durchsetzung der Brüderanstalt319 19.5 Die Weiterentwicklung der Brüderanstalt325 19.5.1 Die Aufnahmebedingungen und der Unterricht der Brüder325 19.5.2 Die Gliederung in Konvikte329 19.5.3 Der Eintritt ins Raube Haus 331 19.5.4 Die Aufsicht333 19.5.5 Die Konferenzen336 20. Mädchenerziehung339 20.1 Die gesellschaftliche Stellung und die Aufgaben der Frau340 20.2 Weibliche Jugendliche und Frauen der Unterschicht346 20.2.1 Erwerbstätigkeit 346 20.2.2 Ehe, 'wilde Ehen' und nichteheliche Mutterschaft 349 20.2.3 Berufsbildung353 20.3 Mädchenerziehung im Rauhen Haus 355 20.3.1 Erziehungsprobleme und -erfolge bei den Mädchen 356 20.3.2 Die Beschäftigung der Mädchen360 20.3.3 Ausbildung, Entlassung und Selbständigkeit,362 20.3.4 Die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen im Rauhen Haus369 20.3.5 Kriterien für die Aufnahme,371 20.3.6 Die Mitarbeiterinnen374 21. Sozialpolitische Vorschläge zur Lösung der sozialen Frage 376 21.1 Die Entwicklung der Armenhilfe377 21.1.1 Die geschichtliche Entwicklung der Armenfürsorge bis zur Gegenwart377 21.1.2 Die Lösung der 'Armenfrage' 380 21.1.3 Ansätze zur Selbsthilfe 385 21.2 Neue Siedlungs- und Wohnformen - Wicherns Antwort auf die 'Armenfrage' 387 21.2.1 Die Wohnsituation in Rettungshäusern 387 21.2.2 Die Wohnungsnot der 'kleinen Leute' 388 21.2.3 Die Lösung der Wohnungsnot durch sozialen Wohnungsbau391 21.2.4 Der Bürgerhof 392 21.2.5 Die weitere Entwicklung der Wohnungsnot399 22. Schluß402 Bibliographie 412 Anhang 436 |
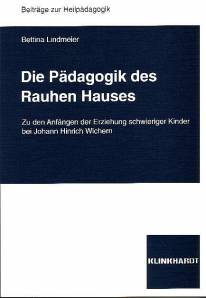
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen