|
|
|
Umschlagtext
Als Mitglied des Synodalen Weges (Forum Sexualität) hat Eberhard Schockenhoff sich bis zu seinem Tod intensiv dafür eingesetzt, das Denken über Sexualität weg vom moralischen Zeigefinger hin zu einer Kunst des Liebens zu führen. In seinem letzten großen Werk, das er selbst noch vollenden konnte, zeigt er den Weg zu einer neuen Sexual- und Beziehungsethik auf.
Ausgehend von wissenschaftlichen Betrachtungsweisen von Liebe und Sexualität in der Moderne zeichnet er entscheidende Wegmarken der kirchlichen Sexualmoral nach. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich und wandelbar die Sicht auf Liebe und Sexualität sein kann. Unter Einbeziehung der biblischen Perspektiven und im Diskurs mit modernen Humanwissenschaften stellt er die kirchliche Sexualmoral auf den Prüfstand und legt einen Entwurf vor, der der heutigen Lebenswelt moderner Menschen entspricht und gleichzeitig aus der Tradition der Kirche schöpft. Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe, 1953-2020, Dr. theol., war Professor für Moraltheologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2001-2016 Mitglied des Deutschen Ethikrats, seit 2009 ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, seit 2010 Mitglied in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Rezension
Sex, Liebe und Partnerschaft gehören bis heute zu den heiß diskutierten Themen in Kirche und Gesellschaft. Diese Sexualethik des 2020 verstorbenen, Freiburger katholischen Moraltheologen Eberhard Schockenhoff (1953-2020) stellt unter Einbeziehung der biblischen Perspektiven und im Diskurs mit modernen Humanwissenschaften die kirchliche Sexualmoral auf den Prüfstand und legt einen Entwurf vor, der der heutigen Lebenswelt moderner Menschen entspricht und gleichzeitig aus der Tradition der Kirche schöpft. Das Buch zeigt einen Weg zu einer neuen Sexual- und Beziehungsethik in der katholischen Kirche auf. Der Autor hat sich als Mitglied des Synodalen Weges (Forum Sexualität) bis zuletzt intensiv dafür eingesetzt, das Denken über Sexualität weg vom moralischen Zeigefinger hin zu einer Kunst des Liebens zu führen. Wie Papst Franziskus geht es Eberhard Schockenhoff darum, eine neue Sicht auf Sexualität und unterschiedliche Beziehungsformen einzunehmen und diese nicht von vornherein als sündhaft oder makelbehaftet einzuordnen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
TEIL I Liebe und Sexualität in der Moderne 13 1. Einleitung: Wie sich das Denken über Sexualität veränderte 13 2. Die psychoanalytisch-gesellschaftskritische Sexualtheorie von Herbert Marcuse und Wilhelm Reich 22 3. Der Beitrag der Kulturanthropologie und der Sozialwissenschaften (Margaret Mead, Ruth Benedict, Arnold Gehlen, Helmut Schelsky sowie Nena und George O’Neill) 31 4. Zur Entspannung und zum Zeitvertreib: Die rationalistische Sexualmoral von Bertrand Russell und Alex Comfort 37 5. Die prinzipielle Infragestellung der Ehe und das Ideal der freien Liebe (Herrad Schenk, Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim) 43 6. Die Entdramatisierung der Sexualität und das Entstehen einer neuen Verhandlungsmoral (Gunter Schmidt, Volkmar Sigusch und Martin Dannecker) 47 7. Der gegenwärtige Strukturwandel der Sexualität 53 7.1 Die gestärkte Rolle der Frauen 53 7.2 Die größere Vielfalt des sexuellen Begehrens und die veränderte Wahrnehmung nicht-heterosexueller Lebenswelten 55 7.3 Der neue Reiz an self-sex-Praktiken 59 7.4 Abschied vom Körper (Cyber-Sex, Telefon-Sex, Pornografie, Sexroboter) 62 8. Rückblick auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte 69 TEIL II Historische Rückfragen und genealogische Tiefenbohrungen: Die Entstehung der Kirchlichen Sexualmoral in der Patristik 73 1. Die Notwendigkeit einer historisch-genetischen Betrachtungsweise 73 2. Geoffenbarte Lehre oder Leerstelle? Sparsame Andeutungen in der Verkündigung Jesu 75 3. Die Aufnahme stoischer Anschauungen in die kirchliche Verkündigung bei Clemens von Alexandrien 82 3.1 Die Offenbarung des göttlichen Logos als Vollendung der wahren Philosophie 83 3.2 Vernünftige Lebensregeln für die Gestaltung des Alltags 85 3.3 Die zweckmäßige Einrichtung der Natur und die Weisungen der Vernunft 87 3.4 Der naturgemäße Gebrauch der Sexualität zum Zweck des Kinderzeugens 89 3.5 Vernunftwidriges Begehren und illegitime Sexualpraktiken 91 3.6 Ratschläge zur Reduzierung sexueller Aktivitäten 94 3.7 Das Ideal einer leidenschaftslosen Ehe 96 3.8 Erste Zwischenbilanz 100 4. Das zwiespältige Erbe des Augustinus 101 4.1 Zeugung ohne Sex? Verwegene Spekulationen über die Paradiesehe 102 4.2 Die Leiden des jungen Augustinus und ihre literarische Mitteilung 106 4.3 Ein neuer Fluch: Die Übertragung der Erbsünde 115 4.4 Die Ehegüter als Ausgleichswerte für das Übel der sexuellen Begierde 119 4.5 Schlagseite zum Rigorismus? 123 4.6 Zweite Zwischenbilanz 124 5. Die Rezeption der aristotelischen Naturphilosophie im Hochmittelalter 127 5.1 Neue Bewertung der sexuellen Lust 128 5.2 Überwindung der augustinischen Exkusationstheorie 132 5.3 Die Gebote der materialen Sexualethik 135 5.4 Dritte Zwischenbilanz 139 6. Verschärfungen in der frühen Neuzeit 143 6.1 Die Kontroverse um den Probabilismus 143 6.2 Erotik außerhalb der Ehe – alles Todsünde? 145 6.3 Der Widerspruch gegen den Rigorismus 152 6.4 Sexualität in der Ehe – mindestens eine lässliche Sünde? 153 6.5 Vierte Zwischenbilanz 156 TEIL III Der lange Weg zur Erneuerung 159 1. Theologische Aufbrüche und Suchbewegungen vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil 159 1.1 Ein Dokument der Hochschätzung ehelicher Liebe: der Catechismus romanus 159 1.2 Der Eigenwert der Ehe in der Theologie des 19. Jahrhunderts 161 1.3 Der Eigenwert der Ehe als „zweieiniger“ Lebensgemeinschaft 163 1.4 Der objektive Sinngehalt der sexuellen Vereinigung 169 1.5 Revision der Ehezwecklehre? 171 1.6 Fehlformen des Sexualverhaltens 173 1.7 Fünfte Zwischenbilanz 175 2. Eine neue Sichtweise von Ehe, Liebe und Sexualität: Das Zweite Vatikanische Konzil 177 2.1 Die Abkehr von der traditionellen Ehezwecklehre 177 2.2 Die Ehe als Bund: Der Abschied vom Vertragsmodell 182 2.3 Die Bedeutung der Sexualität als Ausdruck und Förderung der ehelichen Liebe 188 2.4 Kontroversen um die Rede von der verantworteten Elternschaft 193 2.5 Sechste Zwischenbilanz 197 3. Ein Schritt zurück: die Enzyklika Humanae vitae und die nachkonziliare Entwicklung 200 3.1 Wiederkehr der Ehezwecklehre? 201 3.2 Die mögliche Zeugungsoffenheit jedes einzelnen ehelichen Aktes 203 a. Ein neues Prinzip: Die unlösbare Verknüpfung der beiden Bedeutungen der Sexualität 205 b. Das Verhältnis von Person und Natur 206 c. Vermutete negative Folgen einer Änderung der bisherigen Norm 208 d. Die formale Autorität des Lehramtes als Interpret des sittlichen Naturgesetzes 208 e. Die Trageweite des kirchlichen Traditionsprinzips 209 3.3 Die personalistische „Vertiefung“ der Lehre von Humanae vitae durch Papst Johannes Paul II 211 3.4 Ein Blick nach vorn: Das nachsynodale Apostolische Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus 223 a. Die Warnung vor einem falschen Idealbild der Ehe 223 b. Größere Wertschätzung gegenüber der Eigenständigkeit des Gewissens 224 c. Implizite lehrmäßige Korrekturen durch den Verzicht auf bisherige Verurteilungen 225 d. Ein unbefangener Blick auf das sexuelle Begehren 229 3.5 Siebte Zwischenbilanz 230 4. Der Glaubwürdigkeitsverlust der kirchlichen Sexualmoral 234 TEIL IV Bedeutungsdimensionen der menschlichen Sexualität 241 1. Das Verhältnis von Empirie und Ethik: Zur Rolle der Humanwissenschaften 243 2. Auskünfte der modernen Biologie 247 2.1 Sexualität als Anreiz zur Fortpflanzung? 247 2.2 Geschlechterkooperation und Rivalität der Geschlechter 251 2.3 Morphologische und physiologische Besonderheiten der menschlichen Sexualität 254 3. Auskünfte der Psychoanalyse und der Sexualwissenschaft 258 3.1 Das Pathologische im Normalen: Die facettenreichen Aspekte der menschlichen Sexualität 259 3.2 Die Entdeckung der infantilen Sexualität 266 3.3 Die Reorganisation der Sexualität nach der Pubertät und ihre Entwicklung beim erwachsenen Menschen 268 3.4 Abschied von der Triebtheorie? 273 3.5 Sexualität als seelische Konfliktbewältigungsstrategie 276 3.6 Sexuelle Erregung als Feindseligkeit und Triumph 279 3.7 Sexuelles Erleben als Wiedererinnerung an frühkindliche Geborgenheit und Nähe 281 3.8 Sexualität als Ressource 283 4. Auskünfte der Sozialwissenschaften und der Kulturanthropologie 286 4.1 Der Übergang von der Natur- zur Kulturgeschichte 287 4.2 Das Bedürfnis nach Intimität und Geborgenheit 288 4.3 Die Erfahrung der Bedeutsamkeit der eigenen Existenz im sexuellen Begehrtwerden durch den anderen 292 4.4 Die Ausschließlichkeit und Dauerhaftigkeit der Liebe 296 4.5 Der Schmerz der Liebe und die Verlockung des Dritten 297 4.6 Die kulturellen Rahmenbedingungen der Wahl und ihr Einfluss auf das Partnerschaftsverhalten 300 5. Ergebnis: Die Sinndimensionen der Sexualität 306 TEIL V Biblische Perspektiven und ethische Prinzipien der Sexualmoral 314 1. Das Bild-Gottes-Sein des Menschen und seine unverlierbare Würde 315 2. Die Bedeutung der leib-seelischen Einheit des Menschen 318 3. Die menschliche Zweigeschlechtlichkeit als anthropologisches Grundmuster des Menschseins 323 3.1 Der priesterschriftliche Bericht von der Erschaffung des Menschen: Gen 1,26 –27 323 3.2 Die jahwistische Erzählung von der Erschaffung des Menschen: Gen 2,7.18–24 327 3.3 „Nicht mehr männlich noch weiblich“ (Gal 3,28) – Überwindung der Geschlechterdifferenz? 332 4. Der unvoreingenommene Blick auf Sexualität und Eros 336 5. Das hermeneutische Problem gegenwartsbezogener Auslegungen 341 TEIL VI Sexualmoral auf dem Prüfstand: Lebenskreise und Lebensräume der Liebe 348 1. Sexualität als Sprache der Liebe 348 1.1 Die existenzielle Dimension der Sexualität 349 1.2 Das Junktim von Sexualität, Partnerschaft und Liebe 351 1.3 Die ekstatische Struktur des sexuellen Begehrens 355 1.4 Der Triebcharakter der Sexualität: Konkupiszenz oder heiliger Eros? 358 1.5 Nochmals: Das sexuelle Begehren und die Gutheißung des anderen durch die Liebe 362 2. Die Ehe als verbindliche Lebensform der Liebe 365 2.1 Das kirchliche Leitbild der Ehe in einem veränderten gesellschaftlichen Umfeld 367 2.2 Die Funktion der institutionellen Lebensform „Ehe“ für das Gelingen der Liebe 375 2.3 Die Bedeutung des Eheversprechens 382 2.4 Das Verständnis der ehelichen Treue 387 2.5 Die Ehe als Sakrament 402 2.6 Ehe als Berufung 411 2.7 Das Verhältnis von Ehe und Ehelosigkeit 413 3. Die Familie als Lebensraum der Liebe 422 3.1 Die differenzierte Zuordnung von Ehe und Familie 423 3.2 Die innere Hinordnung der Ehe auf die Zeugung und Erziehung von Kindern 426 3.3 Vom Naturereignis zur bewussten Entscheidung: der Wandel der Bedeutung von Elternschaft 429 3.4 Verantwortete Elternschaft und das Ethos der Selbstbestimmung 431 3.5 Empirische Erkenntnisse zu Familiengründung und gewollter Kinderlosigkeit 436 3.6 Die gesellschaftliche Akzeptanz gewollter Kinderlosigkeit 441 3.7 Plädoyer für das Leitbild der ehebezogenen Familie 444 3.8 Der soziale Eigenwert der Familie 449 3.9 Das sozialethische Ziel: Gerechtigkeit für Familien 452 3.10 Ansätze zu einer Theologie der Familie 457 Anhang TEIL VII Konkrete Problemfelder: 1. Voreheliche Lebensgemeinschaften 466 Sachregister 475 Namenregister 480 Dank 484 |
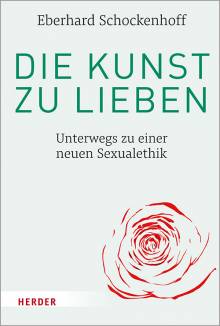
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen