|
|
|
Umschlagtext
- Anleitungen für Textanalysen, Erörterungen, Textinterpretationen und Gestaltungsaufgaben im weiten Spektrum der Schulprufungen.
- Textbeispiele aus Literatur und Alltag, Kreativitätstechniken und methodische Verfahren. - Hauptströmungen und -themen aus fünf Jahrhunderten deutscher Literaturgeschichte. Rezension
Das Lern- und Arbeitsbuch „Deutsch für die berufliche Oberstufe“ richtet sich vor allem an Schüler der Berufsoberschule, der Fachoberschule und des beruflichen Gymnasiums. Es handelt sich um ein sehr anschauliches Praxisbuch mit vielen Beispieltexten und einer detaillierten und klaren Darstellung der Themenbereiche, die daher von den Lernenden gut eigenständig erarbeitet werden können. Die Schwerpunktthemen sind: Textanalyse, literarische und textgestützte Erörterung, Arbeits- und Lerntechniken, Facharbeit und -referat, Gesprächsformen, Sprachgebrauch, kreatives Schreiben und Themen aus dem Bereich der Literatur. Sehr hilfreich zum Aneignen der Themen sind die Kreativitätstechniken und Methoden, die aber auch für den Lehrenden vielfältige Anregungen bieten. Sehr gut geeignet für den Unterricht in der beruflichen Schule ist die Darstellung und Vermittlung situationsangemessenem sprachlichen Handelns in Schule, Beruf und Freizeit oder in den Medien. Auch die Einführung in die deutsche Literaturgeschichte und Beispiele aus aktuellen Strömungen bieten eine gute Hinführung. Gerne empfehle ich das Praxisbuch auch für den Einsatz in der gymnasialen Oberstufe.
Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Praxisnah und handlungsorientiert, für eine detaillierte und zielgerichtete Vermittlung der für den Abschluss der beruflichen Oberstufe erforderlichen Fertigkeiten. Vorgehenshinweise und Anregungen für die Ausarbeitung von Textanalysen, Erörterungen und Textinterpretationen Übersichtliche und schrittweise Darstellung der Inhalte auf Doppelseiten Breit angelegte Auswahl an Textbeispielen aus Literatur und Alltag Zusatzinformationen und Lesehinweise als Anreiz für die weitere Auseinandersetzung mit Themen und Texten Kreativitätstechniken und methodische Verfahren Darstellung der Vielfältigkeit von Sprache und deren Verwendung in Freizeit, Beruf sowie Medien Aufarbeitung der deutschen Literaturgeschichte mit Überblick über die Hauptströmungen und -themen der letzten fünf Jahrhunderte Textauszüge und -beispiele sowie gezielte Aufgabenstellungen, um Arbeitsergebnisse in eigene Textarbeit umsetzen zu können Inhaltsverzeichnis
1 TEXTANALYSE 1
1.1 Was willst du von mir?- Die Absicht von Gebrauchstexten 2 1.2 So wird's gemacht - Hinweise zum Textverständnis 6 1.3 Meinungsbildende Texte 9 1.3.1 Besonders wichtig: die Meinung des Verfassers 10 1.3.2 Wichtige Elemente im Text leicht erkannt 11 1.3.3 Einleitung oder Antithese? 12 1.3.4 Unterschiede erkennen: Was ist ein Beweis? 13 1.3.5 Woran man eine Begründung erkennt 14 1.4 Textwiedergabe 16 1.4.1 Das Wichtigste im Überblick - die Einleitung zur Textwiedergabe 16 1.4.2 Die Inhaltsangabe schafft Überblick 18 1.4.3 Was ist wichtig?- Das Problem der Konzentration 19 1.4.4 Inhalt und Funktion gehören zusammen - die strukturierende Textwiedergabe 20 1.4.5 Ein schneller Überblick- die Inhaltswiedergabe in Thesenform 21 Formulierungshilfen - Übersicht über strukturierende Verben 24 1.5 Texterläuterung 26 1.5.1 Was ist unklar? 26 1.5.2 Der Aufbau der Texterläuterung 28 1.6 Stellungnahme 30 1.6.1 Wie mach ich's richtig? - Methodisches Vorgehen 30 1.6.2 Das Grundkonzept der Stellungnahme 31 1.6.3 Was soll ich tun? - Die Aufgabenstellung 32 1.6.4 Aufgabenstellung und Lösungsvorschlag 32 1.6.5 Eine besondere Form der Stellungnahme - der Leserbrief 36 1.7 Absichtsanalyse 38 1.7.1 Entscheidend ist, wie man's sagt - die Rolle der Sprachform 38 1.7.2 Auf die Sprache kommt's an - die Bedeutung der Sprache 39 1.7.3 Bedeutung sprachlicher Mittel in nichtpoetischen Texten 40 1.7.4 Grundwirkungen sprachlicher Mittel 40 1.7.5 Der Weg zur Absichtsanalyse - die Vorgehensweise 41 1.7.6 Von der Analyse zur Darstellung - die Absichtsanalyse 42 1.7.7 Die Absichtsanalyse am Beispiel einer Schülerarbeit 44 1.7.8 Tipps zu möglichen Aufgabenstellungen in Prüfungen 47 Sprachanalyse - Satzfiguren 49 Sprachanalyse - Wortwahl 51 Sprachanalyse - rhetorische Mittel 52 2 DIE ERÖRTERUNG 55 2.1 Ein Thema erörtern - Vorgehen und Aufbau 56 2.1.1 Auf das Thema kommt es an -Themenwahl und Themenerfassung 56 2.1.2 Stoffsammlung und Stoffordnung 58 2.1.3 Der Bau eines Hauses beginnt mit dem Plan - die Gliederung der Gedanken 60 2.1.4 Einleitung und Schluss 62 2.1.5 Die Gestaltung des Hauptteils 64 2.1.6 Die besseren Argumente zählen - logische Argumentation 66 2.1.7 Erörterungsbeispiel: ein Schüleraufsatz 68 2.2 Auch literarische Themen kann man erörtern - Besonderheiten der literarischen Erörterung 72 2.2.1 Ohne zu gliedern geht gar nichts - die Gliederung der literarischen Erörterung 74 2.2.2 Ein Rahmen macht das Bild noch schöner - Einleitung und Schluss 76 2.2.3 Der Dichter hat das Wort - ein Auszug aus einem Originaltext 78 2.2.4 „Und wo ist Ihr Beleg?" - Die Vertextung des Hauptteils 80 2.2.5 Überblick und Themenvorschläge 82 2.3 Eine Variante - die textgestützte Erörterung 84 2.3.1 Auseinandersetzung mit dem Kommunikationspartner 84 2.3.2 Der Bezug zur Textvorlage - Klärung der Diskussionsgrundlage 86 2.3.3 Der Hauptteil - Argumentationsplan und Ausarbeitung 90 3 GEWUSST WiE - SPRACHLICH HANDELN 93 3.1 Arbeits- und Lerntechniken 94 3.1.1 Informiert sein ist alles - gezielte Informationsbeschaffung 94 3.1.2 Die Nadel im „digitalen Heuhaufen" suchen - das Internet als Informations- quelle nutzen 96 3.1.3 Effektives Lesen 98 3.1.4 Mitschreiben, Ordnen, Planen 100 3.1.5 Das Gehirn bestimmt den Rhythmus - Lernstrategien aneignen 102 3.1.6 So bestehe ich meine Prüfung - Prüfungsvorbereitung und Prüfungsverhalten 104 3.1.7 Übungen zum Trainieren 106 3.2 Die Seminar-/Facharbeit 107 3.2.1 Merkmale einer Seminar-/Facharbeit 108 3.2.2 Themen 109 3.2.3 Grundregeln für die Seminar-/Facharbeit 110 3.2.4 Die Zeitplanung - der Rahmenplan 112 3.2.5 Der Wochen- und Tagesplan 113 3.2.6 Die Bestandteile der Seminar-/ Facharbeit und ihre Anordnung 114 3.2.7 Die Bedeutung von Zitaten und die Technik des Zitierens 116 3.2.8 Quellenangabe - Literaturverzeichnis - äußere Form 118 3.3 Das Fachreferat 120 3.3.1 Die Vorbereitung eines Vortrags 120 3.3.2 Guter Vortrag - keine Kunst 122 3.3.3 Die Präsentation 124 3.4 Texte im täglichen Gebrauch 126 3.4.1 Ein Protokoll anfertigen 126 3.4.2 Immer schön der Reihe nach die Vorgangsbeschreibung 128 3.5 Gesprächsformen und -Situationen 130 3.5.1 Kommunikation 130 3.5.2 Gesprächsformen und Gesprächsführung 134 3.5.3 „Bitte die Nächste auf der Rednerliste!" - Diskussionsregeln 138 3.5.4 Wie Diskussionsbeiträge formuliert werden 140 EXKURS 3.6 Erfolgreiches Bewerben 142 3.6.1 Vollständigkeit ist Trumpf - die Bewerbungsunterlagen 142 3.6.2 Für sich selbst werben - das Bewerbungsschreiben 144 3.6.3 Der Lebenslauf 146 3.6.4 Wenn die erste Hürde genommen ist - das Vorstellungsgespräch 148 4 SPRACHE HAT VIELE GESICHTER 151 4.1 Angemessener Sprachgebrauch 152 4.1.1 Hochsprache - Umgangssprache - Jargon 152 4.1.2 wie einem der Schnabel gewachsen ist" - die Mundart 154 4.1.3 „So sprechen nur wir" - Fach- und Gruppensprachen 156 4.2 Presse, Hörfunk, Fernsehen - die Medien 158 4.2.1 Von der Gutenberg-Galaxis zum Cyberspace - 600 Jahre Medienentwicklung 158 4.2.2 Neil Postman: Wir informieren uns zu Tode - der Weg zur Informationsgesellschaft [Auszug] 160 4.2.3 Die Arbeit der Redaktion - Information ist Vertrauenssache 162 4.2.4 Nachrichten im Fernsehen: Texte - Bilder - Filme - Töne 166 4.2.5 Boulevardzeitung und Abonnementzeitung - Sensationsmache und Seriosität 170 4.2.6 Die Quote - das goldene Kalb der Medienwelt 172 4.2.7 Fernsehen ist kein Kinderspiel - Gewalt in den Medien 174 4.2.8 Der Film zieht die Zuschauer in seinen Bann 176 4.2.9 Alte Medien - neue Medien: die Medienkonkurrenz 180 5 KREATIVES SCHREIBEN 185 5.1 Träume nehmen Gestalt an - eine Fantasiereise fortsetzen 186 5.2 Ein Gedichtpuzzle herstellen 188 5.3 Selbst Gedichte schreiben 190 5.4 Sprachbilder suchen 192 6 DIE WELT DER LITERATUR 197 6.1 Poetische Texte - woran erkennt man sie? 198 6.2 Die literarischen Gattungen 200 6.2.1 Lyrik - eine Gattung der Stimmungen 202 6.2.2 Epik - eine handlungsorientierte -Gattung 206 6.2.3 Dramatik - das muss man gesehen haben 214 6.3 Streifzug durch vier Jahrhunderte Literatur 218 6.3.1 Barock 0600-1720) 218 6.3.2 Aufklärung [1720-1785] 220 6.3.3 Sturm und Drang [1765-1785] 222 6.3.4 Klassik [1786-1805] 224 6.3.5 Romantik [1790-1830] 226 6.3.6 Biedermeier, Vormärz und Junges Deutschland [1815-1850] 228 6.3.7 Realismus [1850-1890] 230 6.3.8 Naturalismus [1880-1900] 234 6.4 Literatur des 20. Jahrhunderts 236 6.4.1 Expressionismus 236 6.4.2 Weimarer Republik und Drittes Reich [1918-1945] 238 6.4.3 Nachkriegsliteratur [1945-1949] 242 6.4.4 Die Fünfziger- und Sechzigerjahre 250 6.4.5 Die Siebziger- und Achtzigerjahre 256 6.4.6 Literatur im wiedervereinigten Deutschland 264 6.4.7 Literatur am Beginn des 21. Jahrhunderts 270 7 LITERARISCHE TEXTE VERSTEHEN UND ERFASSEN 275 7.1 Dichterische Werke verstehen - die Textinterpretation 276 7.1.1 So wird's gemacht- Hinweise zum formalen Vorgehen 276 7.1.2 Die Fabel - ein Spiegel der menschlichen Gesellschaft 282 7.1.3 Die Anekdote - ein ungewöhnliches oder bemerkenswertes menschliches Verhalten darstellen 284 7.1.4 Die Kurzgeschichte - den Augenblick erzählen 286 7.1.5 Die Parabel - ein literarisches Gleichnis 296 7.1.6 Die Novelle - das Erzählen von einer „unerhörten Begebenheit" 298 7.1.7 Das geschlossene Drama 308 7.1.8 „So ein schräger Typ!" - die literarische Charakteristik 310 7.2 Lyrik - Gedichte mit Bedeutung versehen 314 7.2.1 Allgemeine Interpretationsanleitung in zwei Arbeitsphasen 314 7.2.2 Beispiel für eine Gedichtinterpretation 316 7.2.3 Zwei motivgleiche Gedichte miteinander vergleichen 320 7.2.4 Übungsbeispiele für Gedichtinterpretationen 324 7.2.5 Moderne Lyrik 338 7.3 Gestaltendes Erschließen 340 7.3.1 Gestaltendes Erschließen literarischer Texte 340 7.3.2 Gestaltendes Erschließen von Sachtexten 342 7.3.3 Gestaltungsreflexion - ein wichtiger Teil der Gestaltungsaufgabe 344 ORTHOGRAFIE UND GRAMMATIK -ANLEITUNGEN ZUM ÜBEN 346 8.1 Komma oder nicht - das ist hier die Frage! 346 8.2 Angleichung von Fremdwörtern 350 8.3 Das Prinzip der Silbentrennung 351 8.4 Die Schreibweise der [s]-Laute 352 8.5 Grundregeln für die Getrennt- und Zusammenschreibung 354 8.6 Groß- oder Kleinschreibung? 356 8.7 Bildung und Verwendung des Konjunktivs 358 Sachwortverzeichnis 360 Literaturverzeichnis 366 |
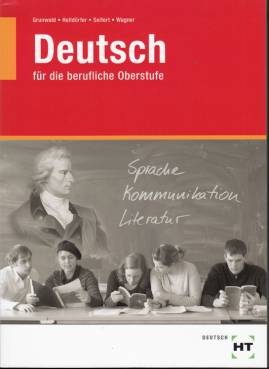
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen