|
|
|
Umschlagtext
In enger Verknüpfung von Theorie und Praxis erhält der angehende Dachdecker fundierte Kenntnisse zur Detailausbildung von An- und Abschlüssen, Kehlen, Öffnungen und Dachkanten, um sie erfolgreich anwenden zu können.
Aufbauend auf der Vermittlung von Grundkenntnissen zum Dachziegel, seiner Herstellung und seinen Handelsformen dienen eingehende Kapitel zur Dachausmittlung und Dacheinteilung dem Verständnis mathematischer Grundkenntnisse. Darauf aufbauend werden Eindecktechniken, Gratausbildung sowie Anforderungen an Wärmedämmung, Dachentwässerung und Solardächer ausführlich erläutert und durch zahlreiche Abbildungen veranschaulicht. Das Werk eignet sich als Lehrbuch für die Ausbildung ebenso wie als Nachschlagewerk für Meisterschüler. Rezension
„Details rund ums Ziegeldach“ vereint Lehr-, Übungs- und Nachschlagewerk in einem einzigen Band, der durch wertvolle didaktische Aufbereitung des Stoffes und seiner Anschaulichkeit besticht.
Grundsätzlich als Lehrbuch in der Ausbildung von Dachdeckern konzipiert leistet das vorliegende Werk jedoch mehr, es dient neben seinem ursprünglichen Zweck auch dem Zimmererlehrling und –meister sowie dem Architekten oder Bauingenieur als handliches Lehr- und Fachkompendium. Den Autoren gelingt eine gute, kontinuierliche inhaltliche Strukturierung, die zunächst historische Hintergrundinformationen zum Dach an sich und dem behandelten Werkstoff „Ton“ und seinen Produkten liefert, es schließen Kapitel mit fachtheoretischen Grundlagen zur Dachausmittlung und –einteilung, zum Dachaufbau und zur Ausbildung der einzelnen Dachkomponenten an. Abgerundet wird das Werk durch ein Kapitel über die Montage und Einbindung von Solaranlagen. Jedes Kapitel enthält neben der anschaulich dargestellten Theorie eine Reihe von ergänzenden Bildern und Schemata, die das Verständnis erleichtern, Rechenbeispiele, welche zur Vorbereitung auf die Klausur bzw. Schulaufgabe helfen und das besondere Plus des Buches: Übungsaufgaben mit Lösungen, anhand welcher der Leser sein Wissen konkret überprüfen und vertiefen kann. Ich halte dieses Buch für sehr gut geeignet in der Handwerkerausbildung aber auch in den Vertiefungsveranstaltungen des Bauingenieurwesens / Architektur. Gerade die Detaillösungen stellen interessante Anstoßpunkte und Impulsgeber für Planer und Ausführenden dar. Michael Kraus, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Grundlegendes Know-how am Ziegeldach Alles was Sie zur Ausführung von Ziegeldeckungen wissen müssen, finden Sie in diesem hervorragenden Grundlagen- und Praxiswerk vereint. Materialkundliches Wissen, Gratausbildung, Eindecktechniken sowie die Anforderungen an Wärmedämmung, Dachentwässerung und Solardächer werden praxisnah beschrieben und erläutert. Zahlreiche Abbildungen und Skizzen zeigen detailgenau wie eine perfekte Deckung am Ziegeldach ausgeführt wird. Das Werk eignet sich insbesondere als Lehrbuch für Auszubildende und gleichzeitig als griffiges Nachschlagewerk für Meisterschüler. Übungen am Ende eines jeden Kapitel mit Lösungen im Anhang dienen der Lernkontrolle. Die 3. Auflage umfasst insbesondere Änderungen im Kapitel "Wärmedämmung" aufgrund der Energieeinsparverordnung und der Neufassung der Normreihe DIN 4108 "Wärmeschutz" sowie weitere Normänderungen im Zuge der europäischen Normgebung, u.a. im Kapitel "Lüftung und Dämmung". Inhaltsverzeichnis
1 Dachgeschichte
1.1 Vom Unterschlupf zur Dauerbehausung 1.2 Ganz natürliche "Dach"-Flächen 1.2.1 Deckungsart 1.2.2 Die Natur gibt Beispiele für die Dachform 1.3 Biophysik - Biotechnik - Bionik 1.4 Das Dach als Krönung des Hauses 1.4.1 Assyrer - Griechen - Römer 1.4.2 Leistenziegel 1.4.3 Mönch-Nonnen-Ziegel 1.4.4 Flachziegel - Hohlpfanne - Krempziegel 1.4.5 Falzziegel 1.5 Dachlandschaften als Kulturgüter denkmalgeschützter Städte 2 Vom Tonklumpen zum Dachziegel: Dachziegelherstellung 2.1 Was ist ein Dachziegel? 2.2 Was ist Ton? 2.3 Vom Ton zum Rohling 2.3.1 Die Aufbereitung des Tons 2.3.2 Die Formgebung der Rohlinge 2.4 Angewandte Prozentrechnung 2.4.1 Die Aufgabe 2.4.2 Praxisbeispiel 2.4.3 Die Lösung 2.4.4 Die umgekehrte Aufgabe 2.5 Vom Rohling zum Dachziegel 2.5.1 Formung der Rohlinge 2.5.2 Trocknung 2.5.3 Brennen der Ziegel 2.6 Eigenschaften der gebrannten Dachziegel 2.6.1 Porosität und Frostbeständigkeit 2.6.2 Die Oberflächenfarbe der Dachziegel 3 Handelsformen der Dachziegel 3.1 Merkmale und Anforderungen 3.1.1 Konstruktive Merkmale 3.1.2 Anforderungen an den Dachziegel 3.1.3 Prüfverfahren 3.1.4 Konformitäts- und Güteüberwachung 3.1.5 Zusammenfassung 3.2 Biberschwanzziegel 3.2.1 Schnittarten 3.2.2 Biberschwanzziegeldeckungen 3.3 Hohlziegel 3.3.1 Handelsformen - Deckungsarten - Funktionen 3.3.2 Vorbereitung der Dachfläche 3.3.3 Ausführung 3.3.4 Konsequente Detaillösungen für das Hohlpfannendach 3.4 Krempziegel 3.4.1 Form und Deckungsart 3.4.2 Überdeckungen 3.4.3 Ausführung der Krempziegeldeckung 3.5 Mönch- und Nonnenziegel 3.5.1 Form und Deckungsart 3.5.2 Vorbereitung der Dachfläche 3.5.3 Ausführung 3.6 Flachdachpfanne 3.6.1 Form und Deckungsart 3.6.2 Ausführung 3.7 Falzziegel 3.7.1 Formen und Falze 3.7.2 Doppelmulden-Falzziegel 3.7.3 Reformpfanne 3.7.4 Falzpfanne 3.7.5 Großfalzziegel 3.7.6 Ausführung 3.8 Strangfalzziegel 3.8.1 Form und Deckungsart 3.8.2 Ausführung 3.9 Verschiebeziegel 3.9.1 Form und Deckungsart 3.9.2 Neu decken, ohne zu latten 3.9.3 Konstruktionsmerkmale 3.10 Das Dach und seine Neigungen 3.11 Zuordnung von Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit 4 Dachausmittlung 4.1 Die Dachfläche zwischen Traufe und First 4.1.1 Einheiten 4.1.2 Flächenformen 4.1.3 Drei- und Vierecke 4.1.4 Vielecke 4.1.5 Kreisflächen 4.1.6 Ellipsenflächen 4.1.7 Flächen unter und zwischen Kurven 4.2 Dachlängen 4.2.1 Sätze im rechtwinkligen Dreieck 4.2.1.1 Winkelfunktionen (trigonometrische Funktionen) 4.2.1.2 "Flächensätze" 4.2.2 Sätze im "allgemeinen" Dreieck 4.2.3 Proportionen (Verhältnisgleichungen) in ähnlichen Dreiecken 4.2.3.1 Dreiecksgaube mit fallendem First im Pultdach 4.2.4 Dachhöhe (aus Dachneigung und Dachbreite) 4.2.4.1 Dächer über Trapezgrundriss mit gleicher Dachneigung 4.3 Grat- und Kehlneigung < Dachneigung 4.3.1 Der Traufe "zugeneigt" 4.4 Darstellung von Dächern 4.4.1 Parallelprojektionen 4.4.2 Zentralprojektion 4.4.3 Fachzeichnen - die Sprache des Handwerkers 4.4.4 Der Maßstab 4.5 Darstellung von Gratlängen 4.5.1 Zeichnerische Darstellung und ihre Verzerrungen 4.5.2 Regeln der Dachausmittlung 4.5.3 Sinn und Zweck der Dachausmittlung 4.6 Dachausmittlung in neun Beispielen 4.6.1 Beispiel 1: Ungleichhüftiges Walmdach 4.6.2 Beispiel 2: Zeltdach über unregelmäßiger, viereckiger Grundfläche 4.6.3 Beispiel 3: Walmdach über Trapezgrundriss mit gleicher Dachneigung 4.6.4 Beispiel 4: "Vorbau" an einer Hausecke (Eingangsbereich) 4.6.5 Beispiel 5: Ungleichhüftige Trapezgaube mit fallendem First im Pultdach 4.6.6 Beispiel 6: Walmdach über doppelt abgewinkelter Grundfläche mit 55° Dachneigung 4.6.7 Beispiel 7: Walmdach über schiefwinkliger Grundfläche mit ungleichen Dachneigungen 4.6.8 Beispiel 8: Walmdach über schiefwinkliger Grundfläche mit Anbau 4.6.9 Beispiel 9:Walmdach mit abgeschleppter Trapezgaube und unterschiedlichen Dachneigungen und Traufhöhen 4.7 Materialbedarf am Grat 4.7.1 Vorgehensweise 4.7.2 Ermittlung des Längenmaßes 4.7.3 Ermittlung des Materialbedarfs 4.8 Grate auf Walmdächern mit gleicher Neigung 4.8.1 Gratneigungen und -längen bei Gleichhüftigkeit 4.9 Grate auf Walmdächern mit ungleicher Neigung 4.9.1 Gratneigungen und -längen bei Ungleichhüftigkeit 4.9.2 Abhängigkeit des Gratwinkels 5 Dacheinteilung 5.1 Die Dacheinteilung von der Traufe zum First 5.2 Die Dacheinteilung von Ortgang zu Ortgang 5.3 Breiteneinteilung der Dachfläche 5.3.1 Beispielrechnungen zur Breiteneinteilung der Dachfläche 5.4 Höheneinteilung der Dachfläche 5.4.1 Lattenweitenberechnung für die Einfachdeckung 5.4.1.1 Beispielrechnungen 5.5 Doppeldeckungen mit "Bibern" 5.5.1 Lattenweitenberechnung für Kronendeckung 5.5.2 Lattenweitenberechnung für Doppeldeckung 5.5.3 Beispielrechnungen 5.6 Dacheinteilung und Materialberechnung 5.6.1 Breiteneinteilung der Dachfläche 5.6.2 Einteilung der Sparrenlänge 5.6.3 Ermittlung der Materialien 5.7 Materialberechnung 5.7.1 Beispielrechnung 5.8 Material und Masse 5.8.1 Beispielrechnungen 5.9 Dachgröße - Dacheinteilung - Materialbedarf 5.10 Dachdeckermörtel 5.10.1 Der Deckmörtel 5.10.2 Der Dachdecker-Fertigmörtel 5.10.2.1 Steckbrief des Dachdecker-Fertigmörtels 5.10.3 Die Mörtelausbeute 5.10.3.1 Bindemittel und Zuschlagstoff 5.10.3.2 Das Mischungsverhältnis 5.10.3.3 Die Ermittlung der Mörtelausbeute 6 Grate 6.1 Geschichte der Grate 6.1.1 Zur Zahl Pi 6.1.2 Der goldene Schnitt 6.1.3 Das Walmdach 6.2 Details rund um den Grat 6.2.1 Der Grat-Begriff 6.2.2 Traufknoten 6.2.3 Firstknoten 6.2.4 Gratlängenberechnung 6.3 Schiftung 6.3.1 Backenschiftung 6.3.2 Längenermittlung der Lotschmiege 6.3.3 Klauenschiftung 6.3.4 Dach - dek - ker - sil - ben - raet - sel 6.4 Typologie der Grate 6.4.1 Probleme bei der Grateindeckung 6.4.2 Der eingebunde Grat 6.4.3 Eingebundener Grat an Gauben 6.4.4 Typische Gratziegel 6.4.5 Schmuck- Walmanfänger 6.4.6 Eine Glocke, die nicht läutet . . . 6.4.7 Moderne Gratabdeckungen 6.4.8 "Gratwanderung" 7 Eindecktechniken 7.1 Deckunterlage 7.2 Vorbereiten der Grateindeckung 7.2.1 Das Abstecken eines Hohlpfannengrates 7.2.2 Biberschwanzziegeldeckungen 7.3 Das Zurichten der Gratspitzen 7.3.1 Das Zurichten mit der Ziegelzange 7.3.2 Das Zurichten auf der Haubrücke 7.4 Die Gratdeckung in Mörtel 7.4.1 Normaler Gratanfang 7.4.2 Der Fechtel als Gratanfänger 7.4.3 Weitere Ausbildung des Grates 7.4.4 Vermörtelungstechniken beim Gratsetzen 7.4.4.1 Hohl aufgesetzter Gratziegel 7.4.4.2 Aufgesattelter Gratziegel 7.4.5 Vor- und Nachteile der Vermörtelungstechniken 7.5 Anforderungen, Anarbeiten, Aufteilen 7.6 Gratabschlusses am First 7.7 Mörtellose Gratverlegung 7.7.1 Grat mit elastischen Elementen 7.7.2 Trockengrat mit Lüftungselementen 7.8 Der eingebundene Grat 7.8.1 Eingebundener Grat an Gauben 8 Wohnreserven unterm Dach 8.1 Gauben - Platz, Luft und Licht für Wohnreserven zwischen Traufe und First 8.1.1 Dachformen 8.1.2 Gaubenformen 8.1.3 Ausmittlung der Fledermausgaube 8.1.3.1 Beispielrechnungen zur dargestellten Fledermausgaube 8.1.4 Wie kommt die Fledermaus auf's Dach? 8.1.4.1 Ausführung der Fledermausgauben 8.1.4.2 Deckung mit Biberschwanzziegeln 8.1.4.3 Deckung mit Hohlziegeln 8.1.4.4 Deckung mit Falzziegeln 8.1.5 Hechtgaube - eine Kombination von Fledermaus - und Schleppgaube 8.2 Belichtung durch Dachfenster und Dachflächenfenster 8.2.1 Dachfenster 8.2.2 Dachflächenfenster 8.2.3 Anforderungen an Dach - und Dachflächenfenster 8.2.4 Ausführung 8.3 Auswahl der Fenster 9 Wärmedämmung 9.1 Grundlagen 9.1.1 Energieverbrauch und Treibhauseffekt 9.1.2 Energieeinsparung und CO2-Reduktion 9.1.3 Wohlbefinden und Gesundheit 9.2 Dämmstoffeigenschaften 9.2.1 Einbaufehler, bezogen auf dichte Fugenausbildung 9.2.2 Anwendungstypen 9.2.3 Hinweise zur Auswahl und zum fachgerechten Einbau 9.3 Dämmstoff-Materialien 9.3.1 Wärmedämmstoffe aus Erdöl 9.3.1.1 Polystyrol 9.3.1.2 Polyrethan-Dämmstoffe 9.3.1.3 Dämmstoffe aus Phenolharz PF 9.3.2 Mineral-Dämmstoffe 9.3.2.1 Mineral-Schäume 9.3.2.2 Expandierte Mineralien 9.3.2.3 Dämmstoffe aus Mineralfasern 9.4 Kennzeichnung von Wärmedämmstoffen 9.5 Organische Dämmstoffe 9.5.1 Korkdämmstoffe 9.5.2 Holzdämmstoffe 9.5.3 Dämmstoffe aus Zellulose 9.5.4 Dämmstoffe aus Stroh und Schilfrohr 9.6.5 Kokosfaser 10 Lüftung - Dämmung 10.1 Lüftung wärmegedämmter Ziegeldächer 10.1.1 Einleitung 10.1.2 Das wärmegedämmte durchlüftete Dach 10.1.3 Lüftungsquerschnitt am Grat 10.1.4 Anordnung der Lüfterziegel an First und Grat 10.2 Ausführung der Lüftung am Grat 10.2.1 Beispiel 1: Grat- /Firstausbildung mit Universal-Lüfterfirstziegeln 10.2.1.1 Vereinfachter Nachweis der Lüftung 10.2.2 Beispiel 2: Grat- /Firstausbildung mit Patent-Lüfterfirstziegeln 10.2.3 Beispiel 3: Gratausbildung auf PVC-Lüfterelementen (Trockengratausbildung) 10.2.4 Beispiel 4: Gratausbildung mit Gaubenlüftern 10.3 Grat- und Firstlüftungssysteme 10.3.1 Universal-Lüfter 10.3.2 Trockenlüfter-System 10.4 Trockengrat und -first mit integrierter Lüftung 10.4.1 Die Gratrolle 10.4.2 Eigenschaften 10.4.3 Verlegung der Gratrolle 10.5 Trockengrat und -first bei Wärmedämmsystemen über den Sparren 10.5.1 Besondere Regeln für Aufsparren-Dämmsysteme 10.5.2 Befestigung der Dämmsysteme 10.5.3 Verlegung 10.5.5 Dämmsysteme mit Spezialhaltern 10.6 Zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Lüftung zwischen Wärmedämmung und Unterspannbahn 10.7 Zusätzliche regensichernde Maßnahmen 11 Feuchteschutz durch Lüftung und Dämmung 11.1 Klimabedingter Feuchteschutz 11.1.1 Das belüftete Dach 11.1.2 Das unbelüftete Dach 11.2 Wasserdampfdiffusion 11.2.1 Vermeidung von Tauwasseranfall 11.3 Fazit der bauphysikalischen Betrachtungen 11.3.1 Belüftete Dächer 11.3.2 Unbelüftete Dächer 12 Dachentwässerung 12.1 Arten des Wassers 12.2 Verschiedene Ausführungsarten der Entwässerung 12.2.1 Bemessung der Dachrinne 12.2.2 Das Fallrohr 12.3 Berechnung der zu erwartenden Regenabflussmenge 12.4 Das Anbringen von Dachrinnen 12.5 Warme Dachentwässerung 12.6 Kalte Dachentwässerung 12.7 Zusammenfassung 12.8 Unterspannbahn und Unterdach 12.9 Dachrinnen 12.9.1 Berechnung der Längenänderung 12.9.2 Rinnengefälle 12.9.3 Kontaktkorrosion 13 Das Solardach als Energiezentrale 13.1 Energieverbräuche und -lieferanten 13.2 Der erste Strom aus Sonnenlicht 13.2.1 Einsteins Theorien des Lichts 13.2.2 Entdeckung der Halbleiter 13.3 Technische Nutzung von Wärme und Licht 13.3.1 Solarthermie 13.3.2 Photovoltaik 13.4 Der Dachdecker als Fachmann für den Einbau von Solar-Anlagen 13.4.1 Auf- und Indach-Montage von Solarthermieanlagen 13.4.2 Auf- und Indach-Montage von Photovoltaikanlagen 13.5 Solardachziegel-Systeme 13.6 Förderprogramme 14 Lösungen zu den Übungen Stichwortverzeichnis Quellennachweis |
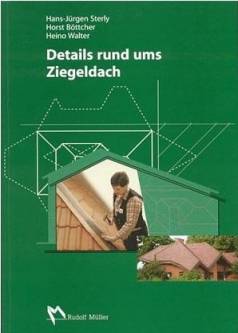
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen