|
|
|
Umschlagtext
Die Philosophie des griechischen Altertums ist die produktivste Phase in der Geschichte der europäischen Philosophie. Bis gegen 1800 spielt die nachantike Philosophie weiter mit den Figuren, die im Altertum aufgestellt wurden, und ändert auch nicht die Regeln des Spiels, sondern nur die Anlage der Partien und den erstrebten Gewinn in der Weise, dass zusätzlich zu dem antiken Ziel der Selbstbemächtigung seit 1600 das moderne Ziel der Weltbemächtigung die Intention des Denkens leitet.
Rezension
Die Antike Philosophie wird heute gelegentlich unterschätzt. Dabei bewegt sich bis gegen 1800 auch die nachantike Philosophie weiter in den Bahnen, die im Altertum aufgestellt wurden. Dieser Band vermittelt einen Gesamtüberblick über die antike Philosophie; dabei spielen Platon und Aristoteles natürlich eine besonders bedeutsame Rolle(vgl. Kap. 11 und 12), aber die Philosophie der Antikewird doch erfreulich nicht auf diese beiden reduziert. - Lehrer/innen kommen ohne philosophiegeschichtliche Grundkenntnisse kaum aus; viel zu sehr haben die jeweiligen geistesgeschichtlichen Strömungen auch die jeweilige Pädagogik beeinflußt. Philosophie-, Gesellschaftskunde- und Religionslehrkräfte benötigen darüber hinaus spezifisches Fachwissen zur Philosophiegeschichte. Das bietet in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis diese 2-bändige Ausgabe.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Es ist an der Zeit, Geschichte der Philosophie nicht mehr nur als geschätztes, aber unverbindliches Bildungsgut zu erzählen, sondern zu prüfen, was die Philosophie auf ihrem Weg durch die Geschichte Europas den Menschen „angetan" hat, im Guten wie im Bösen. Dieses Ziel setzt sich Hermann Schmitz in einem zweibändigen Werk, indem er diesen Weg analytisch und kritisch von Homer bis Merleau-Ponty nachzeichnet. Der erste Band gliedert die Geschichte der antiken Philosophie in drei Phasen: 1. die archaische, in der das menschliche Selbstverständnis allmählich von der Ausgesetztheit an unwillkürliche Regungen zur Selbstbemächtigung hinüberwächst, während das Weltverständnis von vielsagenden Eindrücken, die an leibnah gespürten Kräften abgelesen werden, geleitet wird; 2. den Bruch mit dem archaischen Denken seit Demokrit im Zeichen eines neuen Paradigmas, das die Welt in abgeschlossene Innenwelten (Seelen) und eine empirische Außenwelt zerlegt; das ungeheure Potential für Selbst- und Weltbemächtigung, das diese Vergegenständlichung freisetzt, wird zunächst nur für Selbstbemächtigung genützt; 3. den spätantiken heidnischen Neuplatonismus, der mit dem Gedanken der Vieleinigkeit diese Vergegenständlichung unterläuft und dadurch trotz abgöttischer Verehrung für Platon so platonfern denkt wie keine andere Philosophenschule in Europa. Autoreninfo: Hermann Schmitz, geb. 1928 in Leipzig, 1971-1993 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Kiel. Begründer der Neuen Phänomenologie, die bestrebt ist, die Abstraktionsbasis der Begriffsbildung tiefer in der unwillkürlichen Lebenserfahrung zu verankern. Seine systematischen und historischen Publikationen (40 Bücher, gegen 120 Aufsätze) sollen dazu dienen, den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen, indem nach Abräumung geschichtlich geprägter Verkünstelungen der Besinnung ein begrifflich gestützter Zugang zur unwillkürlichen Lebenserfahrung geöffnet wird. Inhaltsverzeichnis
Band 1: Antike Philosophie
Vorrede 15 1. Das menschliche Selbstverständnis bei Homer 19 2. Das menschliche Selbstverständnis in der archaischen Lyrik und der attischen Tragödie 24 3. Anaximander und Anaximenes 32 4. Heraklit 38 4.1 Einleitung 38 4.2 Das Äquivalenzprinzip 39 4.3 Gemeinschaft und Ein/elseele 50 5. Parmenides 54 5.1 Die Mach-Erfahrung 54 5.2 Aletheia und Doxa 59 5.3 Streitende Haufen und göttliche Offenbarung 69 5.4 Die Wege der Forschung 75 5.5 Zur Datierung: Parmenides und Xenophanes 78 6. Die zweite eleatische Schule 80 6.1 Zenon 81 6.1.1 Die Paradoxien der Vielheit 81 6.1.2 Die Paradoxien der Bewegung 85 6.1.3 Zenon gegen Empedokles 87 6.2 Melissos 89 6.3 Leukipp 91 7. Pythagoras und die Pythagoreer 96 8. Empedokles 106 8.1 Attraktion als Gestaltung 106 8.2 Attraktion als Erkenntnis 111 8.3 Der kosmische Zyklus 114 9. Demokrit 119 9.1 Der Bruch mit dem archaischen Denken 119 9.2 Demokrit und Leukipp 126 9.3 Demokrit als Schwärmer 127 10. Protagoras 132 10.1 Rhetorik als Verwaltung von Situationen 132 10.2 Der Homo-Mensura-Satz 134 10.3 Protagoras und Sokrates 136 11. Platon und das »Rätsel der alten Akademie« 139 11.1 Einführung 139 11.2 Die Ideenlehre 141 11.2.1 Platon und die Ideenfreunde 141 11.2.2 Platons Ideenlehre bis zum Auftauchen des Regressargumentes 159 11.2.3 Das erste Regressargument in Parmenides 163 11.2.3.1 Das Regressargument: Struktur und Folgen für Platon 163 11.2.3.2 Die Herkunft des Regressargumentes 169 11.2.4 Platons Ideenlehre nach der Begegnung mit dem Regressargument 175 11.3 Die Prinzipienlehre mit einem Prinzip 181 11.4 Speusipp 186 11.4.1 Speusipps spätere Lehre 186 11.4.2 Speusipps frühere Lehre 189 11.5 Eudoxos und Platon 195 11.6 Die Prinzipienlehre mit zwei Prinzipien 200 11.6.1 Platon und die Pythagoreer 200 11.6.2 Der Vortrag über das Gute 206 11.6.2.1 Der Platz des Vortrags in Platons Prinzipienlehre 206 11.6.2.2 Der Gang des Vortrags 209 11.6.2.3 Datierung des Vortrags 211 11.6.3 Die Weiterbildung der Prinzipienlehre Platons nach dem Vortrag 219 11.7 Platons philosophische Entwicklung 222 11.8 Platons Elementarismus 231 11.8.1 Der theoretische Elementarismus 231 11.8.2 Der politische Elementarismus 239 12. Aristoteles 243 12.1 Einleitung 243 12.2 Die Kategorienlehre 247 12.3 Die konvergente Metaphorik des Seienden 253 12.4 Die Potenzlehre 261 12.5 Die Ideenlehre 271 12.6 Vom Materialismus zum Idealismus 279 12.7 Das siebente Buch der Metaphysik 286 12.8 Die Überwindung des praktischen Elementarismus 294 12.9 Ding an sich und Relation 302 13. Die Stoa 307 14. Epikur 316 15. Plotin 323 15.1 Einleitung 323 15.2 Die Vieleinigkeit 326 15.2.1 Plotins Paradoxe 326 15.2.2 Logische Rehabilitierung Plotins 332 15.3 Der Ursprung der sinnlichen Welt nach Plotin 337 15.4 Das Eine 346 16. Proklos 352 16.1 Die horizontale Schichtung 352 16.2 Das dynamische Schichtenverhältnis 357 16.3 Typen der Mannigfaltigkeit 360 16.4 Die dynamische Polarität 367 16.5 Die zweite Hypostase 371 16.6 Was geht uns Proklos an? 374 17. Damaskios 379 17.1 Einleitung 379 17.2 Das prä-immanente Eine 380 17.3 Das Dilemma der Erkenntnis 384 18. Johannes Scotus Eriugena 388 18.1 Das johanneische Erbe 388 18.2 Eriugena und Damaskios 393 18.3 Die Vieleinigkeit 397 Abkürzungen 403 Glossar 404 Personenregister 409 Sachregister 413 |
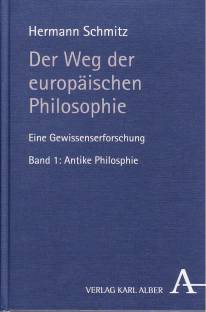
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen