|
|
|
Umschlagtext
Gehlens Hauptwerk "Der Mensch" stellt seit seinem Erscheinen 1940 das zentrale Werk der Philosophischen Anthropologie dar.
Gehlen betont die Sonderstellung des Menschen und legt seinem "anthropologischen Schema" die Handlung als Ansatz zugrunde. Für Gehlen ist der Mensch zuallererst ein biologisches "Mängelwesen", das im Gegensatz zu den Tieren nicht an eine bestimmte Umwelt angepasst ist und zugleich durch einen "lebensgefährlichen Mangel an echten Instinkten" charakterisiert ist. Daraus resultiert der Antrieb des Menschen, die Natur zu kultivieren. Er muss "die Welt und sich selbst beherrschen lernen", um überleben zu können und ist für Gehlen damit "von Natur aus ein Kulturwesen". Für die 14. Auflage hat der bekannte Gehlen-Forscher Karl-Siegbert Rehberg (TU Dresden) eine Einführung in das Werk verfasst. Rezension
Dieses Buch ist ein Klassiker der Anthropologie im 20. Jahrhundert. Gehlens Hauptwerk stellt seit Erscheinen im Jahre 1940 das zentrale Werk der Philosophischen Anthropologie dar. Die Kernthese ist bekannt: Der Mensch ist ein Mängelwesen und muss deshalb die Welt und sich selbst beherrschen lernen, um überleben zu können, und ist genötigt, Kultur und Technik auszubringen, - der Mensch ist wesentlich ein Kulturwesen. Als biologisches Mängelwesen, das im Gegensatz zu den Tieren nicht an eine bestimmte Umwelt angepasst ist, hat der Mensch einen lebensgefährlichen Mangel an echten Instinkten und muss deshalb durch kulturelles Handeln seine Existenz sichern.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
"Der Mensch" ist das Hauptwerk Arnold Gehlens und gilt als ein Angelpunkt der Philosophischen Anthropologie. 1904 als Sohn eines Verlegers in Leipzig geboren, studierte Arnold Gehlen Philosophie, Deutsch und Kunstgeschichte. 1927 promovierte er bei Hans Driesch und folgte ihm 1934 auf den Philosophischen Lehrstuhl der Universität Leipzig. 1940 wurde er an die Universität Wien berufen und war ab 1947 an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer tätig. Von 1962 bis zu seiner Emeritierung 1969 unterrichtete er auf dem neugegründeten Lehrstuhl für Soziologie an der Technischen Hochschule in Aachen. 1976 ist Arnold Gehlen in Hamburg verstorben. Inhaltsverzeichnis
Einführung 9
1. Der Mensch als biologisches Sonderproblem 9 2. Ablehnung des Stufenschemas 20 3. Erster Begriff vom Menschen 31 4. Fortsetzung derselben Anschauung 40 5. Handlung und Sprache 46 6. Handlung und Antriebe 51 7. Antriebsüberschuß und Führung 57 8. Das Entlastungsgesetz - Rolle des Bewußtseins 61 9. Tier und Umwelt. Herder als Vorgänger 73 I.Teil: Die morphologische Sonderstellung des Menschen 86 10. Die Organprimitivismen 16 11. Die Theorie von Bolk und verwandte 101 12. Die Abstammungsfrage 113 II.Teil: "Wahrnehmung, Bewegung, Sprache 131 13. Elementare Kreisprozesse im Umgang 131 14. Fortsetzung 141 15. Leistungsgrenzen der Tiere 149 16. Optische Gestalten und Symbole 157 17. Bewegungs- und Empfindungsphantasie 180 18. Bewegungssymbolik 188 19. Zwei Sprachwurzeln 193 20. Wiedererkennen. Dritte Sprachwurzel 197 21. Theorie des Spiels. Vierte Sprachwurzel 205 22. Erweiterung der Erfahrung 211 23. Höhere Bewegungserfahrung 222 24. Lautgesten. Fünfte Sprachwurzel 228 25. Geplante Handlungen 233 26. Wiederholung der Sprachgrundlagen 236 27. Element der Spradhe selbst 240 28. Ursprüngliche Fortschrittsmotive der Sprache 246 29. Rückwirkungen: Die Vorstellung 252 30. Rückwirkungen: Angleichung der inneren und äußeren Welt 257 31. Lautloses Denken 263 32. Ursprungsprobleme der Sprache 267 33. Höhere Sprachentwicklung 273 34. Spracheigene Phantasmen 283 35. Erkenntnis und Wahrheit 290 36. Irrationale Erfahrungsgewißheit 302 37. Zur Theorie der Phantasie 316 III. Teil: Antriebsgesetze, Charakter, Das Geistproblem 327 38. Ablehnung der Trieblehren 327 39. Zwei Antriebsgesetze. Der Hiatus 332 40. Weltoffenheit der Antriebe 338 41. Weitere Antriebsgesetze 349 42. Antriebsüberschuß. Gesetz der Zucht 356 43. Charakter 370 44. Exposition einiger Probleme des Geistes 381 Namenverzeichnis 407 Sachverzeichnis 408 |
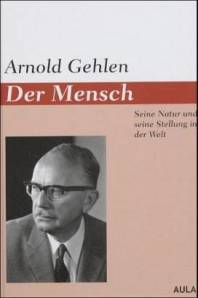
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen