|
|
|
Umschlagtext
Finkelstein und Silberman beschreiben die überraschende archäologische Wahrheit über die legendären Könige David und Salomo, deren Bild Judentum und Christentum maßgeblich geprägt hat. Sie zeigen, was der historische Kern der Sagen ist und wie die Legenden im Laufe vieler Jahrhunderte immer wieder im Interesse politischer und religiöser Machtansprüche umgearbeitet und erweitert wurden.
«Faszinierend ... Die These des Buches ebenso wie ihre eindrucksvolle Entfaltung zwingen den Leser, neu über das Alte Israel zu denken.» The New York Times Book Review «Eine rücksichtslos aufrichtige Bestandsaufnahme dessen, was die Archäologie uns über die historische Wahrheit der Bibel sagen kann.» Los Angeles Times «Diese Entmystifizierung der biblischen Frühgeschichte war längst überfällig.» The Gazette Während sich selbst kritische Bibelwissenschaftler bis heute an den Biographien Davids und Salomos abarbeiten, machen die Archäologen Finkelstein und Silberman auf erfrischende Weise tabula rasa: Über die beiden „Könige“ wissen wir so gut wie nichts, denn Jerusalem war im zehnten Jahrhundert v. Chr. ein bedeutungsloses Bergdorf – ohne Tempel und Palast. Ein geeintes Königreich von Israel und Juda hat es nie gegeben. Dieser Befund ist jedoch nur der Anfang einer faszinierenden Spurensuche. Wer waren in Wirklichkeit die mächtigen Herrscher, die in der Bibel beschrieben werden? Wer baute den Tempel? Archäologische und andere außerbiblische Zeugnisse geben Hinweise, wie nach und nach spätere Entwicklungen und Ereignisse – Eroberungen, Tempelbauten, wirtschaftliche Blütezeiten – mit David und Salomo verknüpft wurden. So machten der musikalische, Harfe spielende Gründer einer großen Dynastie und sein Sohn, der weise Erbauer des ersten Jerusalemer Tempels, auch noch als Verfasser von Psalmen, Liebesliedern und Weisheitsbüchern Karriere. In einem letzten Schritt zeigen die Autoren, wie David und Salomo zu messianischen Hoffnungsträgern, Vorläufern Jesu und idealen Herrschern stilisiert wurden. Der Mythos von David und Salomo erweist sich so als ein zentraler Schlüssel, um die wahre Geschichte des alten Israel, die Entstehung der Bibel und die Grundlagen der abendländischen Kultur zu verstehen. Rezension
Ziel des vorliegenden Buches ist ein neuer Blick auf die Geschichte Davids und Salomos - unter Berücksichtigung der zahlreichen neuen archäologischen Erkenntnisse. Die historischen Ereignisse werden vom Mythos getrennt, authentische Erinnerungen von späteren Hinzufügungen, die Fakten von königlicher Propaganda, dabei wird die Geschichte Davids und Salomos von ihren Ursprüngen bis zu ihrer endgültigen biblischen Form nachgezeichnet. Im Verlauf eines komplizierten historischen Prozesses rückten David und Salomo ins Zentrum eines Gründungsmythos, der im altorientalischen Juda entstand und sich von da aus in der ganzen westlichen Welt ausbreitete. Es zeigt sich, wie die Erinnerungen an die Gründer der eisenzeitlichen Dynastie Judas umgestaltet und den jeweiligen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen angepaßt wurden. Über Jahrhunderte hinweg vermochte die David-und-Salomo-Überlieferung die Autorität der jüdischen und christlichen Ideologie zu festigen vermochte. David und Salomo dienten in späterer Zeit als Vorbild für westliche Modelle von Königsherrschaft.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
SZ/Buchjournal/Börsenblatt/NDR-Sachbuchbestenliste September 2006: Platz 7 „Diese Entmystifizierung der biblischen Frühgeschichte war längst überfällig.“ The New York Times Book Review Israel Finkelstein , geb. 1949, ist Professor für Archäologie an der Universität Tel Aviv und Leiter eines Grabungsteams in Megiddo. Er wurde 2005 mit dem hochdotierten Dan-David-Preis ausgezeichnet und gehört zu den führenden Archäologen in Israel. Neil Asher Silberman , geb. 1950, ist Direktor des Ename Center for Public Archaeology and Heritage Presentation in Belgien und Mitarbeiter zahlreicher internationaler Forschungsprojekte. „Diese archäologische und hermeneutische Umdeutung gelingt so überzeugend, dass die Verfechter eines historischen Davidischen Königreichs künftig sehr starke Argumente und deutliche Belege werden beibringen müssen. (…) Zweifellos wird die religiöse Bedeutung der Davidlegende damit nicht geschmälert, und die literarische Kraft des Berichts, dessen Wirkung seit über zweitausend Jahren anhält, rückt erst richtig in den Blick (…). David Oels, Frankfurter Rundschau, 31. Oktober 2006 „Die Archäologen Israel Finkelstein und Neil A. Silberman lassen kein gutes Haar an den beiden heroischen Gründerfiguren des vereinigten Königreichs von Juda und Israel. Den biblischen Berichten setzen sie die Erkenntnisse der Archäologie entgegen und entzaubern so einen Mythos mit jahrtausendelangem Nachklang. Die beiden israelischen Autoren setzen in ihrem gerade erschienen Buch „David und Salomo“ unzählige Einzelbefunde zu einem faszinierenden Mosaik des Vorderen Orients zu Beginn der Eisenzeit ab 1000 v.Chr. zusammen. Sie stützen sich dabei auf eigene Forschung und die Arbeiten vieler anderer Wissenschaftler, (…).“ Michael Zick, Der Tagesspiegel, 21. September 2006 „Eine rücksichtslos aufrichtige Bestandsaufnahme davon, was die Archäologie uns über die historische Wahrheit der Bibel sagen kann … Finkelstein und Silberman beziehen die neuesten Funde in ihren souveränen Überblick ein und leuchten erstmals viele bisher verborgene Winkel der Bibel aus.“ Los Angeles Times Inhaltsverzeichnis
Prolog: Der Schafhirte mit der Steinschleuder
Einleitung: David, Salomo und die abendländische Tradition Die biblische Geschichte in Kürze Die einstigen und künftigen Könige des Abendlands Anatomie eines biblischen Epos Wann lebten David und Salomo? Auf den Spuren Davids und Salomos ERSTER TEIL Zurück zu den historischen Wurzeln 1. Banditengeschichten: Der Aufstieg Davids im Bergland von Juda (10. Jahrhundert v. Chr.) Leben an der Siedlungsgrenze Der Wandel des Siedlungsmusters In Abdi-Hepas Reich Geächtete und Könige War David ein Apiru? Vom Banditen zum Stammesführer Die Stratigraphie der Heldenerzählungen Geschichten für kalte Winterabende 2. Sauls Wahnsinn: Ägypten, die Philister und der Untergang des ältesten Israel (10. Jahrhundert v. Chr.) Wer, wann und wo? Der Aufstieg des nördlichen Berglands Ein rätselhafter Siedlungsrückgang Die Rückkehr des Pharaos Schischaks geheime Strategie Warum bleibt Jerusalem unerwähnt? Der vergessene Verrat Heiliger oder Verräter? 3. Mord, Wollust und Verrat: Davids Hof in Jerusalem (9. Jahrhundert v. Chr.) Fehlende Belege Der erste israelitische Königshof Der Aufstieg Judas Umdeutung der Vergangenheit Geographische Anhaltspunkte Tod und Wiedergeburt der davidischen Dynastie ZWEITER TEIL Die Entstehung einer Legende 4. Tempel und Dynastie: Die Entstehung des ersten schriftlichen Epos (spätes 8. Jahrhundert v. Chr.) Die neue assyrische Ordnung Eine wirtschaftliche und soziale Revolution Eine Flüchtlingswelle Ein Volk, ein Tempel Die erste autorisierte Version Hiskias Revolte Sanheribs Rache 5. Salomos Weisheit? Klientelkönigtum und Fernhandel (frühes 7. Jahrhundert v. Chr.) Wiederaufbau nach der Zerstörung Hazor, Megiddo und Geser Die Pferde des Königs Karawanen, Kamele und die Königin von Saba Wer erbaute den Tempel? König Salomos Kupferminen Die Entstehung des Mythos Salomo 6. Der Kampf gegen Goliath: Das davidische Vermächtnis und die deuteronomistische Theologie (spätes 7. Jahrhundert v. Chr.) Die deuteronomistische Darstellung Weltreiche in Auflösung David und die Philister Neue Gebietsansprüche Wer tötete Goliath? Homerische Schlacht und griechische Söldner Die Eroberung Bethels Ein neues Bild von David und Salomo Das messianische Erbe DRITTER TEIL Wie die Legende Geschichte machte 7. Schutzpatrone des Tempels: Von königlicher Propaganda zur religiösen Lichtgestalt (6. bis 4. Jahrhundert v. Chr.) Eine prophetische Erneuerung Das Erlöschen des davidischen Königshauses Von Königen zu Priestern Das Geschichtsbild der Chronik Noch einmal Samaria 200 David und Salomo als Theologen 8. Messianische Hoffnungen: Vom Judentum zum Christentum (2. Jahrhundert v. Chr. bis 5. Jahrhundert n. Chr.) Das Bild der Könige in hellenistischer Zeit Messianische Hoffnungen Austreibung der Dämonen Propheten eines neuen Evangeliums Rechtsgelehrte David und Salomo als christliche Allegorien Neue Davids und neue Salomos Epilog: Machtvolle Symbole: David und Salomo in Mittelalter und Neuzeit ARCHÄOLOGISCHE EXKURSE 1. Hat David je existiert? Die Minimalisten und die Tell-Dan-Inschrift 2. Die Suche nach dem Jerusalem Davids und Salomos 3. Salomos sagenhaftes Königreich: Ausgrabungen in Megiddo, Hazor und Geser 4. Salomo und die Kupferminen: Ein Beleg für die wirtschaftliche Blüte des vereinigten Königreichs? 5. Der Abbau der Kultstätten: Die Zentralisierung des Kults unter Hiskia 6. Tyrannen, Städtebündnisse und Söldnertruppen: Weitere Spuren der griechischen Kultur des 7. Jahrhunderts v. Chr. in den biblischen Geschichten über die Philister 7. Deportierte, Heimkehrer und die Grenzen Jehuds: Die Archäologie der exilischen und der nachexilischen Zeit ANHANG Dank Chronologische Übersicht Literaturhinweise Register Leseprobe Israel Finkelstein, Neil A. Silberman: David und Salomo War David ein Apiru? Die Beschreibung von Davids Aufstieg im ersten Buch Samuel enthält deutliche Parallelen zu den Aktivitäten eines typischen Apiru-Anführers und seiner Rebellenbande. David und seine Männer leben nach ihren eigenen Gesetzen und gehen skrupellos wechselnde politische Bündnisse ein, die das einzige Ziel haben, das eigene Überleben zu sichern. Sie agieren in entlegenen Dörfern und am Wüstenrand – in der unwirtlichen Wüste Juda und im trockenen Steppenland im Süden –, außer Reichweite der Zentralmacht. Um des Überlebens willen gezwungen, sich unter den Schutz eines benachbarten Philisterherrschers zu stellen, werden sie als Söldner dessen williges Werkzeug. Dennoch bleiben sie den Bauern und Hirten, aus deren Mitte sie stammen und die sie unterstützen, stets verbunden. Sie lassen es sich angelegen sein, sie gegen Plünderer zu verteidigen, und teilen mit ihnen ihre Beute, um sich noch größeren Rückhalt zu sichern. Solche Sozialbanditen werden mit einer Mischung aus Verachtung und Bewunderung betrachtet. Die Amarna-Briefe zeichnen ein Bild der Apiru als treulose, gefährliche Halsabschneider, die Bibel dagegen beschreibt David als wagemutig, bisweilen unberechenbar, von den Berglandbewohnern jedoch als ihr Beschützer und Führer anerkannt. Bei genauerer Betrachtung sind bestimmte Einzelheiten der biblischen Erzählung nahezu identisch mit der Beschreibung der Apiru-Banden in den Amarna-Briefen. Am aufschlußreichsten ist die am Anfang des Kapitels schon erwähnte Beschreibung, wie sich Randexistenzen der judäischen Gesellschaft Davids Bande anschließen: David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster; und es waren bei ihm etwa vierhundert Mann. (1 Sam 22,1 f.) Dasselbe gilt für die Beschreibung von Davids Taktik bei der Rettung der Bewohner des Dorfes Keïla vor den Überfällen der Philister. David und seine Privatarmee – schnell, mobil und gnadenlos – schlagen diese Bedrohung nieder, der entgegenzutreten die Zentralregierung entweder zu ängstlich oder zu schwach war. David nimmt die Angelegenheit selbst in die Hand und wird zum Retter aus höchster Not. Nachdem der Blitzsieg errungen und die Beute verteilt ist, zieht sich die Bande wieder in ihre sicheren Wüstenverstecke zurück. So zog David mit seinen Männern nach Keïla und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. So errettete David die Leute von Keïla. (1 Sam 23,5) Da machte sich David auf samt seinen Männern, etwa sechshundert, und sie zogen fort von Keïla und streiften da und dort umher … (1 Sam 23,13) David aber blieb in der Wüste auf den Bergfesten, und zwar blieb er im Gebirge in der Wüste Sif … (1 Sam 23,14) Es gibt einen geographischen Ort, auf den die Amarna-Briefe hindeuten: Das Dorf Keïla, das mit Chirbet Qila gleichgesetzt wird, liegt am östlichen Rand der oberen Schefela – isoliert und den Angriffen von Herrschern aus der unteren Schefela und der Küstenebene ausgeliefert. Nach dem Rückzug der Ägypter aus Kanaan hatten die Philister hier die Kontrolle übernommen. Übergriffe der mächtigen philistäischen Stadtstaaten auf die Grenzregionen des Berglands – um Ernteerträge zu erbeuten oder die spärliche Landbevölkerung zu schikanieren – waren damals an der Tagesordnung. Doch die Erzählung vom biblischen Keïla scheint auf eine lange Tradition von Überfällen und Gegenangriffen Bezug zu nehmen, die mindestens bis in die späte Bronzezeit zurückreicht. In der Tat ist es von Bedeutung, daß Keïla in den Amarna-Briefen explizit als eine Stadt erwähnt wird, die heiß umkämpft war zwischen Schuwardata von Gat und Abdi-Hepa von Jerusalem. Schuwardata griff das Dorf an (in den Amarna-Briefen Qiltu oder Qeltu genannt), das er als seinen Besitz ansah. In einem der Briefe Schuwardatas heißt es: «Ich muß nach Qeltu [gegen] die V[erräter] ziehen» – vielleicht eine Andeutung, daß auch einheimische Apiru (auf der Seite von Abdi-Hepa) an den Auseinandersetzungen beteiligt waren. Die biblische David- Geschichte, die rund vierhundert Jahre später in derselben Region und unter denselben Bedingungen spielte, wird auf ähnliche Weise erzählt: Die Verteidigung Keïlas übernimmt eine Bande bewaffneter Männer, die die Angreifer zurückschlagen und anstelle einer ohnmächtigen Zentralregierung auf eigene Faust handeln. Daß Apiru so häufig als Söldner angeheuert wurden, unterstreicht, daß sie sich keiner politischen Macht verpflichtet fühlten. Im Falle Davids könnte dies gar nicht deutlicher zum Ausdruck kommen. Die aggressive und mächtige Philisterstadt Gat stellte für die Bewohner des Berglands eine stete Bedrohung dar; Gats Herrscher Achisch war deren Erzfeind. Dennoch heißt es in der Bibel, daß David zweimal auf dem Territorium der Philister Zuflucht suchte. Einmal (1 Sam 21,10–15), als er allein in Gat auftaucht und vergeblich um Aufnahme bittet. Das zweite Mal wird David zum Verbündeten der Philister und erhält ein Stück Land als Lehen, von dem aus er nichtphilistäisches Territorium überfallen und ausplündern kann: Und David machte sich auf und zog hin mit den sechshundert Mann, die bei ihm waren, zu Achisch, dem Sohn Maochs, dem König von Gat. Und David blieb bei Achisch in Gat mit seinen Männern … Und David sprach zu Achisch: Hab ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so mag man mir einen Wohnort geben in einer der Städte auf dem Lande, daß ich darin wohne; warum soll dein Knecht in der Königsstadt bei dir wohnen? Da gab ihm Achisch an diesem Tage Ziklag … David zog hinauf mit seinen Männern und fiel ins Land der Geschuriter und Girsiter und Amalekiter ein; denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes … Und sooft David in das Land einfiel, ließ er weder Mann noch Frau leben und nahm mit Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte wieder zurück. (1 Sam 27,2–9) An einer anderen Stelle schrecken David und seine Bande nicht davor zurück, ihr eigenes Volk auszuplündern. David schickt zehn seiner Männer zu Nabal, einem reichen judäischen Herdenbesitzer im Dorf Karmel, um ihn an den Schutz zu «erinnern», den seine Männer Nabals Schafherden und Scherern gewährt hatten, und im Gegenzug von ihm das zu verlangen, was er «zur Hand» hat. Nabals wütende Antwort an David hätte schroffer nicht sein können – und bildet eine aufschlussreiche Parallele zu dem Apiru-Phänomen: Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? (1 Sam 25,10 f.) Seine aufrichtige Empörung nutzte Nabal nichts. Da sprach David zu seinen Männern: Gürte sich ein jeder sein Schwert um! Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um, und etwa vierhundert Mann zogen ihm nach, aber zweihundert blieben bei dem Troß. (1 Sam 25,13) Der Bibel zufolge erhielt David seinen Tribut, Nabal fand den Tod, und David nahm dessen Witwe, die schöne Abigajil, zur Frau. Diese Ereignisse könnten sich genauso zugetragen haben; zumindest beschreiben sie eine Situation, wie sie im südlichen Bergland zwischen Dorfnotabeln und Banditen oft zu beobachten war. Erhellend ist die Geschichte allemal. Ebenso der Hinweis, daß David eine längerfristige Strategie verfolgte und sich nicht auf einzelne Gewaltakte und Plünderungen beschränkte. Nach seinem Triumph in Keïla wurde er von den Dorfbewohnern als Beschützer und Rächer gefeiert und willkommen geheißen. Nach seinem großen Sieg über die Amalekiter bot er den Ältesten im Bergland von Juda, die ihn unterstützt oder ihm Unterschlupf gewährt hatten, großzügig einen Teil seiner Beute an (1 Sam 30,26–31). Es überrascht nicht, daß diese Ältesten bei ihrer Versammlung in Hebron kurze Zeit später David zum «König» von Juda bestimmten. Von einem Nobody und Banditen wurde David somit zum anerkannten Führer des dünn besiedelten südlichen Berglands. Doch Hebron war seit jeher nur die zweitwichtigste Stadt in Juda. Kein Wunder, daß die biblische Geschichte berichtet, David habe schon bald Jerusalem ins Auge gefaßt, die strategische Schlüsselposition für die Beherrschung des gesamten südlichen Berglands. Vom Banditen zum Stammesführer Der Aufstieg eines Apiru-Rebellen zu politischer Macht war keineswegs ungewöhnlich. Die Amarna-Briefe enthalten zahlreiche Hinweise darauf, daß lokale Herrscher, besonders im Bergland, aus den Reihen der Apiru hervorgingen. Abdi-Hepa verwendet zwar in seinen Briefen den Ausdruck «Apiru» in abschätzigem Sinne, aber wahrscheinlich schloß er sich selbst mit diesen Gruppen gegen die Städte im Tiefland zusammen, wenn es seinen Interessen diente. Und es ist durchaus möglich, daß Abdi-Hepa selbst aus den Reihen der Apiru zur Macht aufstieg. In den Nachbarregionen gibt es Beispiele für einen derartigen Aufstieg. Im Norden des Libanon-Gebirges nahe der heutigen syrisch-libanesischen Grenze dehnten die beiden Stammesführer Abdi-Aschirta und Aziru, Vater und Sohn, ihren Einfluß immer weiter aus – von ihrem kleinen, entlegenen Berglanddorf zu den Gebirgsausläufern und weiter in die Küstenebene unweit des heutigen Tripolis im Norden Libanons. Zunächst eroberten sie einen lokalen Stadtstaat, dann einen ägyptischen Verwaltungssitz. Sie errichteten den einflußreichen Staat Amurru, der sich über ein großes Territorium mit Berg- und Küstenlandschaften erstreckte. Wenige Generationen später, im 13. Jahrhundert v. Chr., war dieser Staat stark genug, das Machtgleichgewicht zwischen dem ägyptischen und dem hethitischen Reich zu beeinflussen. Ein weiteres Beispiel – näher an Juda gelegen – ist die Stadt Sichem im nördlichen Bergland mit ihrem Herrscher Labaja. Dank Verschwörungen und politischen Manövern erlangte Labaja bald die Herrschaft über einen großen Teil des Landes: von Geser und Jerusalem im Süden bis in die Jesreel-Ebene und weiter nach Norden. Die Amarna-Briefe beschreiben seine Bemühungen – möglicherweise in Zusammenarbeit mit Apiru-Gruppen –, in die Jesreel-Ebene vorzudringen und Territorien der Stadtstaaten dieser Region, darunter Megiddo, in seine Gewalt zu bringen. Seine Strategie blieb jedoch ohne Erfolg. Er wurde als Verbrecher geächtet und von den benachbarten Herrschern im Auftrag des ägyptischen Oberherrn gefangengenommen und getötet. Leider läßt sich die politische Situation im südlichen Bergland in jenen vierhundert Jahren, die zwischen Abdi-Hepa im 14. und Davids mutmaßlichem Wirken im 10. Jahrhundert v. Chr. liegen, nicht im einzelnen rekonstruieren. Es gibt nur wenige und bruchstückhafte ägyptische Textquellen. Der Bibel zufolge wurde zur Zeit von Davids Eroberungszug Jerusalem von den Jebusitern beherrscht. Wir wissen nichts über dieses Volk und seine Epoche oder darüber, wie sie an die Macht gekommen waren, doch archäologischen Befunden zufolge waren die Siedlungsstrukturen dieselben wie in der Amarna-Zeit. In Jerusalem gibt es aus der frühen Eisenzeit (Ende 12. Jahrhundert – um 900 v. Chr.) substantiellere Relikte als aus der späten Bronzezeit, was vielleicht darauf hindeutet, daß Abdi-Hepas Bergdorf allmählich größer wurde. Ausgrabungen am Osthang der Davidsstadt oberhalb der Gihon-Quelle legten ein System von Steinterrassen frei, die wahrscheinlich als Unterbau für eine Festung oder sogar einen Palast dienten. Wir wissen jedoch nicht, ob diese Entwicklung unter Abdi-Hepa und seiner Dynastie oder unter neuen Herrschern einsetzte, die inzwischen die Macht an sich gerissen hatten. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die früheisenzeitlichen Herrscher Jerusalems zu den biblischen Jebusitern standen. Außerhalb Jerusalems aber änderte sich wenig. Das südliche Bergland blieb weiterhin dünn besiedelt, auch wenn die Zahl der Siedlungen leicht stieg. Alles in allem dokumentierten archäologische Oberflächenuntersuchungen die Existenz von rund zwanzig früheisenzeitlichen Siedlungen im südlichen Bergland. Ihre seßhafte Bevölkerung wird auf wenige tausend geschätzt, hinzu kommen marodierende Banden und die großen Hirtengemeinschaften. Was besagen nun alle diese Befunde für die Rolle Davids? Das übliche Banditenwesen stand für eine sprunghafte Lebensführung, die sich die inneren Spannungen und Ungleichheiten der Gesellschaft in willkürlicher und brutaler Weise zunutze machte. Manchmal jedoch führte der Machtzuwachs eines Apiru-Führers zu einem dauerhaften Machtwechsel. Dann übernahm ein einflußreicher oder erfolgreicher Banditenchef selbst die Herrschaft in einer Region. Ob die biblische Geschichte von Davids kühner Eroberung des jebusitischen Jerusalem einen historischen Kern besitzt oder nicht, bleibt dahingestellt. Jedenfalls erkennen wir hier ein bekanntes Muster des Machtwechsels im Vorderen Orient. Durch die Jahrhunderte war Jerusalem nicht nur die bedeutendste Festung des südlichen Berglands, sondern auch kultischer und politischer Mittelpunkt eines traditionellen dimorphen Stammesverbands, welcher über das gesamte südliche Bergland verstreut lebte. Die geringfügige Zunahme der Bautätigkeit im früheisenzeitlichen Jerusalem läßt sich nur schwer mit den in der Bibel geschilderten Vorgängen in Einklang bringen. Ob die Terrassen und anderen Baumaßnahmen am Osthang der Davidsstadt als Unterbau für eine Zitadelle dienten, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wir wissen nicht einmal, wann genau in den ersten eisenzeitlichen Jahrhunderten diese Bauarbeiten stattfanden. Fest steht nur, daß zu irgendeinem Zeitpunkt die Nachfolger und Nachkommen Davids Jerusalem zu ihrer Hauptstadt machten. Die Insignien von Davids neuer Herrschaft waren wohl eher bescheiden. Das politische Alltagsgeschäft lag in den Händen der Clans im Bergland und wurde durch persönliche Begegnungen und soziale Interaktion abgewickelt. Und mündlich erzählte Geschichten spielten eine entscheidende Rolle, damit sich David auch weiterhin der Unterstützung durch die Bewohner des südlichen Berglands sicher sein konnte, nachdem er von ihrem gelegentlichen Beschützer zu ihrem dauerhaften Oberhaupt geworden war. S. 44 - 50; Copyright Verlag C.H.Beck oHG |
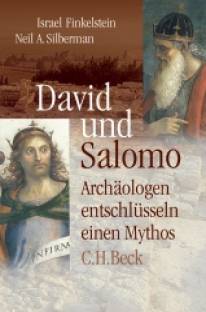
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen