|
|
|
Umschlagtext
Das vorliegende Buch widmet sich der Geschichte des Herforder Reichsstiftes, der ältesten geistlichen Gemeinschaft auf sächsischem Boden. Darüber hinaus geht es um die Stiftsfreiheit, die Keimzelle Herfords, die als geistlich-religiöses und zeitlich eingeschränkt auch als herrschaftliches Zentrum der Stadt galt. Das Buch besteht aus zwei sich einander ergänzenden Teilen. Ulrich Andermann untersucht den Gegenstand aus dem Blickwinkel der Geschichtswissenschaft, Fred Kaspar aus dem der Volkskunde und Baugeschichte. Sie eröffnen damit verschiedene Perspektiven und beleuchten eigene Aspekte der Stiftsgeschichte. Während der Historiker bei den Anfängen der Frauengemeinschaft zum Ende des 8. Jahrhunderts beginnt, beschreitet der Denkmalpfleger und Konservator den umgekehrten Weg. Vom Ende des Stiftes ausgehend, versucht er, zeitlich stufenweise zurückzugehen und auf diese Weise die Topografie wie Bau- und Besitzgeschichte der Stiftsfreiheit zu rekonstruieren. Die unterschiedlichen Zugänge der Autoren führen zum Teil zu abweichenden Erkenntnissen und decken damit offene Forschungsfragen auf. Dies betrifft insbesondere die Frage, wann die Stiftsfrauen in Herford das gemeinsame Leben im Konvent aufgegeben haben, was sich strukturell auf das Stiftsleben auswirken musste. Der unterschiedliche Zugriff auf das Thema erweitert zudem die Erkenntnismöglichkeiten: So lassen sich etwa die weitreichenden Folgen der Reformation kaum in den überlieferten Archivzeugnissen erkennen, erweisen sich hingegen in der Entwicklung der Freiheit und ihrer Bauten als prägend.
Dr. phil. habil. Ulrich Andermann lehrt als apl. Professor Geschichte des Mittelalters an der Universität Osnabrück. Seine bisherigen Arbeitsgebiete liegen in der mittelalterlichen Rechtsgeschichte und in der Forschung zum niederdeutschen Humanismus. Seit 1989 publizierte er zu der Herforder Tochtergründung, dem Stift in Bielefeld-Schildesche. Dr. phil. Fred Kaspar war bis 2018 als Bauhistoriker und Oberkonservator bei der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Mitglied der Volkskundlichen Kommission sowie der Altertumskommission für Westfalen und des Kuratoriums für vergleichende Städtegeschichte. Rezension
Die Entstehung und Geschichte der ostwestfälischen Stadt Herford (etymologisch von: "Heer" und Furt") ist eng mit der Geschichte des Herforder Reichsstiftes, der ältesten geistlichen Gemeinschaft auf sächsischem Boden, verknüpft; hier liegt die Keimzelle der späteren Stadt, die heute eine große kreisangehörige Stadt mit ca. 67.000 Einwohnern im ostwestfälischen Verdichtungsgebiet darstellt, das sich von Gütersloh über Bielefeld und Herford bis Minden erstreckt. Das um 800 errichtete Frauenstift Herford wurde bald nach seiner Gründung in den Stand einer Reichsabtei erhoben und erlangte im 12. Jahrhundert die Reichsunmittelbarkeit, die das Stift bis 1803 bewahren konnte. Dadurch entwickelte sich die Stadt Herford im Mittelalter zu einer bedeutenden, stark befestigten Handelsstadt Westfalens und trat 1342 der Hanse bei. Um 800 entstand das bedeutende Frauenstift Herford; im Jahre 823 unterstellte Kaiser Ludwig der Fromme das Kloster seinem persönlichen Schutz und verband es eng mit dem Kloster Corvey. Der hier anzuzeigende Band beleuchtet die Entstehung des Herforder Stifts in doppelter Perspektive: aus der Sicht des Historikers, der vom Beginn her kommt, und aus der Sicht des Denkmalpfegers, der vom jetzigen Endzustand her ausgeht. Dadurch entstehen spannende, z.T. kontroverse Beobachtungen.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Erster Teil Ulrich Andermann Entwicklung, Ansprüche und Wirklichkeit des Herforder Kanonissenstiftes I. Einführung 15 II. Waltgers Gründung — Die Anfänge Herfords 25 1. Wiederholte Gründungsversuche und der archäologische Befund 26 2. Bedeutung der Aachener Reichssynode von 816 33 3. Stift oder Kloster Herford? 34 III. Das Herforder Stift: Rechtsstellung — Personal — Raumkonzept 41 1. Entwicklungsstufen der Stiftsfreiheit 41 1.1. Begründung des Immunitätsbezirkes 41 1.2. Neubeginn des Stiftes in Folge der Ungarneinfälle von 926 45 1.3. Der Kirchneubau und die Aufhebung der Klausur im 13. Jahrhundert 48 1.4. Weitere Veränderungen 51 2. Die Rechtsverhältnisse des Reichsstiftes 53 2.1. Die Grundherrschaft 54 2.2. Reichsstift, Reichsfürstenstand und Vogtei 55 2.3. Verhältnis zu Papst und Bischof 59 2.4. Die Äbtissin als Stadtherrin 63 3. Konventsmitglieder und Stiftsangehörige 67 4. Das Raumkonzept zwischen Norm und Wirklichkeit 73 4.1. Das Münster als Stifts- wie Pfarrkirche und seine Kapellen 74 4.2. Abtei- und Konventsgebäude 79 4.3. Wohngebäude der Stiftskleriker 85 4.4. Wohngebäude der Ministerialen 87 4.5. Das Hospital 88 4.6. Die Stiftsschulen 90 4.7. Die Gerichtsstandorte des Stiftes 91 4.8. Sonstige Gebäude in der Stiftsfreiheit 94 IV. Stift Herford zwischen Anspruch und Wirklichkeit 97 1. Herford ein hochadliger Stiftskonvent 99 2. Konfessionelle Konformität? 107 3. Aspekte stiftischen Lebens 111 3.1. Bibliotheken und Buchlektüre 112 3.2. Nahrungswesen und Essgewohnheiten 116 3.3. Kleidung der Kanonissen und Äbtissinnen 118 3.4. Alltag im Stift — Soziale Kontakte — Reisen 122 4. Das Nichtalltägliche: Rituale bei Investitur, Wahl und Inthronisierung 127 5. Der geistliche Bedeutungsverlust des Stiftes 133 5.1. Präsenz der Kanonissen und Wochenherren 134 5.2. Alter der Kanonissen 140 5.3. Das Phänomen der Pfründenhäufung 144 6. Geistliche Kommunität oder Versorgungsanstalt? 145 7. Wirtschaftlicher und politischer Bedeutungsverlust 154 V. Zusammenfassung 165 Zweiter Teil Fred Kaspar Die Freiheit Herford. Topografie, Bau- und Besitzgeschichte I. Fragestellung, Ziele und methodisches Vorgehen 179 II. Spurensuche 185 1. Das langsame Ende 1802-1810 185 2. Das Pusinnastift 1804-1810 188 3. Die Abtei Herford 189 3.1. Die Wirtschaft der Abtei und der Sundern 190 3.2. Die Verwaltung von Abtei und Reichsstift 192 3.3. Auflösung der Abtei: Verkauf der Bauten und Verbleib des Archivs 197 3.4. Wirtschaftlicher Zustand und Erfassung der Einkünfte 200 4. Die Reichsabtei als historisches Phänomen und Zeugnis 207 5. Historische Kenntnis, Grundlage von Erhaltungsbestrebungen 209 III. Was blieb? 227 1. Lesen im Stadtgrundriss: Binnenborg, Hagen, Gräben und Mauern 228 1.1. Binnenborg und Hagen 230 1.2. Immunität und Alter Markt 233 1.3. Ab 1256: Die Freiheit in der Stadt 236 2. Topografische Befunde als Zeugnis innerer Struktur des Stiftes 239 3. Klaustrum und Kanonissenkurien 240 IV. Bauten und Strukturen 249 1. Die Äbtissin und die symbolischen Orte ihrer Macht 249 1.1. Lage und Grundstück der Abtei 249 1.2. Bau- und Nutzungsgeschichte der Abtei 252 1.3. Die Stiftsmobilien 253 1.4. Eine erste „Abtei" am Klaustrum (bis 1300)? 255 1.5. Die alte Abtei ab etwa 1300 256 1.6. Von der Hauskapelle zur Kanzlei 257 1.7. Gestalt und Nutzung der Abtei 260 1.8. Von der katholischen Abtei zum evangelischen Abteischloss 263 1.9. Das Abteischloss ab 1729 268 1.10. Die Aula der Abtei, zentraler Ort weltlicher Macht 272 1.10.1. Lage, Gestalt und Einbindung der Herforder Aula 277 1.10.2. Bildprogramme als Instrument weltlicher Herrschaft 282 1.11. Abteigarten und Wirtschaftshof 283 1.12. Vom Abteischloss zur Fabrik 285 2. Kurienhöfe der Stiftsfrauen 289 2.1. Entstehung, Struktur und Lage 289 2.2. Gestalt und Aufbau der Kanonissenhäuser 295 3. Wohnhöfe der Geistlichen 300 3.1. Entstehung, Struktur und Lage 300 3.2. Gestalt und Aufbau der Priesterhäuser 305 3.3. Das evangelische Pfarrhaus 308 4. Vikarien und ihre Häuser 310 4.1. Entstehung, Struktur und Lage 310 4.2. Gestalt und Aufbau der Vikarienhäuser 312 5. Höfe der Dienstmannen 314 5.1. Entstehung, Struktur und Lage 314 5.2. Gestalt und Aufbau der Dienstmannenhäuser 316 6. Wohnungen der Kirchenbediensteten 321 7. Der Kaland 326 7.1. Geschichte des Kalands 326 7.2. Kalandhof und Kalandhaus 328 8. „Bürgerhäuser" in der Freiheit 329 9. Die Reformation und ihre Auswirkungen auf die Freiheit ab 152o 333 10. Neustrukturierung der Freiheit seit dem späten i6. Jahrhundert 338 11. Beamtenwohn- und Dienstgebäude 346 11.1. Rezepturen 347 11.2. Kanzleiräte 354 V. Ergebnisse 361 Anhang 371 Abkürzungen 371 Anmerkungen 373 Erster Teil 373 Zweiter Teil 391 Personallisten 417 I. Kanonissen des 17. Jahrhunderts 417 II. Kanonissen des 18. Jahrhunderts 418 III. Wochenherren (hebdomadarii) seit 1255 419 Quellenverzeichnis 422 I. Archivalien 422 II. Gedruckte Quellen 423 Literaturverzeichnis 425 Abbildungsverzeichnis 444 Ortsregister zu Herford 449 Personenregister 455 |
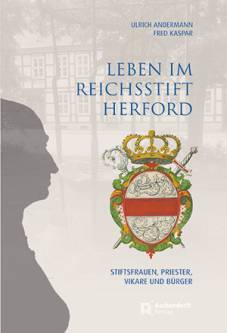
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen