|
|
|
Umschlagtext
Café Marx: So nannten Freunde wie Feinde das Institut für Sozialforschung flapsig. Und tatsächlich liegen die Anfänge der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule in einer Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Philipp Lenhard erzählt auf einer breiten Quellengrundlage die Geschichte der Personen, Netzwerke, Ideen und Orte, die das Institut geprägt haben und ihrerseits von ihm geformt wurden. So wird anschaulich greifbar, warum die Frankfurter Schule wie keine zweite die großen intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts bestimmt hat.
Rezension
Die Frankfurter Schule gehört zu den wirkungsmächtigsten philosophischen und soziologischen Richtungen des 20. Jahrhunderts. Hervorgegangen ist sie aus dem 1924 in Frankfurt eröffneten Institut für Sozialforschung (IfS), das man zu der Zeit „Café Marx“ nannte. 1933 wurde das Institut von den Nationalsozialisten geschlossen, worauf fast alle seine Mitglieder in die USA ins Exil gingen, wo sie an dem an die New Yorker Columbia University verlagerten Institute for Social Research wirkten. 1950 wurde das Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main wiedereröffnet. Als Hauptvertreter und Gründungsväter der ersten Generation der Frankfurter Schule gelten u.a.: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock und Franz L. Neumann.
Gegenwärtig erfährt die ältere Kritische Theorie im sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskurs eine Renaissance, die durch die Edition nachgelassener Schriften und Vorträge ihrer Protagonisten flankiert wird. Als Schlüsselkategorien der ersten Generation dieser sozialphilosophischen Richtung gelten u.a. die Begriffe „gesellschaftliche Totalität“, „verwaltete Welt“, „Dialektik“, „Widerspruch“, „Entfremdung“, „Ideologiekritik“ und „Kulturindustrie“. Eine umfassende Darstellung des Instituts für Sozialforschung von seinen Anfängen bis zum Tode von Horkheimer im Jahr 1973 liefert Philipp Lenhard (*1980) in seiner monumentalen Studie „Café Marx“, erschienen bei C.H. Beck. Dem Professor für Geschichte und Deutsch an der University of California, Berkeley, gelingt aufgrund von Primärstudien eine differenzierte Konstellationsanalyse des Instituts. Dabei berücksichtigt er nicht nur dessen Hauptprotagonisten, sondern auch andere soziale Gruppen der gesellschaftlichen Einrichtung. In seiner gut verständlich geschriebenen Darstellung räumt Lenhard mit in der Öffentlichkeit verbreiteten Mythen zur Institutsgeschichte auf. Die Wurzeln des IfS liegen in ersten Treffen im Ersten Weltkrieg. Die verbreitete Behauptung, Adorno und Horkheimer hätten gegenüber Erich Fromm eine persönliche Abneigung besessen und ihn deswegen aus dem Institut gedrängt, widerlegt Lenhard mit Verweis auf die klaren inhaltlichen Differenzen zwischen Fromms neopsychoanalytischer Sozialphilosophie und der materialistischen Sozialphilosophie von Horkheimer und Adorno. Sehr gut werden von dem Historiker auch die Differenzen zwischen dem Kreis um den Wissenssoziologen Karl Mannheim und dem Kreis um Horkheimer herausgearbeitet. Beide Kreise trafen sich im gleichen Frankfurter Café, im Café Laumer, und begegneten sich aufgrund politischer Gegensätze mit „schwelender Spannung“. Jedes Kapitel seines in einer gut verständlich verfassten Sprache geschriebenen Buches leitet Lenhard mit einer historischen Szenerie ein. Besondere Erwähnung verdient auch seine ausführliche Darstellung der ersten Ausgabe der „Zeitschrift für Sozialforschung“ aus dem Jahre 1932, welche sich dem Thema „Krise“ widmete. Die Hefte des Organs des Instituts für Sozialforschung enthielten neben wissenschaftlichen Beiträgen einen ausführlichen Rezensionsteil. Lehrkräfte der Fächer Philosophie, Ethik und Politik werden durch das umfangreiche Buch des Historikers aufgefordert, sich im Unterricht mit den Originalschriften der Kritischen Theorie auseinanderzusetzen, etwa bei Problemfeldern wie Psychopolitik, Postdemokratie, Entfremdung des Menschen und Rechtsradikalismus. Fazit: Philipp Lenhard ist mit seiner monumentalen Monographie „Café Marx“ ein Meisterwerk der Institutionengeschichtsschreibung gelungen, welches die Aktualität der sozialphilosophischen Reflexionen der älteren Kritischen Theorie angesichts der Panökonomisierung der Lebensbereiche im digitalen Kapitalismus unterstreicht. Das Buch lädt dazu ein, die Schriften der Gründungsgeneration des Instituts für Sozialforschung (wieder) zu lesen. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Lenhard, Philipp Café Marx Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule. Café Marx: So nannten Freunde wie Feinde das Institut für Sozialforschung flapsig. Und tatsächlich liegen die Anfänge der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule in einer Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Philipp Lenhard erzählt auf einer breiten Quellengrundlage die Geschichte der Personen, Netzwerke, Ideen und Orte, die das Institut geprägt haben und ihrerseits von ihm geformt wurden. So wird anschaulich greifbar, warum die Frankfurter Schule wie keine zweite die großen intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts bestimmt hat. Von Anfang an war das 1924 eröffnete Institut für Sozialforschung etwas Besonderes. Seine Wurzeln liegen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und auf den Barrikaden der Revolution. Der kommunistische Unternehmersohn Felix Weil ermöglichte die Gründung einer neuartigen Forschungsinstitution, die Arbeiter und Studenten, Politiker und Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle anzog. Besonders war auch, dass das Institut nach 1933 trotz Schließung, Verfolgung und Exil seine Arbeit fortsetzen konnte. In Kalifornien entstanden Schlüsselwerke wie die «Dialektik der Aufklärung». Philipp Lenhard geht der Entstehung der Kritischen Theorie in der amerikanischen Emigration nach und beleuchtet ihre Entwicklung zur Frankfurter Schule in der frühen Bundesrepublik. Das Buch schildert konzis, anschaulich und voller überraschender Erkenntnisse, in welchem historischen Kontext Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin und viele andere zu Schlüsseldenkern des 20. Jahrhunderts wurden. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7
I . Ein marxistisches Institut entsteht (1918–1924) 1. Lazarett und Schützengraben: Das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Linke 15 2. Auf der Barrikade: Das Scheitern der Revolution und die Erneuerung des Marxismus 29 3. Zwischen den Institutionen: Die Gründung des Instituts für Sozialforschung 45 4. Im Bahnhofshotel: Die marxistische Linke im Krisenjahr 1923 63 II . Das «Café Marx» des Prof. Grünberg (1924–1930) 5. Eine Festung: Das Institut im deutschen Universitätssystem 85 6. In der Bibliothek: Geschlechterverhältnisse und soziale Hierarchien 102 7. Hausdurchsuchung: Das Sozialwissenschaftliche Archiv und die Marx-Engels-Verlagsgesellschaft 117 8. Im Seminarraum: Eine unorthodoxe Lehranstalt für Arbeiter, Studenten und Künstler 145 III . Unterwegs zur Kritischen Theorie (1930–1933) 9. Im Intérieur: Max Horkheimers engster Kreis 173 10. Auf der Couch: Das Frankfurter Psychoanalytische Institut 201 11. Im Kaffeehaus: Das Institut für Sozialforschung im Frankfurter Intellektuellenmilieu 214 12. Im Büro: Die Angestellten am Vorabend des Dritten Reiches 231 13. Auf der Flucht: Hitlers Machtübernahme und die Institutsschließung 248 IV . Ein Asyl für Obdachlose (1933–1949) 14. Am Genfer See: Internationalisierung und die Zeitschrift für Sozialforschung 269 15. In der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts: Die Pariser Zweigstelle und die Studien zu Autorität und Familie 303 16. Auf Morningside Heights: Flüchtlingshilfe und das Institute of Social Research 324 17. Im Konzentrationslager: Die Kritische Theorie und der Holocaust 344 18. Zwischen Atlantik und Pazifik: Antisemitismusforschung und die «Dialektik der Aufklärung» 372 V . Die Etablierung der «Frankfurter Schule» (1949–1973) 19. Unter Beobachtung: Die Rückkehr in die Bundesrepublik 433 20. Zwischen Ruinen: Der Wiederaufbau in Frankfurt 1951 458 21. Auf der Demonstration: Adorno, Habermas und die radikalen Studenten 489 VI . Nachleben (1973–2024) 22. (Nach-)Kritische Theorie: Verstreuung und das Erbe der Frankfurter Schule 527 Anhang Dank 534 Archive 535 Siglen und Abkürzungen 536 Anmerkungen 539 Bildnachweis 612 Personenregister 613 |
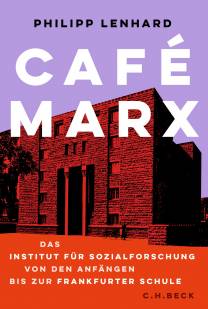
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen