|
|
|
Umschlagtext
Siehe Informationstext.
Rezension
„Mit dem Adler“(1918) von Paul Klee, „Eine seltsame Reise“(1943) von Wols, „Bilderbogen“(1951) von Hans Reichel, „Schleiertanz“(1959) von Otto Nebel, „Abandonné“(1982) von Hans Hermann Steffens, „La Magicienne“(2006) von Didonet. Was verbindet diese Gemälde miteinander? Diese Werke unterschiedlicher Kunstrichtungen können als Werke angesehen werden, welche der „Bild-Poesie“ zuordnenbar sind. Dazu zählen Gemälde des 20. Jahrhunderts, welche aufgrund von gemeinsamen strukturellen Merkmalen mit der modernen Lyrik als poetisch gelten.
Der „Bild-Poesie“ widmet sich die philosophische Dissertation „Bild-Poesie. Eine philosophisch-kunstwissenschaftliche Annäherung“ von Brigitte Descɶdres-Sutter. Erschienen ist ihre von Angelika Krebs betreute und mit zahlreichen Abbildungen versehene Arbeit im Michael Imhof Verlag. Die Doktorarbeit weist einen dreiteiligen Aufbau auf. Im ersten Teil geht es um den von der Autorin vertretenen Vernunftcharakter der Gefühle und deren Weltbezug, wobei sie sich u.a. auf philosophische Arbeiten von Max Scheler, Otto Friedrich Bollnow, Martha Nussbaum, Thomas Fuchs und Hartmut Rosa stützt. Im zweiten Teil der interdisziplinären Arbeit geht es um die philosophische Bestimmung der Bild-Poesie. In diesem elaboriert Descɶdres-Sutter differenziert Unterschiede zwischen Literatur, Bild-Kunst und Bild-Poesie anhand einzelner Kunstwerke und der Fachliteratur heraus. Im letzten Teil ihrer Forschungsarbeit werden von ihr Grundzüge einer „transhistorischen Bild-Poesie“ entworfen. Dabei nimmt sie u.a. Bezug auf Arbeiten von Meral Alma, Isabella Fürnkas. Rebecca Horn und Pedro Wirz. Ob „Bild-Poesie“ zu einem kunsthistorischen oder ästhetischen Grundbegriff avancieren wird, wird sich mit der Zeit zeigen. Jedenfalls hat Descɶdres-Sutter mit ihrer Monographie dazu gute Gründe geliefert. Die Forschungsarbeit richtet sich primär an Lehrende und Studierende der Philosophie, der Bildenden Künste und der Literaturwissenschaften. Aber auch Lehrkräfte der Fächer Bildende Kunst, Philosophie und Deutsch werden durch die vorliegende Arbeit motiviert, sich mit dem Verhältnis von Kunst und Poesie anhand ausgewählter Kunstwerke in ihrem Fachunterricht auseinanderzusetzen. Fazit: Brigitte Descɶdres-Sutters interdisziplinäre Arbeit „Bild-Poesie“ gibt einen hervorragenden Überblick über das Verhältnis von Kunst und Poesie. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Bild-Poesie – Eine philosophisch-kunstwissenschaftliche Annäherung Seit dem Beginn der Moderne gibt es Künstler, die mit Farben und Formen „Gedichte malen“ und damit am Rande der großen Kunstströmungen poetische Welten schaffen. Paul Klee oder Joan Miró verstanden ihre Bilder als Gedichte – Miró machte keinen rundlegenden Unterschied zwischen Malerei und Poesie. Der renommierte Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Jean-Christophe Ammann postuliert: „Kunst ist Poesie. Kunst war immer Poesie. Und die besten Künstler waren immer Poeten – alle anderen sind Handwerker.“ Erstaunlicherweise ist der Poesie-Begriff in der bildenden Kunst bisher nie Gegenstand einer Untersuchung geworden. Mit ihrer interdisziplinären Dissertation Bild-Poesie. Eine philosophisch-kunstwissenschaftliche Annäherung betritt Brigitte Descoeudres-Sutter Neuland. Jenseits von historischen Bezugnahmen – so die These – findet Bild-Poesie ihre permanente Aktualität gerade darin, dass sie über ihre Zeit hinausragend zu jeder Zeit als unzeitgemäß erscheint. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 8
Einleitung 10 Zum Einstieg 14 TEILI Vernunft der Gefühle - Problemstellung und philosophische Grundlagen 1. Einleitung: Über Gefühle in der Kunst sprechen 18 2. Das Problem der künstlerischen Moderne mit Schönheit, Gefühl und Stimmung 19 2.1. Die ästhetische Erfahrung19 2.2. Das Schöne am Pranger - Die Faszination für Dissonanz, Negation, Differenz 20 2.3. Vom Schattendasein des Gefühls in der Kunstästhetik der Moderne 21 2.4. Kitsch - Das Gespenst der bildkünstlerisch erweckten Gefühle 25 2.5. Fazit und Grundthese 30 3. Gefühle als Weisen unseres Weltbezugs 31 3.1. Ein relationales Konzept unserer geistigen Vermögen 31 3.2. Umfang und Qualitäten des Begriffs „Gefühl"32 3.3. Das Phänomen der Stimmungen35 3.4. Die Erfahrung unserer Umgebung und ihre affektiven Aspekte38 3.5. Abstrakte Stimmungsräume und unsere leiblichen Empfindungsvermögen 45 3.6. Fazit: Unser Weltbezug über mentale und vor-bewusst leibliche Vermögen 47 4. Das Bild und seine Ausdruckseigenschaften 48 4.1. Das ästhetische Resonanzereignis - Rezeption als Produktion 48 4.2. Gefühle als bildkünstlerische Praxis 50 4.3. Bildkünstlerischer Ausdruck zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion 52 4.4. Fazit: Das Bild-Werk als Resonanzsphäre58 5. Wissensproduktion durch Kunst und die Funktionen der Einbildungskraft58 5.1. Kunst als eigenständige Form von kognitivem Weltzugang59 5.2. Ein fruchtbarer Seitenblick auf die Literatur 60 5.3. Das Wissen von Bildern 62 5.4. Erkenntnisgewinn durch Bilder und die Rolle der Imagination 65 5.5. Fazit: Bild-Prägnanz und die integrative Kraft der Imagination 68 6. Die epistemische Kraft unserer affektiven Bild-Erfahrung68 6.1. Rückblick auf das Verhältnis von Intellekt und Gefühl 69 6.2. Dichterischer Ausdruck und seine Vermittlung von implizitem Wissen 70 6.3. Erkenntnis von Welt und Selbst in der emotionalen Kunsterfahrung 74 6.4. Anstelle eines Fazits: Ethische Dimension von ästhetischer Resonanz77 7. Ergebnisse von Teil I 78 TEIL II Was Bild-Poesie ist 1. Einleitung 82 1.1. Ein kleines Glossar der Begriffsverwendung 83 2. Lyrik der Moderne - Einige Besonderheiten 84 2.1. Begriffsklärungen und Minimaldefinition des lyrischen Gedichts 85 2.2. Kennzeichen des Dichterischen89 2.3. Verdächtige Pracht96 2.4. Dichtung und Dauer 98 2.5. Poesie zwischen Imagination, Sinnlichkeit und Gefühl 101 2.6. Dichtung und „göttliche Inspiration" 104 3. Bild-Poesie: Ein erster Einblick 106 3.1. Familienähnlichkeiten zwischen sieben beispielhaften Bildern 106 3.2. Der poetische Appell 106 3.3. Das dichterische Moment in Paul Klees Mit dem Adler107 3.4. Roger Bissieres Grande composition und ihre ausserweltlichen Klänge112 3.5. Otto Nebel, Eine sichtbare Musik für den Schleiertanz7114 3.6. Wols, Un voyage etrange: Verloren zwischen Ozean und Wüste 116 3.7. Hans Reichel, Bilderbogen verstaubter Erinnerungen 117 3.8. Hans-Hermann Steffens, Abandonne - Sublimierung des Vergangenen 118 3.9. Didonet, La magicienne: Verheissung des Unmöglichen 120 3.10. Zwei Gegenbeispiele aus der Moderne 122 3.11. Zwischenfazit: Gute Gründe für eine Anmutung „Bild-Poesie“ 124 4. Bild-Poesie zwischen Maler-Poeten und träumenden Rezipienten 125 4.1. Ut poesis pictura7 Ideengeschichte der These „Bild-Poesie“126 4.2. Bild-Poeten: Eine ideelle Gemeinschaft von Solitären 132 4.3. Fazit: Gemeinsames in der Unterschiedlichkeit 143 5. Künstlerbekenntnisse-Eine kritische Betrachtung 145 5.1. Maler-Dichter und Dichter-Maler 147 5.2. Vom „Dichter“ und anderen Künstlertopoi 150 5.3. Klee-Epigonen? 156 5.4. Fazit: Künstlerische Positur versus Dichternatur 159 6. „Zur Unzeit gegeigt..."? 160 6.1. Vom Zeitkern der Kunst 161 6.2. Aus ihrer Zeit gefallen - Die besondere Zeitlichkeit von Bild-Poesie 163 6.3. Ethische Aspekte 164 6.4. Das Romantische und das Poetische 166 6.5. Klee malte keine „romantischen“ Bilder171 6.6. Dichtung - Märchen - Traum als romantische Anklänge 178 6.7. Fazit: Keine Unzeit für Bild-Poesie 183 7. Ergebnisse von Teil II: Was, wie und wann Bild-Poesie ist 183 7.1. Wozu ein ideelles Konzept „Bild-Poesie“? 185 7.2. Rückblick in tabellarischen Vergleichen der Bild-Attribute rund um das Poetische 186 7.3. OffeneFragen 192 7.4. Als Hinführung zum dritten Teil 194 TEIL III Phänomenologie einer transhistorischen Bild-Poesie 1. Einleitung 198 2. Spielformen des Poetischen in der Malerei der Moderne199 2.1. „Gerhard Altenbourg, der Bild-Dichter“199 2.2. Joan Miro - Zwischen Dichtung und Malerei205 2.3. Die Launen des Poetischen 209 2.4. Das Poetische im Abseits211 2.5. Der Privatsammler als Freund, Kritiker und emotionaler Antrieb 217 2.6. Fazit: Eine vielgestaltige Einheit im Zeichen des Poetischen 219 3. Bildzeichen aus ferner Vergangenheit oder Die Autonomie des Poetischen 219 3.1. Der aufgeräumte Garten von Nebamun220 3.2. Bild im Dienste des Wortes 221 3.3. Zeigendes Verbergen des Undarstellbaren222 3.4. Eroberung der Wirklichkeit und Verlust des Nichtidentischen 223 3.5. Auf dem Weg zur Moderne - Neue Anzeichen des Poetischen 224 3.6. Fazit: Autonomie des Poetischen 226 4. Bild-Poesie im 21. Jahrhundert?227 4.1. Meral Alma - Kleine Universen in grossem Stil 228 4.2. Isabella Fürnkäs - Poesie im Chorgesang 230 4.3. Camille Henrot, Alloscendency oder Das eine durch das andere 232 4.4. Erfahrung von Poesie in Formen visueller Intermedialität233 4.5. Pedro Wirz - Naturethik durch Poesie und Schönheit 237 4.6. Unerreichbare Spiritualität im Schein von Poesie 241 4.7. Fazit: Vom poetischen Kleinod zur multimedialen und installativen Poesie243 5. Ergebnisse von Teil III - Vereinzelte Hinweise auf eine transhistorische Bild-Poesie 244 SYNTHESE 246 Anmerkungen zu Teil I-III 250 ANHANG I. Bibliographien 282 Bibliographie Teil I 282 Bibliographie Teil II 287 Bibliographie Teil III291 II. Dokumente 292 III. Abbildungsnachweis306 IV. Anstelle eines Registers: Ausführliches Inhaltsverzeichnis308 |
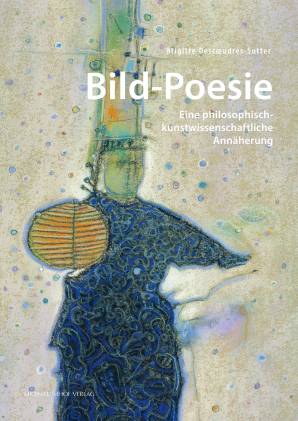
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen