|
|
|
Rezension
Hat der Mensch einen freien Willen oder ist er eine Marionette seines Gehirns? Das ist eine Frage, die seit den Behauptungen führender Neurobiologen in den Zeitungen und populären Zeitschriften vehement diskutiert wird. Auf der einen Seiten stehen die Leugner der Willensfreiheit wie die Neurobiologen Wolf Singer und Gerhard Roth sowie der Kognitionspsychologe Wolfgang Prinz, auf der anderen Seite halten Philosophen wie Jürgen Habermas, Peter Bieri, Michael Pauen, Ansgar Beckermann, Julian Nida-Rümelin an der Willensfreiheit des Menschen fest. Diesem kontroversen Thema widmet sich der neunzehnte Band der „Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. Main“ mit dem Titel „Beiträge zu einer aktuellen Anthropologie“ aus dem Jahre 2006. Nach dem Herausgeber des Buches, Hans-Rainer Duncker, Professor am Institut für Anatomie und Zellbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, gilt es die „Diskussion eines aktuellen, zureichenden Bildes vom Menschen unter Einbeziehung seiner sozialen, sprachlichen und kulturellen Fähigkeiten und Leistungen“ (S. 10) zu fördern. Der Sammelband widmet sich zwei großen Themenblöcken, zum einen der schon angesprochenen Kontroverse über Willensfreiheit und Hirnforschung und zum anderen den gegenwärtigen Menschenbildern einzelner Wissenschaftsdisziplinen. Dabei gibt es auch drei Abhandlungen zu Fragestellungen der philosophischen Anthropologie.
In der ersten, fast mehr als 100 Seiten umfassenden Abhandlung des Jubiläumsbandes gibt Duncker eine luzide Darstellung der Entwicklung des Menschen. Dabei kritisiert der Biologe die in der Öffentlichkeit verbreitete Auffassung, „dass der Mensch ein biologischer Organismus sei, der ausschließlich durch sein genetisches Material und epigenetische Entwicklungsmechanismen determiniert werde.“ (S. 84) Duncker betont gegenüber einer rein biologischen Sichtweise des Menschen die Bedeutung sozialer und kultureller Faktoren für die menschliche Entwicklung. Wolf Singer dagegen, Professor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main, legt in seinem Beitrag „Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung“ den Schwerpunkt auf die „neuronalen Grundlagen höherer kognitiver Leistungen“ (S. 130). Ausführlich erläutert der Hirnforscher seine Position des neuronalen Determinismus. Für Singer steht außer Frage, dass „der Entscheidungsprozess selbst auf deterministischen neuronalen Prozessen beruht.“ (S. 148). Demnach sei die Unterscheidung zwischen „gänzlich unfreien, etwas freieren und ganz freien Entscheidung“ aus neurobiologischer Perspektive „problematisch“ (Ebd.). „Keiner kann anders als er ist“, bringt Singer seine Ansicht auf den Punkt. Deswegen plädiert der Neurobiologe für eine Revision des gegenwärtigen Strafrechts, da dieses an der Vorstellung vom Menschen als freien verantwortlichen Entscheidungsträger festhält. Von der neurobiologischen „Einsicht verspricht sich Singer eine „humanere Betrachtungsweise“ (S. 148) von Menschen, die über ein Gehirn verfügen, „dessen funktionelle Architektur ihnen kein angepasstes Verhalten erlaubt.“ (S. 149) Gleichzeitig muss der Hirnforscher aber eingestehen, dass der Neurodeterminismus kaum etwas an der gegenwärtigen Praxis des Strafrechts ändern würde. Singers „naturalistischem Selbstverständnis“ des Menschen stellt Peter Janich, Professor für Philosophie an der Philipps-Universität Marburg, seinen kulturalistischen Ansatz gegenüber: „Auch die Naturwissenschaften vom Menschen werden vom Menschen hervorgebracht.“ (S. 169) Mit anderen Worten Janich legt das lebensweltliche bzw. kulturelle Fundament neurowissenschaftlicher Aussagen frei. Janich gelingt es mit seinem wissenschaftstheoretischen Ansatz, die philosophisch umstrittenen Prämissen von Singers und Roths neuronalen Determinismus aufzudecken. Gerhards Roths in zahlreichen Artikeln aufgestellte Forderung, Täter nicht mehr aufgrund von Schuld und Verantwortung zu bestrafen kritisiert Janich als eine „publizitätsorientierte Aktion“ (S. 171). Auch Klaus Lüderssen, emeritierter Professor für Rechtsphilosophie an der Frankfurter Universität, lehnt die von Roth und Singer geforderte Veränderung im Strafrecht mit Verweis auf die Gefahr der Entsubjektivierung des Menschen ab. Für Lüderssen bleibt Willensfreiheit Bedingung für moralische Verantwortungsfähigkeit des Menschen und damit für ein modernes Strafrecht. Für den Geschichts- bzw. Politikunterricht von Bedeutung ist zum Beispiel der Aufsatz „Das Menschenbild der Verfassung“ von dem Rechtshistoriker Michael Stolleis, in dem der Professor am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte die in der Deutschland verbreitete Tendenz kritisiert, „unsere Probleme auf die Verfassung zu projizieren und von den hoffnungslos überlasteten Verfassungsrichtern die Antwort zu fordern.“ (S. 377) Dieter Vail, Professor für Klinische und Physiologische Psychologie, weist in seiner Abhandlung über „Das Menschenbild der Psychologie“ darauf hin, dass „die Psychologie verpflichtet [ist], ihren Beitrag zu den Humaniora zu leisten.“ (S. 399) Fazit: Jeder Lehrkraft, die sich reflektiert mit der Willensfreiheitsdebatte auseinander setzen oder sich Grundlagenwissen über die Anthropologien einzelner Wissenschaftsdisziplinen aneignen möchte, kann der im „Franz Steiner Verlag“ erschienene Band „Beiträge zu einer aktuellen Anthropologie“ nur empfohlen werden. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Werner Thomas: Zum Geleit 7 Hans-Rainer Duncker: Vorwort 9 Hans-Rainer Duncker: Vorstellungen zu einer aktuellen Anthropologie aus biologisch-medizinischer Sicht 11 Wolf Singer: Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung. Zwei konfliktträchtige Erkenntnisquellen 129 Peter Janich: Die Sprache der Naturwissenschaften vom Menschen (mit einer Fallstudie als Anhang: Zwischen Selbsterfahrung und Neurobiologie – ein Kampf zweier Mythen?) 151 Klaus Lüderssen: Das Subjekt zwischen Metaphysik und Empirie. – Einfluss der modernen Hirnforschung auf das Strafrecht? 189 Arbogast Schmitt: Gehirn und Bewusstsein. Kritische Überlegungen aus geistesgeschichtlicher Sicht zum Menschenbild der neueren Hirnforschung 207 Karl Häuser: Zum Menschenbild in der Nationalökonomie 285 Lars Johanson: Menschenbilder in der Sprachwissenschaft 301 Herrmann Jungraithmayr: Grammatik und Wahrnehmung in afrikanischen Sprachen 343 Erika Simon: Anthropos. Der Mensch in der griechischen Bildkunst 353 Michael Stolleis: Das Menschenbild der Verfassung 369 Dieter Vaitl: Das Menschenbild der Psychologie 379 Reinhardt Brandt: Die pragmatische Anthropologie und die Selbstbestimmung des Menschen bei Kant 403 Mario Cattaneo: Anthropologie, Metaphysik, Moral und Recht 423 Dietrich Korsch / Cornelia Richter: Gottesbilder – Menschenbilder. Zur Transformation normativer Instanzen 427 Adressen der Autoren 443 |
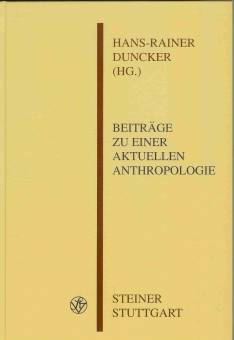
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen