|
|
|
Umschlagtext
Das Lehrbuch enthält eine integrierte Darstellung der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen. Dabei werden der Bau sowie die normalen und krankhaft veränderten Funktionen der Gewebe bzw. Organe nicht – wie üblich – getrennt, sondern in enger Verknüpfung miteinander behandelt. Diese fächerübergreifende Form der Darstellung soll dem Leser einen sinnvollen Zugang zu den medizinischen Grundlagenwissenschaften eröffnen und zugleich das Verständnis für Zusammenhänge fördern.
In einem Allgemeinen Teil werden die Grundlagen der Zell- und Gewebelehre, die Grundbegriffe der Pathologie sowie die für verschiedene Zellfunktionen wichtigen Transport- und Erregungsprozesse dargestellt. Der spezielle Teil behandelt den Bau, die normale Funktionen und die Funktionsstörungen der einzelnen Organe, wobei die Regulation im Dienste des Gesamtorganismus besonders berücksichtigt werden. Zwanzig Jahre nach dem ersten Erscheinen des auch ins Englische und Spanische übersetzten Lehrbuches liegt nun eine 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Fassung vor. Ohne Änderung der Gesamtkonzeption wurde der Inhalt dem heutigen Erkenntnisstand angepasst. 542 erstmalig mehrfarbige Abbildungen erleichtern das Verständnis des Textes. Rezension
Das Buch Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen von Thews, Mutschler und Vaupel beinhaltet neben den drei medizinischen Grundlagenfächern auch Themen aus anderen wissenschaftlichen Gebieten, wie aus der Biologie, der Biochemie und der Toxikologie.
Das Lehrbuch ist in einen allgemeinen Teil und einen speziellen Teil untergliedert. Der allgemeine Teil umfasst benötigte Grundlagen und soll einer Einführung in die medizinische Terminologie dienen. Im speziellen Teil werden dann die einzelnen Organe behandelt. Gerade der Abschnitt über den Zellstoffwechsel ermöglicht dem Leser, der nicht so sehr mit der Biochemie vertraut ist, einen Einblick in diese Wissenschaft und für Leser, die mit der Biochemie vertraut sind bietet der Abschnitt eine anschauliche kurzgehaltene Wiederholung. Neben dem Aufbau der Organe werden die Aufgaben und Funktionen der verschiedenen Geweben gemeinsam mit krankheit bedingten Veränderungen behandelt, was dem Leser einen guten Überblick ermöglicht. Der Zusammenhang einiger Texte wird durch anschauliche Abbildungen und Tabellen erleichtert. Durch die übersichtliche Gliederung ist das Lehrbuch auch bestens als Nachschlagewerk geeignet. Schlussbetrachtend ist zu sagen das das Lehrbuch Anatomie , Physiologie und Pathophysiologie von Thews, Mutschler und Vaupel eine Bereicherung für jeden wissenschaftlich Interessierten ist. Fehr, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Der Thews - Mutschler - Vaupel. Das große Standardwerk jetzt in 5. Auflage. Erstmals vierfarbig. Völlig neu bearbeitet und wieder erweitert. Die unverwechselbare integrierte Darstellung von Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Menschen. Ein modernes Konzept - auch 20 Jahre nach dem Erscheinen der Erstauflage. Wissenschaftlich fundiert. Frisch in der Darstellung. Unverändert geblieben sind- das didaktische Konzept der integrierten Darstellung der drei Fächer, d.h. die gemeinsame Darstellung des Baus sowie der normalen und krankhaft veränderten Funktionen von Geweben und Organen- die zahlreichen schlüssigen Definitionen wichtiger physiologischer und pathophysiologischer Begriffe- die übersichtliche und einheitliche Gliederung sowie- der klare Duktus, die einprägsame Darstellung und die gute Verständlichkeit des Textes. Neu sind - das den heutigen Erwartungen entsprechende, noch stärker als bisher visuell orientierte Layout- die vielen zusätzlichen, stets mehrfarbigen Abbildungen und Flußschemata- ein (aufgrund der wachsenden klinischen Bedeutung der Immunologie) spezielles Kapitel über Abwehr-mechanismen- die starke Erweiterung des pathophysiologischen Teils mit Darstellung einer Reihe von Krankheitsbildern, die in früheren Auflagen nicht berücksichtigt waren - die Einbeziehung wichtiger molekularbiologischer Erkenntnisse für die Ätiopathogenese von Erkrankungen sowie - die Aufnahme klinisch relevanter Referenz- bzw. Normalwerte. Fast von selbst versteht sich, daß sämtliche Kapitel aktualisiert und dem heutigen Wissensstand angepaßt wurden. Damit erscheint gewährleistet, daß auch die 5. Auflage - wie die vorangegangenen Ausgaben - die Erwartungen der Leser voll erfüllen, vermutlich diese sogar übertreffen wird. Inhaltsverzeichnis
1 Morphologie und Funktion der Zelle
1.1 Bestandteile der Zelle 1.1.1 Zellmembran und Zytoplasma 1.1.2 Zellorganellen 1.1.3 Zytoskelett 1.1.4 Zellfortsätze 1.1.5 Zelleinschlüsse 1.1.6 Zellkern 1.2 Zellteilung 1.2.1 Mitose 1.2.2 Endomitose und Amitose 1.2.3 Meiose 1.3 Stoffwechsel der Zelle 1.3.1 Molekulare Zellbestandteile 1.3.2 Biokatalysatoren 1.3.3 Stoffwechsel der Glukose 1.3.4 Stoffwechsel der Fettsäuren 1.3.5 Stoffwechsel der Aminosäuren 1.3.6 Proteinbiosynthese 1.4 Signaltransduktion 1.4.1 Signaltransduktion durch intrazelluläre Rezeptoren 1.4.2 Signaltransduktion durch membranständige Rezeptoren 2 Aufbau der Gewebe 2.1 Entwicklung der Gewebe 2.2 Epithelgewebe 2.2.1 Oberflächen- oder Deckepithelien 2.2.2 Drüsenepithelien 2.2.3 Sinnesepithelien 2.3 Bestandteile des Binde- und Stützgewebes 2.3.1 Zelluläre Bestandteile 2.3.2 Extrazellularsubstanz 2.4 Formen des Bindegewebes 2.4.1 Mesenchym und Gallertgewebe 2.4.2 Retikuläres Bindegewebe 2.4.3 Fettgewebe 2.4.4 Faserartiges Bindegewebe 2.5 Formen des Stützgewebes 2.5.1 Chorda- und Knorpelgewebe 2.5.2 Knochengewebe 2.5.3 Zahnzement und Dentin 2.6 Muskelgewebe 2.7 Nervengewebe 2.7.1 Nervenzellen 2.7.2 Aufbau der Nerven 2.7.3 Degeneration und Regeneration von Nervenfasern 2.7.4 Neuroglia 3 Grundzüge der Pathologie 3.1 Definitionen 3.2 Morphologische Anpassungsreaktionen 3.2.1 Atrophie 3.2.2 Hypertrophie 3.2.3 Hyperplasie 3.3 Zell- und Gewebeveränderungen 3.3.1 Zelleinlagerungen 3.3.2 Pigmentstörungen 3.3.3 Lysosomale Enzymdefekte 3.3.4 Amyloidosen 3.3.5 Zellalterung 3.3.6 Apoptose und Nekrose 3.4 Zellersatz 3.4.1 Regeneration 3.4.2 Metaplasie 3.4.3 Dysplasie 3.5 Exogene Noxen 3.6 Entzündung 3.6.1 Pathogenese der Entzündung 3.6.2 Akute und chronische Entzündungen 3.6.3 Entzündungsformen 3.7 Tumoren 3.7.1 Grundbegriffe der Tumorpathologie 3.7.2 Kanzerogenese 3.7.3 Proliferation von Tumorzellen 3.7.4 Immunologische Tumorüberwachung 3.7.5 Invasion Metastasierung 3.7.6 Folgen des Tumorwachstums 3.7.7 Tumortypisierung 3.8 Entwicklungsstörungen (Kyematopathien) 3.8.1 Gametopathien 3.8.2 Blastopathien 3.8.3 Embryopathien 3.8.4 Fetopathien 4 Transport- und Regelprozesse 4.1 Grundlagen des Stoff- und Flüssigkeitstransports 4.1.1 Stofftransport 4.1.2 Flüssigkeitstransport 4.2 Transport durch Membranen 4.2.1 Permeation 4.2.2 Transportproteine 4.3 Epitheliale Transportprozesse 4.3.1 Barrierefunktion der Epithelien 4.3.2 Resorption und Sekretion 4.4 Regelprozesse 4.4.1 Grundbegriffe der Regeltechnik 4.4.2 Physiologische Regelkreise 5 Erregungsprozesse 5.1 Erregung von Nerven- und Muskelzellen 5.1.1 Ruhepotential 5.1.2 Aktionspotential 5.1.3 Erregungsleitung und Informationsübertragung 5.2 Erregungsübertragung in Synapsen 5.2.1 Aufbau der chemischen Synapsen 5.2.2 Funktion der zentralen erregenden Synapsen 5.2.3 Funktion der zentralen hemmenden Synapsen 5.2.4 Synaptische Überträgerstoffe (Neurotransmitter) 5.2.5 Elektrische Synapsen 5.3 Erregungsauslösung an Rezeptoren (Sensoren) 5.3.1 Reiztransduktion und Erregungsbildung 5.3.2 Funktionseigenschaften der Rezeptoren 5.4 Reiz- und Wärmewirkung elektrischer Ströme 5.4.1 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten der elektrischen Reizung 5.4.2 Reizwirkung von Gleichströmen 5.4.3 Reizwirkung von Wechselströmen 5.4.4 Wärmewirkung hochfrequenter Wechselströme 6 Blut 6.1 Blutvolumen und Hämatokrit 6.1.1 Blutvolumen 6.1.2 Hämatoktritwert 6.2 Blutplasma 6.2.1 Plasmaelektrolyte 6.2.2 Plasmaproteine 6.2.3 Pathoproteinämien 6.2.4 Weitere Plasmabestandteile 6.3 Erythrozyten 6.3.1 Zahl und Morphologie der Erythrozyten 6.3.2 Erythropoiese 6.3.3 Lebensdauer und Abbau der Erythrozyten 6.3.4 Stoffwechsel der Erythrozyten 6.3.5 Osmotische Formveränderungen der Erythrozyten und Hämolyse 6.3.6 Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit 6.4 Hämoglobin 6.4.1 Aufbau des Hämoglobinmoleküls 6.4.2 Verbindungen des Hämoglobins 6.4.3 Spektrale Eigenschaften des Hämoglobins 6.4.4 Hämoglobinkonzentration im Blut und Färbekoeffizient 6.5 Anämien 6.5.1 Blutungsanämien 6.5.2 Anämien durch Störung der Hämoglobinbildung 6.5.3 Anämien durch Störung der Erythropoiese 6.5.4 Hämolytische Anämien 6.6 Polyzythämie und Polyglobulie 6.7 Leukozyten 6.7.1 Leukozytenkonzentration und Differentialblutbild 6.7.2 Granulozyten 6.7.3 Lymphozyten 6.7.4 Monozyten 6.7.5 Hämatopoietische Wachstumsfaktoren 6.7.6 Veränderungen der Leukozytenzahl 6.7.7 Leukämien (Leukosen) 6.7.8 Maligne Lymphome 6.8 Thrombozyten und Hämostase 6.8.1 Thrombozyten 6.8.2 Primäre Hämostase 6.8.3 Sekundäre Hämostase 6.8.4 Fibrinolyse 6.8.5 Gerinnungshemmung und Funktionsprüfungen 6.8.6 Störungen der Hämostase (hämorrhagische Diathesen) 6.8.7 Hyperkoagulabilität 7 Abwehrfunktionen, Pathogenese der Entzündung und Blutgruppen 7.1 Unspezifische Abwehr 7.1.1 Unspezifische humorale Abwehr 7.1.2 Unspezifische zelluläre Abwehr 7.2 Spezifische Abwehr 7.2.1 Lymphatische Organe 7.2.2 Antigene 7.2.3 Spezifische humorale Abwehr 7.2.4 Spezifische zelluläre Abwehr 7.2.5 Immunität und Immunisierung 7.3 Überempfindlichkeitsreaktionen 7.3.1 Antikörper-vermittelte Überempfindlichkeitsreaktionen 7.3.2 T-Lymphozyten-vermittelte Überempfindlichkeitsreaktionen 7.3.3 Transplantatabstoßung 7.4 Immuntoleranz und Autoimmunität 7.4.1 Immuntoleranz 7.4.2 Autoimmunkrankheiten 7.5 Immundefekte 7.5.1 Störungen der B-Lymphozyten-vermittelte Immunität 7.5.2 Störungen der T-Lymphozyten-vermittelte Immunität 7.5.3 Kombinierte Defekte 7.6 Abwehrmechanismen gegen Tumore 7.7 Pathogenese der Entzündung 7.8 Blutgruppen 7.8.1 AB0-System 7.8.2 Rhesus-System 7.8.3 Transfusionszwischenfälle 8 Herz 8.1 Anatomie des Herzens 8.1.1 Bau des Herzens 8.1.2 Gefäßversorgung des Herzens 8.1.3 Mikroskopische Anatomie des Herzens 8.2 Erregungsprozesse im Herzen 8.2.1 Erregungsbildung und Erregungsleitung 8.2.2 Aktionspotentiale 8.2.3 Elektromechanische Kopplung und Beeinflussung der Herzaktion 8.2.4 Ionale Einflüsse auf Erregung und Kontraktion 8.2.5 Nervale Beeinflussung der Herzaktion 8.2.6 Elektrokardiogramm (EKG) 8.3 Mechanik der Herzaktion 8.3.1 Klappenfunktion und Phasen der Herztätigkeit 8.3.2 Anpassung der Herzaktion 8.3.3 Signale der Herzaktion 8.4 Energetik der Herzaktion 8.4.1 Herzarbeit und Herzleistung 8.4.2 Blutversorgung und Energiegewinnung des Myokards 8.5 Pathophysiologie des Herzens 8.5.1 Herzrhythmusstörungen 8.5.2 Herzinsuffizienz 8.5.3 Kardiomyopathien (Myokardiopathien) 8.5.4 Angeborene Herzfehler 8.5.5 Erworbene Herzklappenfehler 8.5.6 Koronare Herzkrankheit 8.5.7 Pathologische EKG-Formen 9 Gefäßsystem und Blutkreislauf 9.1 Anatomie des Gefäßsystems 9.1.1 Aufgaben und Aufbau des kardiovaskulären Systems 9.1.2 Makroskopische Anatomie des Gefäßsystems 9.1.3 Wandaufbau der Blutgefäße 9.1.4 Mikrozirkulationsgefäße 9.1.5 Lymphgefäße und Lymphknoten 9.2 Gesetzmäßigkeiten der Strömung im Gefäßsystem 9.3 Funktionen des arteriellen Gefäßsystems 9.3.1 Dehnbarkeit und rhythmische Füllung des Arteriensystems 9.3.2 Arterielle Druck- und Strompulse 9.3.3 Drücke im arteriellen Gefäßsystem 9.4 Funktionen der terminalen Strombahn 9.4.1 Stoff- und Flüssigkeitsaustausch 9.4.2 Lymphdrainage und Ödementstehung 9.5 Funktionen des venösen Systems 9.5.1 Drücke im Venensystem 9.5.2 Venöser Rückstrom zum Herzen 9.6 Funktionelle Organisation des Gesamtkreislaufs 9.6.1 Verteilung des Blutvolumens 9.6.2 Widerstandsverteilung und Druckverlauf 9.6.3 Strömungsgeschwindigkeiten 9.7 Organdurchblutung und Durchblutungsregulation 9.7.1 Neuronale Kontrolle des Gefäßtonus 9.7.2 Myogene Autoregulation 9.7.3 Lokal-chemische und hormonale Durchblutungsregulation 9.7.4 Endothelvermittelte Durchblutungsregulation 9.7.5 Durchblutung spezieller Organe 9.8 Regulation des Blutkreislaufs 9.8.1 Mechanismen der kurzfristigen Blutdruckregulation 9.8.2 Mechanismen der mittelfristigen Blutdruckregulation 9.8.3 Mechanismen der langfristigen Blutdruckregulation 9.8.4 Zentrale Kontrolle des Kreislaufs 9.8.5 Kreislaufumstellungen 9.9 Störungen der Blutdruckregulation 9.9.1 Hypertonie 9.9.2 Hypotonie 9.9.3 Kreislaufschock 9.10 Pathophysiologie des Gefäßsystems 9.10.1 Arteriosklerose 9.10.2 Arterielle Durchblutungsstörungen 9.10.3 Mikrozirkulationsstörungen 9.10.4 Venöse Durchblutungsstörungen 9.10.5 Hämorrhoiden 10 Respirationstrakt und Atmung 10.1 Anatomie des Respirationstrakts 10.1.1 Anatomie des Thorax 10.1.2 Anatomie der Lunge und der zuleitenden Atemwege 10.2 Ventilation 10.2.1 Atmungsbewegungen von Thorax und Lunge 10.2.2 Lungen- und Atemvolumina 10.2.3 Ventilationsgrößen 10.2.4 Künstliche Beatmung 10.3 Atmungsmechanik 10.3.1 Elastische Atmungswiderstände 10.3.2 Visköse Atmungswiderstände 10.3.3 Atmungszyklus 10.4 Austausch der Atemgase 10.4.1 Zusammensetzung des alveolären Gasgemisches 10.4.2 Diffusion der Atemgase 10.5 Lungenperfusion und Arterialisierung des Blutes 10.5.1 Lungenperfusion 10.5.2 Arterialisierung des Blutes 10.6 Zentrale Rhytmogenese und Atmungsregulation 10.6.1 Rhytmogenese der Atmung 10.6.2 Chemische Kontrolle der Atmung 10.6.3 Reflektorische und zentrale Kontrolle der Atmung 10.7 Pathophysiologie des Respirationstrakts 10.7.1 Arterialisierungsstörungen 10.7.2 Obstruktive Ventilationsstörungen 10.7.3 Restriktive Ventilationsstörungen 10.7.4 Störungen der Lungenperfusion 10.7.5 Veränderungen des zentralen Atmungsantriebs 10.8 Atemgastransport des Blutes 10.8.1 Physikalische Löslichkeit der Atemgase 10.8.2 Hämoglobin-Sauerstoff-Bindung 10.8.3 Kohlendioxidtransport des Blutes 10.9 Gewebeatmung 10.9.1 Sauerstoffversorgung der Organe und Gewebe 10.9.2 Störungen der Sauerstoffversorgung 10.10 Höhenphysiologie 10.10.1 Akut-Reaktionen auf höhenbedingten O2-Mangel 10.10.2 Höhenakklimatisaton 11 Ernährung 11.1 Nährstoffe 11.1.1 Kohlenhydrate 11.1.2 Fette 11.1.3 Eiweiße 11.2 Vitamine 11.2.1 Fettlösliche Vitamine 11.2.2 Wasserlösliche Vitamine 11.3 Salze, Wasser, Spurenelemente 11.4 Ballast- und Gewürzstoffe 11.5 Energetische Aspekte der Ernährung 11.5.1 Nährstoffe als Energiequellen 11.5.2 Austauschbarkeit und umsatzsteigernde Wirkung der Nährstoffe 11.6 Ernährungsformen 11.6.1 Diätformen 11.6.2 Spezielle Ernährungsformen 11.7 Körpergewicht, Gewichtsreduktion und Essverhaltensstörungen 11.8 Anhang: Störung des Harnsäurestoffwechsels (Gicht) 12 Gastrointestinaltrakt 12.1 Allgemeine Grundlagen der gastroinstestinalen Funktionen 12.1.1 Enterisches Nervensystem 12.1.2 Vegetatives Nervensystem 12.1.3 Gastrointestinale Hormone 12.1.4 Gastrointestinale Motilität 12.2 Mundhöhle, Pharynx und Ösophagus 12.2.1 Anatomie von Mundhöhle, Pharynx, Ösophagus und Speicheldrüsen 12.2.2 Kauen 12.2.3 Speichelsekretion 12.2.4 Schluckakt 12.3 Magen 12.3.1 Anatomie des Magens 12.3.2 Reservoirfunktion des Magens 12.3.3 Durchmischung und Homogenisierung 12.3.4 Magenentleerung 12.3.5 Magensaftsekretion 12.4 Dünndarm 12.4.1 Anatomie des Dünndarms 12.4.2 Dünndarmmotilität 12.4.3 Dünndarmsekretion 12.5 Dickdarm 12.5.1 Anatomie des Dickdarms 12.5.2 Kolonmotilität 12.5.3 Darmkontinenz und Defäkation 12.5.4 Sekretion und bakterielle Besiedlung des Dickdarms 12.6 Leber und Gallenwege 12.6.1 Makroskopische Anatomie der Leber und der Gallenwege 12.6.2 Mikroskopische Anatomie der Leber und der Gallenwege 12.6.3 Sekretion der Lebergalle 12.6.4 Leber- und Blasengalle 12.6.5 Bildung von Mizellen 12.6.6 Enterohepatische Kreisläufe 12.7 Pankreas 12.7.1 Anatomie des Pankreas 12.7.2 Pankreassekret 12.7.3 Phasen der Pankreassekretion 12.8 Resorption von Elektrolyten und Wasser 12.8.1 Grundlagen der Resorptionsvorgänge 12.8.2 Transportmechanismen für Elektrolyte und Wasser 12.9 Verdauung und Resorption von Nährstoffen 12.9.1 Verdauung und Resorption der Kohlenhydrate 12.9.2 Verdauung der Proteine und Resorption der Proteolyseprodukte 12.9.3 Verdauung der Lipide und Resorption der Lipolyseprodukte 12.10 Darmgase 12.11 Pathophysiologie des Gastrointestinaltrakts 12.11.1 Erkrankungen der Mundhöhle 12.11.2 Erkrankungen im Bereich des Ösophagus 12.11.3 Gastritiden und Reizmagen 12.11.4 Peptische Ulzera, Ulkuskrankheit 12.11.5 Pathophysiologie des operierten Magens 12.11.6 Assimilationsstörungen 12.11.7 Infektöse Darmentzündungen 12.11.8 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen 12.11.9 Gastrointestinale Blutung 12.11.10 Obstipation und Diarrhoe 12.11.11 Weitere Darmerkrankungen 12.11.12 Gastrointestinale Tumoren 12.11.13 Erkrankungen der Leber 12.11.14 Erkrankungen der Gallenwege 12.11.15 Erkrankungen des endokrinen Pankreas 13 Niere und ableitende Harnwege 13.1 Anatomie der Niere 13.1.1 Makroskopische Anatomie der Niere 13.1.2 Mikroskopische Anatomie der Niere 13.2 Grundlagen der Nierenfunktion 13.2.1 Funktionsprinzip und Aufgaben der Nieren 13.2.2 Durchblutung und O2-Verbrauch der Nieren 13.3 Glomeruläre Filtration 13.3.1 Zusammensetzung des Ultrafiltrats 13.3.2 Filtrationsdruck und Filtrationsrate 13.4 Tubuläre Transportprozesse 13.4.1 Tubuläre Resorption von Na+, Cl- und Wasser 13.4.2 Tubuläre Kaliumresorption und –sekretion 13.4.3 Tubuläre Resorption von Kalzium, Magnesium, Phosphat und Sulfat 13.4.4 Tubuläre Resorption von Glukose und anderen Monosacchariden 13.4.5 Resorption von Aminosäuren und Peptiden 13.4.6 Tubuläre Transporte von Harnstoff, Urat und Oxalat 13.4.7 Tubuläre Sekretion von schwachen organischen Säuren und Basen 13.4.8 Tubuläre Transporte von Protonen, Bikarbonat und Ammoniak / Ammonium 13.5 Harnkonzentrierung und –verdünnung 13.5.1 Harnkonzentrierung bei Antidiurese 13.5.2 Diurese 13.6 Niere als Bildungsstätte und Zielorgan von Hormonen 13.7 Pathophysiologie der Nieren 13.7.1 Allgemeine Pathophysiologie 13.7.2 Glomeruläre und tubuläre Funktionsstörungen 13.7.3 Glomerulonephritis 13.7.4 Nephrotisches Syndrom 13.7.5 Interstitielle Nephritis 13.7.6 Pyelonephritis 13.7.7 Schwangerschaftsnephropathie 13.7.8 Akutes Nierenversagen 13.7.9 Chronische Niereninsuffizienz 13.7.10 Nephrolithiasis (Harnsteine) 13.8 Ableitende Harnwege 13.8.1 Harnleiter 13.8.2 Harnblase 13.8.3 Miktion und Kontinenz 13.8.4 Pathophysiologie der ableitenden Harnwege 14 Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt 14.1 Wasserhaushalt 14.1.1 Wassergehalt des Körpers 14.1.2 Wasserbilanz 14.1.3 Flüssigkeitsräume des Organismus 14.2 Elektrolytverteilung in den Körperflüssigkeiten 14.3 Regulation des Wasser- und Elektrolythaushalts 14.3.1 Osmoregulation 14.3.2 Regulation des Extrazellularvolumens 14.3.3 Kontrolle der Isoionie 14.4 Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts 14.4.1 Störungen des Wasserhaushalts 14.4.2 Störungen des Elektrolythaushalts 14.5 Säure-Basen-Haushalt 14.5.1 Grundlagen 14.5.2 Puffereigenschaften des Blutes 14.5.3 Respiratorische, renale und hepatische pH-Regulation 14.5.4 Störungen des Säure-Basen-Gleichgewichts 14.5.5 Analyse des Säure-Basen-Status 15 Energie- und Wärmehaushalt, Arbeitsphysiologie 15.1 Energiehaushalt 15.1.1 Energieumsatz der Zellen 15.1.2 Umsatzgrößen des gesamten Organismus 15.2 Wärmehaushalt 15.2.1 Körpertemperatur 15.2.2 Wärmebildung und innerer Wärmestrom 15.2.3 Wärmeabgabe an die Umgebung 15.2.4 Thermoregulierung 15.2.5 Akklimatisation 15.2.6 Pathophysiologie der Thermoregulation 15.3 Arbeitsphysiologie 15.3.1 Grundlagen der Arbeitsphysiologie 15.3.2 Organfunktionen bei dynamischer Arbeit 15.3.3 Organfunktionen bei statischer Arbeit 15.3.4 Reaktionen auf psychische Belastungen 15.3.5 Leistungsbeeinflussende Faktoren 15.3.6 Messung der Leistungsfähigkeit 16 Hormonales System 16.1 Aufgaben und Wirkungsweisen der Hormone 16.1.1 Hormone als Informationsträger 16.1.2 Grundprinzipien der hormonalen Regulation 16.2 Hypothalamisch-hypophysäres System 16.2.1 Anatomische Grundlagen 16.2.2 Hormone der Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappenhormone) 16.2.3 Effektorische Hormone der Adenohypophyse (effekt. Hypophysenvorderlappenhprmone) 16.2.4 Glandotrope Hormone der Adenohypophyse (glandotrope Hypophysenvorderlappenhprmone) 16.2.5 Störungen des hypothalamisch-hypophysären Systems 16.3 Schilddrüse und Schilddrüsenhormone 16.3.1 Anatomie der Schilddrüse 16.3.2 Biosynthese und Wirkungen der Schilddrüsenhormone 16.3.3 Kontrolle des T3- und T4-Spiegels 16.3.4 Störungen der Schilddrüsenfunktion 16.4 Nebenschilddrüsen und hormonale Kalzium- und Phosphatregulation 16.4.1 Anatomie der Nebenschilddrüsen 16.4.2 Parathormon 16.4.3 Kalzitonin 16.4.4 Kalzitriol 16.4.5 Störungen der Nebenschilddrüsenfunktion 16.5 Nebennierenrindenhormone 16.5.1 Anatomie der Nebennierenrinde 16.5.2 Glukokortikoide 16.5.3 Mineralokotikoide 16.5.4 Androgene der Nebennierenrinde 16.5.5 Störungen der Nebennierenrindenfunktion 16.6 Nebennierenmark und Katecholamine 16.6.1 Mikroskopische Anatomie des Nebennierenmarks 16.6.2 Bildung und Wirkungen von Adrenalin und Noradrenalin 16.6.3 Kontrolle der Hormonabgabe 16.6.4 Störungen der Nebennierenmarkfunktion 16.7 Pankreashormone und Blutzuckerregulation 16.7.1 Anatomie des Inselorgans 16.7.2 Insulin 16.7.3 Glukagon 16.7.4 Regulation des Blutzuckerspiegels 16.7.5 Hypoglykämie 16.7.6 Diabetes mellitus 16.8 Sexualhormone 16.8.1 Männliche Sexualhormone 16.8.2 Weibliche Sexualhormone 16.9 Weitere Hormonsysteme 16.10 Gewebehormone 17 Fortpflanzungsorgane, Sexualfunktionen und Schwangerschaft 17.1 Bau und Funktion der männlichen Geschlechtsorgane 17.1.1 Testes 17.1.2 Samenwege 17.1.3 Geschlechtsdrüsen 17.1.4 Äußere männliche Geschlechtsorgane und Harnröhre 17.2 Bau und Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane 17.2.1 Ovarien 17.2.2 Eileiter (Tuba uterina) 17.2.3 Uterus 17.2.4 Vagina 17.2.5 Äußere weibliche Geschlechtsorgane und Harnröhre 17.3 Kohabitation 17.3.1 Sexueller Reaktionsablauf beim Mann 17.3.2 Sexueller Reaktionsablauf bei der Frau 17.3.3 Allgemeinreaktionen während des sexuellen Reaktionsablaufs 17.4 Schwangerschaft und Geburt 17.4.1 Spermienwanderung, Konzeption und Imprägnation 17.4.2 Syngamie, Nidation und Plazentation 17.4.3 Empfängniszeit 17.4.4 Bau und Funktion der Plazenta 17.4.5 Entwicklung und Entwicklungsbedingungen des Feten 17.4.6 Geburt 17.5 Störungen der Sexualfunktionen 17.5.1 Störungen der männlichen Sexualfunktion 17.5.2 Störungen der weiblichen Sexualfunktion 17.6 Störungen in der Schwangerschaft 17.6.1 Schwangerschaftsspezifische Erkrankungen 17.6.2 Störungen der Schwangerschaftsdauer 18 Skelett, Muskulatur und Bindegewebe 18.1 Skelett und Gelenke 18.1.1 Skelettaufbau und allgemeine Gelenkanatomie 18.1.2 Schultergürtel- und Armskelett 18.1.3 Becken- und Beinskelett 18.2 Muskelapparat 18.2.1 Allgemeine makroskopische Anatomie des Skelettmuskels 18.2.2 Muskulatur des Rumpfes 18.2.3 Muskulatur des Schultergürtels und des Arms 18.2.4 Muskulatur des Beckengürtels und des Beines 18.3 Mikroskopische Anatomie und Physiologie der Skelettmuskulatur 18.3.1 Feinbau der Skelettmuskulatur 18.3.2 Neuromuskuläre Erregungsübertragung 18.3.3 Elektromechanische Kopplung und Kontraktion 18.3.4 Mechanik der Muskelkontraktion 18.3.5 Energetik der Muskelkontraktion 18.3.6 Steuerung der Muskeltätigkeit 18.3.7 Physiologische Anpassungsvorgänge des Skelettmuskels 18.4 Aufbau und Physiologie der glatten Muskulatur 18.4.1 Feinbau und Innervation des glatten Muskels 18.4.2 Funktionstypen glatter Muskulatur 18.4.3 Kontraktionsauslösung & Grundprozesse d. Kontraktionsmechanismen d. glatten Muskulatur 18.4.4 Mechanische Eigenschaften des glatten Muskels 18.5 Pathophysiologie des Knochens 18.5.1 Osteoporose 18.5.2 Osteomalazie und Rachitis 18.5.3 Lokalisierte Knochenerkrankungen mit Knochenabbau 18.5.4 Osteosklerosen 18.6 Pathophysiologie der Muskulatur 18.6.1 (Progressive) Muskeldystrophien 18.6.2 Myotonien 18.6.3 Metabolische Myopathien 18.6.4 Myositiden 18.6.5 Myopathien bei endokrinen Störungen 18.6.6 Myasthenien 18.7 Pathophysiologie des Bindegewebes 18.7.1 Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises 18.7.2 Angeborene Störungen des Bindegewebes 19 Nervensystem 19.1 Anatomie des Rückenmarks und des peripheren Nervensystems 19.1.1 Allgemeiner Aufbau des Rückenmarks 19.1.2 Rückenmarksquerschnitt und Leistungsbahnen 19.1.3 Aufbau des peripheren Nervensystems 19.2 Anatomie des Gehirns 19.2.1 Hirnstamm und Kleinhirn 19.2.2 Zwischenhirn 19.2.3 Endhirn 19.2.4 Gefäß- und Liquorsystem 19.3 Funktionen des motorischen Systems 19.3.1 Spinale Motorik, Reflexe 19.3.2 Supraspinal-motorisches System 19.4 Funktionen des sensorischen Systems 19.4.1 Periphere Afferenzen und aufsteigende Bahnen im Rückenmark 19.4.2 Sensorische Rindenfelder und Informationsverarbeitung 19.5 Schmerz 19.5.1 Charakteristika des Schmerzes 19.5.2 Neurophysiologie des Schmerzes 19.5.3 Spezielle Schmerzzustände 19.5.4 Kopf- und Gesichtsschmerzen 19.6 Funktionen des vegetativen Nervensystems 19.6.1 Aufbau des peripheren vegetativen Nervensystems 19.6.2 Erregungsübertragung in sympathischen und parasympathischen Ganglien 19.6.3 Sympathische Erregungsübertragung auf die Erfolgsorgane 19.6.4 Parasympathische Erregungsübertragung auf die Erfolgsorgane 19.6.5 Sympathikus- und Parasympathikuswirkungen 19.6.6 Darmnervensystem 19.6.7 Funktionen des zentralen vegetativen Nervensystems 19.6.8 Pathophysiologie des vegetativen Nervensystems 19.7 Allgemeine Funktionen des Gehirns 19.7.1 Elektroenzeohalogramm (EEG) 19.7.2 Schlafen und Wachen 19.7.3 Bewußtsein und Aufmerksamkeit 19.7.4 Emotion und Motivation 19.7.5 Lernen und Gedächtnis 19.7.6 Blut-Hirn-Schranke und Liquorbildung 19.8 Neurologische Störungen 19.8.1 Formen der Muskeltonus- und Bewegungsstörungen (Definitionen) 19.8.2 Periphere und spinale Störungen 19.8.3 Störungen der Basalganglien- und Kleinhirnfunktionen 19.8.4 Multiple Sklerose 19.8.5 Epilepsien 19.8.6 Angeborene und erworbene Hirnschäden 19.8.7 Zerebrale Durchblutungsstörungen und Hirnödem 19.9 Psychische Störungen 19.9.1 Psychosen 19.9.2 Neurosen (abnorme Erlebnisreaktionen) 19.9.3 Persönlichkeitsstörungen („Psychopathien“) 19.9.4 Abhängigkeit (Gewöhnung, Sucht) 19.9.5 Dementielle Syndrome 19.10 Schlafstörungen 20 Sinnesorgane 20.1 Grundbegriffe der Sinnesphysiologie 20.1.1 Objektive Sinnesphysiologie 20.1.2 Subjektive Sinnesphysiologie 20.2 Somatoviszerale Sensibilität 20.2.1 Mechanosensibilität der Haut (Tastsinn) 20.2.2 Thermorezeption 20.2.3 Propriozeption 20.3 Geschmackssinn 20.3.1 Mikroskopischer Aufbau der Sinneszellen 20.3.2 Qualitäten des Geschmackssinns 20.3.3 Signaltransduktion in Geschmackssensoren 20.3.4 Zentrale Geschmacksbahn und Geschmacksverarbeitung 20.3.5 Störungen des Geschmackssinns 20.4 Geruchsinn 20.4.1 Anatomie des Nasenraums 20.4.2 Qualitäten des Geruchssinns 20.4.3 Signaltransduktion in Riechzellen 20.4.4 Zentrale Riechbahn 20.4.5 Störungen des Geruchssinns 20.5 Gehörsinn 20.5.1 Anatomie des Hörorgans 20.5.2 Schallreize und Hörempfindung 20.5.3 Funktionsweise des Hörorgans 20.5.4 Hörstörungen 20.6 Gleichgewichtssinn 20.6.1 Anatomie des Gleichgewichtsorgans 20.6.2 Funktion des Vestibularapparats 20.7 Stimme und Sprache 20.7.1 Anatomie des Kehlkopfs 20.7.2 Stimm- und Lautbildung 20.8 Gesichtssinn 20.8.1 Anatomie des Auges 20.8.2 Abbildendes System, Pupillenreaktion und intraokulärer Druck 20.8.3 Funktion der Photosensoren 20.8.4 Signalverarbeitung in der Retina 20.8.5 Erkrankungen der Retina 20.8.6 Farbensehen 20.8.7 Sehbahn und zentrale Signalverarbeitung 20.8.8 Gesichtsfeld und räumliches Sehen 21 Haut 21.1 Aufbau der Haut 21.1.1 Epidermis 21.1.2 Korium (Dermis) und Subkutis 21.1.3 Anhangsorgane der Haut 21.1.4 Alterungsbedingte Veränderungen der Haut 21.2 Krankheitssymptome an der Haut 21.3 Hautkrankheiten 21.3.1 Psoriasis 21.3.2 Ekzeme 21.3.3 Urtikaria und Quincke-Ödem 21.3.4 Bakterielle Hauterkrankungen 21.3.5 Mykosen 21.3.6 Virusinfektionen 21.3.7 Epizoonosen 21.3.8 Akne 21.3.9 Störungen des Pigmentsystems 21.3.10 Verbrennungen 21.3.11 Erfrierungen 21.3.12 Malignes Melanom 22 Maßeinheiten der Physiologie 23 Normwerte (Referenzbereiche) von Laborparametern 24 Häufige Abkürzungen Weiterführende Lehrbücher Sachregister |
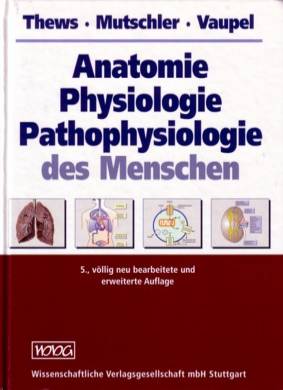
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen