|
|
|
Rezension
So wichtig es ist, die (Welt-)Geschichte differenziert zu betrachten und exkat die einzelnen Epochen in ihrer jeweiligen Komplexität zu analysieren, so grundlegend bedeutsam bleibt es doch auch, die Weltgeschichte komprimiert und im Gesamtüberblick wahrzunehmen - zumal für Schüler/innen, damit die Gesamtentwicklung nicht aus den Augen verloren wird. Diesem zwei-bändigen Lehrbuch gelingt eine solcher Gesamtüberblick. Ein spezielles Anliegen gilt der Vermittlung der kulturellen Leitlinien, die während der behandelten Jahrhunderte wirksam waren. Gut lesbar und benutzerfreundlich liefert dieser erste Band einen Überblick von den Anfängen bis zur Französischen Revolution (1789).
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Herausgeber: Joseph Boesch, Autoren: Karl Schib, Rudolf Schläpfer Weltgeschichte Band 1 Von den Anfängen bis zur Aufklärung Band 1 der Weltgeschichte ist inhaltlich überarbeitet worden und präsentiert sich in neuem Erscheinungsbild: Grafiken, Landkarten und Bilder sind mehrheitlich farbig. Der Band endet neu beim Übergang zur Aufklärung (um 1700). Das Werk ist chronologisch aufgebaut, räumt jedoch gleichzeitig der Kulturgeschichte, dem inneren Leben von Staat und Gesellschaft, bereiten Raum ein. Ein spezielles Anliegen gilt der Vermittlung der kulturellen Leitlinien, die während der behandelten Jahrhunderte Wirksam waren. Stark ausgebaut und vertieft wurde auch die Schweizer Geschichte. Dies ist insofern gerechtfertigt, als die Rentsch-Weltgeschichte besonders häufig an schweizerischen Schulen und Gymnasien verwendet wird. Nach wie vor erhält die Geschichte der aussereuropäischen Länder ihren gebührenden Raum. Wie beim Band 2 wurde auch beim Band 1 grosses Gewicht auf Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Neben einem Personenregister mit separater Auflistung von Päpsten, Monarchen und Dynastien rundet ein nützliches Glossar der Fachbegriff das Werk ab. Ein Themen- und Sachregister erleichtert Lehrenden wie Lernenden die Verwendung des Buches für Längsschnitte und themenzentrierter Unterricht. Weiter zu Weltgeschichte Band 2: Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Über die Autoren/-innen Rudolf Schläpfer, Dr. phil, studierte Geschichte und Deutsche Literatur an der Universität Zürich. Er unterrichtete bis 2005 Geschichte an der Kantonsschule Aarau und ist Konrektor und Leiter der Wirtschaftsdiplomschule. Seit 1991 betreut er die Neubearbeitung der von Joseph Boesch und Karl Schib begründeten zweibändigen Rentsch-Weltgeschichte. Inhaltsverzeichnis
Band 1: 1. Die Urgeschichte
2. Die ersten Hochkulturen ab 3000 v.Chr. 3. Die Welt der Griechen 4. Die Geschichte Roms und seines Reiches 5. Der Untergang Westroms 6. Die Araber und der Islam 7. Byzanz als christliches Bollwerk im Osten (600–1453) 8. Die Neustrukturierung der abendländischen Gesellschaft (500–1300) 9. Das abendländische Mönchtum und die Römische Kirche 10. Die Kultur des christlich-feudalen Abendlandes 11. Die Überwindung des Lehenswesens (10. bis 15. Jh.) 12. Die Renaissance 13. Der europäische Vorstoß in die anderen Erdteile 14. Das Abendland um 1500 15. Zerbrechen der kirchlichen Einheit des Abendlandes (16. Jh.) 16. Das konfessionelle Zeitalter 17. Der kontinentaleuropäische Absolutismus 18. Die Behauptung der Ständemonarchie in England 19. Das Staatensystem zur Zeit des Absolutismus 20. Der Übergang zur Aufklärung Band 2: 21. Die Aufklärung 22. Die Industrielle Revolution in England 23. Die Amerikanische Revolution 24. Die Französische Revolution 25. Restauration und neue Revolutionen 26. Die Auflösung der Wiener Ordnung 27. Das geistige und künstlerische Leben 28. Industrialisierung, Sozialismus und Arbeiterbewegung 29. Der Kampf um die Demokratie 30. Der Imperialismus 31. Der Erste Weltkrieg 32. Die Auseinandersetzung mit dem Kriegserbe 33. Die Entwicklung der Sowjetunion 34. Die Krisenjahre 35. Der Weg zum Zweiten Weltkrieg 36. Der Zweite Weltkrieg 37. Das geistige Leben nach der Mitte des 20. Jahrhunderts 38. Die Entstehung der zwei Blöcke 39. Der Kalte Krieg 1950–1962 40. Entspannung und Koexistenz 1963–1985 41. Die Industrieländer 1945– 1989 42. Asien 1945– 1989 43. Afrika 1945– 1989 44. Lateinamerika 1945– 1989 45. Entwicklungsländer und Weltwirtschaft 46. Ende des Kalten Krieges 1985–1991 47. Neue Weltordnung seit 1989 Weltgeschichte Bd.1 Inhalt – Band 1 1. Die Urgeschichte 1.1 Urgeschichte und eigentliche Geschichte . . . . . . . . . . . . . . 1 1.11 Abgrenzung – 1.12 Kenntnisse 1.2 Die Anfänge der Menschheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.21 Merkmale des Menschen – 1.22 Frühe Arten – 1.23 Jetztzeitliche Menschen 1.3 Die wichtigsten Perioden der Urgeschichte . . . . . . . . . . . . 2 1.31 Altsteinzeit – 1.32 Jungsteinzeit – 1.33 Metallzeiten 2. Die ersten Hochkulturen ab 3000 v.Chr. 2.1 Die gemeinsamen Entwicklungslinien . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.11 Stromtal-Kulturen – 2.12 Entstehung des Staates – 2.13 Soziale Differenzierung – 2.14 Schrift – 2.15 Kalender – 2.16 Völkerwanderungen 2.2 Süd- und Ostasien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.21 Indus-Kultur – 2.22 Brahmanismus – 2.23 Anfänge des Chinesischen Reiches 2.3 Ägypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.31 Reichsgeschichte – 2.32 Religion und Kunst – 2.33 Wissenschaft und Technik 2.4 Kulturen und Staaten Mesopotamiens . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.41 Geografische Grundlage – 2.42 Sumerer – 2.43 Semitisierung – 2.44 Altbabylonisches Reich – 2.45 Hethiter – 2.46 Assyrer – 2.47 Neubabylonisches Reich 2.5 Das Perserreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.51 Staatliche Entwicklung – 2.52 Kultur 2.6 Kleinstaaten zwischen den Großreichen . . . . . . . . . . . . . . 16 2.61 «Fruchtbarer Halbmond» – 2.62 Phöniker 2.63 Staatengeschichte der Hebräer – 2.64 Jahwe-Glaube 3. Die Welt der Griechen 3.1 Die Frühgeschichte (2100–750 v.Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.11 Geografische Grundlagen – 3.12 Kreta und die Achäer 3.13 Mykenische Zeit – 3.14 Dorische Wanderung 3.2 Das Zeitalter der griechischen Kolonisation (750–550 v.Chr.) . . . 20 3.21 Ursachen – 3.22 Ablauf – 3.23 Ergebnisse 3.3 Die griechischen Staaten im 6. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . 22 3.31 Krise der Aristokratie – 3.32 Sparta – 3.33 Athens Weg zur Tyrannis – 3.34 Athens Übergang zur Demokratie – 3.35 Die voll ausgebildete Polis 3.4 Die griechische Klassik (5. Jahrhundert v.Chr.) . . . . . . . . . . 27 3.41 Traditionelle Kräfte – 3.42 Vorsokratische Philosophie – 3.43 Sokrates und Platon – 3.44 Nachplatonische Philosophie – 3.45 Bildende Kunst – 3.46 Baukunst – 3.47 Epische Dichtung – 3.48 Theater – 3.49 Jugenderziehung 3.5 Perserkriege und innere Zerfleischung (500–334 v.Chr.) . . . . . 35 3.51 Erster Perserzug – 3.52 Zweiter Perserzug – 3.53 Athenischer Imperialismus – 3.54 Glückliches Zwischenspiel – 3.55 Peloponnesischer Krieg – 3.56 Politischer Niedergang – 3.57 Aufstieg Makedoniens 3.6 Das Zeitalter des Hellenismus (ab 334 v.Chr.) . . . . . . . . . . . 42 3.61 Alexanderzug – 3.62 Ansatz zum Neubau – 3.63 Ende des makedonischen Weltreiches – 3.64 Hellenistische Wissenschaft und Technik – 3.65 Weltgeschichtliche Bedeutung des Hellenismus 4. Die Geschichte Roms und seines Reiches 4.1 Das Werden der Republik und des Römischen Reiches (7.–1. Jahrhundert v.Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 4.11 Frühgeschichte und Stadtgründung – 4.12 Vertreibung der Könige – 4.13 Frühe Republik – 4.14 Klassische Republik – 4.15 Unterwerfung Italiens – 4.16 Eroberung des westlichen Mittelmeerbeckens – 4.17 Einverleibung der Diadochenstaaten 4.2 Krise der Republik und Übergang zur Monarchie (2. und 1. Jahrhundert v.Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 4.21 Stadtstaat und Reichsverwaltung – 4.22 Soziale Umschichtungen – 4.23 Bürgerkriegswirren – 4.24 Caesars Aufstieg und Fall – 4.25 Augusteisches Principat 4.3 Das frühe Kaiserreich (1. und 2. Jahrhundert n.Chr.) . . . . . . . 59 4.31 Erbkaiser – 4.32 Adoptivkaiser – 4.33 Reichsverteidigung 4.4 Die Kultur der Kaiserzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.41 Einfluss des Hellenismus – 4.42 Städtewesen – 4.43 Tiefbautechnik – 4.44 Hochbaukunst – 4.45 Recht – 4.46 Sklaverei 4.5 Das Christentum im Römischen Reich (3. und 4. Jahrhundert) . . 71 4.51 Römische Religiosität – 4.52 Urchristentum – 4.53 Christenverfolgungen und Soldatenkaiser – 4.54 Reformen Diokletians – 4.55 Wende durch Konstantin – 4.56 Christliches Reich 4.6 Die Schweiz in römischer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.61 Kelten, Räter und römische Soldaten 4.62 Blütezeit und Niedergang 4.63 Die romanische Schweiz 4.64 Die alemannische Deutschschweiz 5. Der Untergang Westroms (375–476) 5.1 Die Völker an der Seidenstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5.11 Roms Außenhandel – 5.12 Herrschaftswechsel in Persien – 5.13 Indien – 5.14 China – 5.15 Hunnen 5.2 Wanderungen und Staatengründungen der Germanen (375–500) . 81 5.21 Westgoten – 5.22 Übrige Ostgermanen – 5.23 Westgermanen 5.3 Die Ursachen des Untergangs von Westrom . . . . . . . . . . . . 83 5.31 Wirtschaftliche Schwäche – 5.32 Militärische Schwäche – 5.33 Äußerer Druck – 5.34 Moralischer Niedergang – 5.35 Augustin 5.4 Das Oströmische Reich überlebt die Völkerwanderung . . . . . . 85 5.41 Lagegunst – 5.42 Reichspolitik Justinians 527–565 – 5.43 Vollendung der unbeschränkten Monarchie – 5.44 Stellung der Kirche 6. Die Araber und der Islam 6.1 Mohammed als Religionsgründer . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6.11 Arabien um 600 – 6.12 Leben Mohammeds – 6.13 Religion – 6.14 Staatliche Ordnung 6.2 Aufstieg und Zerfall des arabischen Großreiches . . . . . . . . . 90 6.21 Begründung des Kalifates – 6.22 Zeit der Omajjaden 661–750 – 6.23 Zeit der Abbasiden 750–1258 6.3 Die islamische Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.31 Verhältnis zu älteren Kulturen – 6.32 Kunst – 6.33 Naturwissenschaften – 6.34 Rückwirkungen auf das Abendland 7. Byzanz als christliches Bollwerk im Osten (600–1453) 7.1 Der Charakter des byzantinischen Staates . . . . . . . . . . . . . 96 7.11 Kaiserliche Allgewalt – 7.12 Verwaltung – 7.13 Kunst – 7.14 Geistige Kultur – 7.15 Wirtschaft 7.2 Die Beziehungen mit dem Westen . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7.21 Kultureller Einfluss – 7.22 Aufstieg des Papsttums – 7.23 Offener Bruch 7.3 Byzanz und die Slawen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.31 Slaweneinbruch in den Balkan – 7.32 Missionierung der Süd- und Westslawen – 7.33 Reich von Kiew – 7.34 Missionierung der Ostslawen 7.4 Byzanz und die islamische Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 7.41 Abwehrerfolge – 7.42 Prekäres Gleichgewicht zur Abbasiden-Zeit – 7.43 Aufstieg des Osmanenreiches 8. Die Neugestaltung der abendländischen Gesellschaft (500–1300) 8.1 Die fränkische Zeit (6.–9. Jahrhundert) . . . . . . . . . . . . . . . 105 8.11 Königtum der Merowinger – 8.12 Absinken in die Naturalwirtschaft – 8.13 Aufstieg der Hausmeier im 7. und 8. Jahrhundert – 8.14 Reichspolitik Karls des Großen – 8.15 Karolingische Renaissance – 8.16 Schwächen des Karolingerreiches – 8.17 Zerfall des Karolingerreiches 8.2 Das Lehenswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8.21 Naturalwirtschaft und Feudalismus – 8.22 Lehen im Abendland – 8.23 Ursprung – 8.24 Weitere Entwicklung – 8.25 Französisches und deutsches Lehensrecht – 8.26 Lehenssystem und Bauern – 8.27 Kirche und Lehenswesen – 8.28 Untergang des Territorialstaates 8.3 Politische Entwicklung von 900 bis 1050 . . . . . . . . . . . . 114 8.31 Deutschland und ltalien – 8.32 Die Schweiz – 8.33 Frankreich – 8.34 Britische Inseln 8.4 Politische Entwicklung von 1050 bis 1300 . . . . . . . . . . . . . 119 8.41 Investiturstreit – 8.42 Kreuzzüge – 8.43 Spanische Reconquista – 8.44 Frankreich und England im 12. Jahrhundert – 8.45 Frankreich im 13. Jahrhundert – 8.46 England im 13. Jahrhundert – 8.47 Deutschland und Italien zur Staufenzeit – 8.48 Die Schweiz im Hochmittelalter – 8.49 Russland 9. Das abendländische Mönchtum und die Römische Kirche 9.1 Der Benediktinerorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 9.11 Frühes Mönchtum – 9.12 Entstehung der Benediktinerklöster – 9.13 Eigenklöster – 9.14 Cluniazensische Klosterreform 9.2 Kirche und weltliche Gewalt (900–1300) . . . . . . . . . . . . . 134 9.21 Feudalisierung der Kirche – 9.22 Cluniazensische Kirchenreform – 9.23 Zentralisation der Kirche – 9.24 Zusammenbruch der päpstlichen Weltherrschaftspläne 9.3 Die Wirkung der Kreuzzüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 9.31 Erschütterung des Kirchenglaubens – 9.32 Ritterorden – 9.33 Wirtschaftlicher Wandel 9.4 Der Zisterzienserorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9.41 Bernhard von Clairvaux – 9.42 Ausbreitung der Zisterzienser – 9.43 Wirkung der Zisterzienser 9.5 Die Bettelorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 9.51 Franz von Assisi – 9.52 Franziskanerorden – 9.53 Dominikanerorden – 9.54 Ketzerbewegungen 9.6 Die Frauenorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 9.61 Stellung der Frau in der Kirche – 9.62 Einfluss der Bettelorden – 9.63 Beginen 10. Die Kultur des christlich-feudalen Abendlandes 10.1 Die bäuerliche Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10.11 Ursprung der Grundherrschaft – 10.12 Formen der bäuerlichen Unfreiheit – 10.13 Feudalisierung – 10.14 Kirche und bäuerliche Unfreiheit – 10.15 Anbausystem 10.2 Die Stellung der Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 10.21 Rechtsordnung – 10.22 Frauenüberschuss – 10.23 «Minnedienst» 10.3 Das Schulwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 10.31 Kloster- und Kathedralschulen – 10.32 Stadtschulen – 10.33 Entstehung der ersten Universitäten – 10.34 Entwicklung der Universität Paris – 10.35 Ausbreitung der Universitäten 10.4 Die Philosophie der Scholastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 10.41 Begriff – 10.42 Wegbereiter – 10.43 Albertus Magnus – 10.44 Thomas von Aquino – 10.45 Frühe Kritik an der Scholastik 10.5 Die Macht des Todes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 10.51 Bevölkerungsbewegung – 10.52 Pest – 10.53 Hunger – 10.54 Krieg 10.6 Das Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 10.61 Kirchenrecht – 10.62 Weltliches Strafrecht – 10.63 Verfassungsrecht 10.7 Die Belletristik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 10.71 Lateinische Dichtung – 10.72 Ritterliche Dichtung – 10.73 Dante Alighieri 10.8 Der Kirchenbau und die bildende Kunst . . . . . . . . . . . . . 166 10.81 Grundriss der Kirchen – 10.82 Kirchenbau der Romanik – 10.83 Bildende Kunst der Romanik – 10.84 Gotischer Kirchenbau – 10.85 Gotische Fenstergestaltung – 10.86 Bildende Kunst der Gotik – 10.87 Bau der Kathedralen 10.9 Die Naturwissenschaften und die Technik . . . . . . . . . . . . 175 10.91 Naturwissenschaft – 10.92 Medizin – 10.93 Agrikulturtechnik – 10.94 Gewerbliche Technik – 10.95 Schiffbau – 10.96 Waffentechnik – 10.97 Eisenguss und Buchdruckerkunst 11. Die Überwindung des Lehenswesens (10. bis 15. Jahrhundert) 11.1 Die Wiedergeburt der Städte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 11.11 Burgen als Vorläufer – 11.12 Handelsstädte in Italien – 11.13 Ausdehnung des Fernhandels – 11.14 Wachstum der Städte – 11.15 Rechtsstellung der Stadtbewohner – 11.16 Stadtrecht – 11.17 Anfänge der Selbstverwaltung – 11.18 Stadtgründungen 11.2 Die Rückkehr zur Geldwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 11.21 Geld in der Naturalwirtschaft – 11.22 Geld und Fernhandel – 11.23 Bankwesen – 11.24 Geld und Lehenswesen 11.3 Die Entwicklung der städtischen Gesellschaft . . . . . . . . . . 189 11.31 Stadtadel – 11.32 Patriziat und Handwerker – 11.33 Patrizierstädte – 11.34 Zunftordnung – 11.35 Zunftstädte 11.4 Die Stadtstaaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 11.41 Italien – 11.42 Deutsches Reich – 11.43 Städtebünde – 11.44 Nowgorod – 11.45 Westeuropa – 11.46 Stadtstaat und Feudalismus 11.5 Die Entstehung der Nationalstaaten in Westeuropa . . . . . . . . 198 11.51 Ursprung des Hundertjährigen Krieges – 11.52 Wende durch Jeanne d’Arc – 11.53 England nach dem Hundertjährigen Krieg – 11.54 Wachsende Macht der Valois-Könige – 11.55 Spanien und Portugal 11.6 Moskaus Aufstieg zum «Dritten Rom» . . . . . . . . . . . . . . 203 11.61 Anfänge des Großfürstentums Moskau – 11.62 «Sammlung der russischen Erde» – 11.63 Wende durch Iwan III. 11.7 Der Zerfall des Deutschen Reiches . . . . . . . . . . . . . . . . 205 11.71 Aufstieg der Landesfürsten – 11.72 Kurfürsten – 11.73 Gescheiterte Reichsreform 11.8 Die Entstehung der Eidgenossenschaft . . . . . . . . . . . . 207 11.81 Die Anfänge der Eidgenossenschaft – 11.82 Bauern und Bürger – 11.83 Innere Spannungen und Gemeinsamkeiten – 11.84 Die Burgunderkriege – 11.85 Die Grenzen des Wachstums 12. Die Renaissance 12.1 Der Begriff und die zeitliche Einordnung . . . . . . . . . . . . . 212 12.11 Fortleben der Antike – 12.12 Humanismus und Renaissance – 12.13 «Mittelalter» 12.2 Der Humanismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 12.21 Anfänge – 12.22 Humanistische Wissenschaft – 12.23 Humanistische Literatur – 12.24 Geistesgeschichtliche Bedeutung – 12.25 Machiavelli 12.3 Die Kunst der Renaissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 12.31 Architektur – 12.32 Grundtendenzen in der bildenden Kunst – 12.33 Frührenaissance (15. Jahrhundert) – 12.34 Hochrenaissance – 12.35 Italienische Spätrenaissance – 12.36 Niederländisch-flämische Vorrenaissance – 12.37 Renaissancekunst außerhalb Italiens 12.4 Die Anfänge moderner Naturwissenschaft . . . . . . . . . . . . 221 12.41 Leonardo da Vinci – 12.42 Nikolaus Kopernikus – 12.43 Jahrhundertelanger Streit um Kopernikus – 12.44 Versäumter Ansatz zur Erneuerung der Medizin 13. Der europäische Vorstoß in die anderen Erdteile (1400–1600) 13.1 Die außereuropäische Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 13.11 Mongolenreich – 13.12 Indien – 13.13 Reich der Khmer – 13.14 China – 13.15 Japan – 13.16 Afrika – 13.17 Osmanenreich – 13.18 Urgeschichte Amerikas – 13.19 Vorkolumbische Hochkulturen Amerikas 13.2 Die Grundlagen der Entdeckungsfahrten . . . . . . . . . . . . . 235 13.21 Wissenschaftlich-technische Voraussetzungen – 13.22 Politisch-geistige Voraussetzungen – 13.23 Behinderung des Orienthandels 13.3 Das Kolonialreich der Portugiesen . . . . . . . . . . . . . . . . 237 13.31 Erforschung der Küste Afrikas – 13.32 Vorstoß nach Indien – 13.33 Portugiesisch Ostindien 13.4 Spanien erobert «die Neue Welt» . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 13.41 Kolumbus – 13.42 Teilung der Welt – 13.43 Erste Erdumsegelung – 13.44 Conquistadores – 13.45 Los der Indianer – 13.46 Wichtigste Ergebnisse 14. Das Abendland um 1500 14.1 Der Frühkapitalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 14.11 Neue Wirtschaftsgesinnung – 14.12 Kapitalballung – 14.13 Verlagssystem – 14.14 Frühkapitalismus und Kolonialpolitik – 14.15 Alte und neue Kapitalformen 14.2 Die spätmittelalterliche Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 14.21 Die Krise der Landwirtschaft 14.22 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen – 14.23 Der Niedergang des Adels – 14.24 Soziale Spannungen in den Städten 14.25 Jacquerie in Frankreich 14.26 Beseitigung der Leibeigenschaft in England 14.27 Bundschuh in Deutschland 14.3 Die Erschütterung der Kirche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 14.31 Avignonesisches Papsttum – 14.32 Mystik – 14.33 John Wiclif – 14.34 Großes Schisma – 14.35 Jan Hus – 14.36 Reformkonzilien – 14.37 «Renaissancepäpste» – 14.38 Aufbau von Staatskirchen 14.4 Das Staatensystem um 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 14.41 Östliches Europa – 14.42 Habsburg – 14.43 Kontinentaleuropäische Gegensätze – 14.44 Kolonialrivalität 15. Zerbrechen der kirchlichen Einheit des Abendlandes (16. Jh.) 15.1 Luther und die deutsche Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . 259 15.11 Vorreformatorische Zeit – 15.12 Ablassstreit - 15.13 Leipziger Disputation – 15.14 «Reformationsschriften» – 15.15 Bann und Reichsacht – 15.16 Deutscher Bauernkrieg – 15.17 Reformation und Europapolitik – 15.18 Augsburger Religionsfriede von 1555 15.2 Die Reformation und die Eidgenossenschaft . . . . . . . . . . . 267 15.21 Zwingli und Luther – 15.22 Reformierte Landeskirchen – 15.23 Zwinglis Kriegspolitik – 15.24 Zweiter Kappeler Landfriede von 1531 – 15.25 Konfessioneller Graben 16.–18. Jahrhundert – 15.26 Berns Expansion nach Westen – 15.27 Die Entwicklung zum Staat 15.28 Politische Erstarrung 15.3 Calvin und die Presbyterianische Kirche . . . . . . . . . . . . . 272 15.31 Genf um 1530 – 15.32 Genf als «Cité de Dieu» – 15.33 Prädestinationslehre – 15.34 Ausbreitung des Calvinismus 15.4 Die kirchliche Entwicklung in England . . . . . . . . . . . . . . 274 15.41 Heinrich VIII. – 15.42 Blutige Zwischenphase – 15.43 Endgültige Form der Anglikanischen Kirche 15.5 Die Täuferbewegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 15.51 Begriff – 15.52 Revolutionäres Täufertum – 15.53 Reformatoren und Täufertum – 15.54 Spätes Täufertum 16. Das konfessionelle Zeitalter 16.1 Die katholischen Reformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 16.11 Ignatius von Loyola – 16.12 Jesuitenorden – 16.13 Kapuziner – 16.14 Tridentinum – 16.15 «Gegenreformation» 16.2 Konfessionelle Wirren in Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . 281 16.21 Ausgangslage – 16.22 Hugenottenkriege – 16.23 Ende der Valois – 16.24 Edikt von Nantes 16.3 Grenzen der spanischen Macht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 16.31 Höhepunkt der spanischen Geltung – 16.32 Freiheitskampf der Niederlande – 16.33 Untergang der Armada – 16.34 Neue Kolonialmächte – 16.35 Entwicklung in Südasien – 16.36 Entwicklung in Amerika 16.4 Der Dreißigjährige Krieg 1618–1648/59 . . . . . . . . . . . . . 289 16.41 Innerdeutscher Krieg – 16.42 Ausweitung zum europäischen Krieg – 16.43 Westfälischer Friede 16.5 Hexenverfolgungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 16.51 Hexenwahn – 16.52 Hexenverfolgungen – 16.53 Erklärungsversuche 17. Der kontinentaleuropäische Absolutismus 17.1 Die Staatstheorie und die Wirklichkeit . . . . . . . . . . . . . . 295 17.11 Jean Bodin – 17.12 Thomas Hobbes – 17.13 Jacques Bossuet – 17.14 Wirklichkeit des Absolutismus 17.2 Der Merkantilismus und das Manufaktursystem . . . . . . . . . 296 17.21 Theorie und Praxis – 17.22 Ziel und Mittel merkantilistischer Politik – 17.23 Manufakturen – 17.24 Soziale Umschichtungen – 17.25 Kolonialpolitik 17.3 Die Kultur des Barocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 17.31 Zeitliche Einordnung – 17.32 Bildende Kunst – 17.33 Baukunst – 17.34 Dichtkunst und Wissenschaft 17.4 Der Absolutismus in Frankreich . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 17.41 Richelieu – 17.42 Mazarin – 17.43 Ludwig XIV. – 17.44 Französische Klassik 17.5 Der kontinentale Absolutismus außerhalb Frankreichs . . . . . . 308 17.51 Spanien – 17.52 Russland – 17.53 Österreich-Habsburg – 17.54 Brandenburg – 17.55 Kleinere Monarchien – 17.56 Republiken 18. Die Behauptung der Ständemonarchie in England 18.1 Krone und Parlament nach 1600 . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 18.11 Dynastiewechsel – 18.12 Steuerrecht – 18.13 Kirchenpolitik – 18.14 Außenpolitik 18.2 Bürgerkrieg und Diktatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 18.21 Verschärfung der Gegensätze – 18.22 «Langes Parlament» – 18.23 Herrschaft Cromwells 18.3 Labiles Gleichgewicht und Sieg des Parlamentes . . . . . . . . 314 18.31 Restauration der Stuarts – 18.32 «Glorious Revolution» – 18.33 «Declaration of Rights» und «Bill of Rights» 18.4 Die Wandlungen der Ständemonarchie seit 1689 . . . . . . . . . 316 18.41 Erste Verschiebungen – 18.42 Großbritannien – 18.43 Hannoveraner-Könige 19. Das Staatensystem zur Zeit des Absolutismus 19.1 Die Hegemonialpolitik Frankreichs . . . . . . . . . . . . . . . . 318 19.11 Diplomatie – 19.12 «Raubkriege» – 19.13 Lage um 1685 19.2 Die Wende von 1688/89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 19.21 England – 19.22 Österreich – 19.23 Brandenburg – 19.24 Pfälzischer Krieg – 19.25 Verwestlichung Russlands 19.3 Der Aufbau eines kontinentalen Gleichgewichtes . . . . . . . . 323 19.31 Friedenssicherung – 19.32 Spanischer Erbfolgekrieg – 19.33 Nordischer Krieg – 19.34 Europa nach 1720/21 20. Der Übergang zur Aufklärung 20.1 Wachsende Kritik am Absolutismus . . . . . . . . . . . . . . . 327 20.11 Hugo Grotius – 20.12 François Fénelon – 20.13 John Locke 20.2 Kritik an den Amtskirchen und ihrer Theologie . . . . . . . . . 328 20.21 Berührung mit nichtchristlichen Hochkulturen – 20.22 Baruch Spinoza – 20.23 John Toland 20.3 Aufbau eines neuen Weltbildes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 20.31 René Descartes – 20.32 Pierre Bayle – 20.33 Isaac Newton – 20.34 Gesamtschau Anhang Fachbegriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Personenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Päpste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Monarchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Herrscherdynastien, Geschlechter . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Längsschnitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Verzeichnis der Karten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Verzeichnis der Stadtpläne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Verzeichnis der statistischen und chronologischen Tabellen . . . 342 Verzeichnis der Abbildungen und Zeichnungen . . . . . . . . . 342 Vorwort zur ersten Auflage Wer den Versuch macht, die gesamte Menschheitsgeschichte in zwei Bänden zusammenzufassen, muss den Mut haben, Lücken offen zu lassen. Geschichte schreiben bedeutet immer auswählen. Ausgewählt, bevorzugt wurde von uns das innere Leben von Staat und Gesellschaft, die Kulturgeschichte im weitesten Sinne. Die kulturgeschichtliche Betrachtungsweise erlaubte es, Leitlinien durch die Jahrhunderte bis zur Gegenwart zu ziehen. Die mit vollem Recht erhobene Forderung nach Universalgeschichte ließ sich am ehesten auf dem Gebiete der Kulturgeschichte verwirklichen. Wir bemühten uns, den europazentrischen Standpunkt zu überwinden und nach Möglichkeit Licht auf außereuropäische Völker und Staaten zu werfen, ohne freilich zu vergessen, dass die Kenntnis des abendländischen Wesens eines der wichtigsten Ziele des Geschichtsunterrichtes bleibt. Der erste Band führt die Entwicklung bis zur Aufklärung. Diese zeitlich sehr ungleiche Stoffverteilung bedingte für die früheren Jahrhunderte eine besonders gedrängte Darstellung. Karten und Bilder möchten zu Klärung und Ergänzung des oft allzu knappen Textes beitragen. Karl Schib, Joseph Boesch XV Weltgeschichte Bd.1 Titelei:Weltgeschichte Bd. 1 Titelei 28.5.2008 16:47 Uhr Seite XV Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage Gewandelte Unterrichtsbedürfnisse sowie neue Forschungsschwerpunkte und -ergebnisse haben dazu geführt, dass die Rentsch-Weltgeschichte seit ihren Anfängen mehrmals überarbeitet wurde. Nach dem Hinschied von Karl Schib im Jahre 1984 machte sich Joseph Boesch an die vollständige Überarbeitung des ersten Bandes von Karl Schib. Er bemühte sich dabei, behutsam vorzugehen. Insbesondere übernahm er Schibs sachkundige Darstellung, wie in Europa nach den Stürmen der Völkerwanderung eine eigenständige Kultur heranwuchs. Der Renaissance schenkte er vermehrte Bedeutung. Die Gliederung in kleine Abschnitte führte er noch konsequenter durch. Als kurz darauf 1987 auch er vom Tod aus seiner Arbeit herausgerissen wurde, war die Überarbeitung des ersten Bandes weitgehend vollendet. Nur vereinzelt mussten Texte ergänzt oder korrigiert und Quellentexte, Bilder oder Karten eingefügt werden. Umso dringender wurde damit aber die Überarbeitung und Aktualisierung des zweiten Bandes. Diese Aufgabe übernahm der Unterzeichnende, indem er in der Ausgabe von 1992 insbesondere die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg und in der Ausgabe von 2006 das Ende des Kalten Krieges und die Zeit seit 1989 vertiefte und aktualisierte. Der erste Band wurde seit 1992 in regelmäßigen Abständen dem neuesten Forschungsstand angepasst, aber in seinem Grundkonzept blieb das Werk Boeschs unangetastet. Erst in der vorliegenden 12. Auflage von 2008 fallen die Neuerungen ins Auge. Abgesehen vom längst fälligen farbigen und modernen Erscheinungsbild wurden die Illustrationen (Karten, Bilder, Grafiken) ausgebaut und vermehrt auf die didaktischen Bedürfnisse ausgerichtet. Erstmals enthält die neue Ausgabe auch eine knappe Schweizergeschichte. Da die Rentsch-Weltgeschichte das einzige deutschsprachige Geschichtslehrmittel ist, das bewusst darauf verzichtet, die deutsche Geschichte allzu sehr ins Zentrum zu stellen, wird sie vorwiegend an schweizerischen Gymnasien und Fachhochschulen verwendet. Dieser Umstand rechtfertigt wiederum die für eine Weltgeschichte leicht überproportionale Berücksichtigung des schweizerischen Kulturraums. Schließlich wurden in verschiedenen Kapiteln Themen der Sozial-, Umwelt- und Geschlechtergeschichte ergänzt oder vertieft. Didaktischen Zielen und vermehrter Benutzerfreundlichkeit dienen neue Verzeichnisse im Anhang: Ein Verzeichnis der Fachbegriffe und Fremdwörter erleichtert das Verständnis, und ein thematisches Register ermöglicht themenorientierten Unterricht in Längsschnitten. Ich danke zahlreichen hilfsbereiten und sachkundigen Kolleginnen und Kollegen für die wertvollen Hinweise und dem engagierten Verlagspersonal, insbesondere Heinrich M. Zweifel, für die gute Zusammenarbeit. Rudolf Schläpfer |
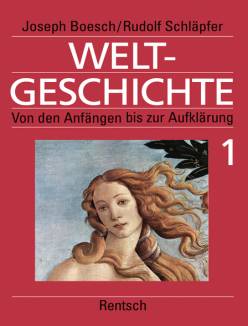
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen