|
|
|
Umschlagtext
In verständlicher und ansprechender Weise wird in diesem Buch psychologisches Grundwissen dargestellt, ohne das man heutzutage in Ausbildung und Praxis vieler Berufe nicht mehr auskommt.
Rezension
Dieses Buch bietet etwas, das in der Psychologie nicht immer anzutreffen ist: verständliche Sprache und das Bemühen um den Leser. Die Anzahl der Auflagen zeigt, dass das Buch gern gelesen wird. Es vermittelt umfassendes Grundwissen im Bereich der Psychologie und bleibt dabei weitgehend allgemein verständlich. Alle wesentlichen Teildisziplinen der Psychologie werden thematisiert: von der Entwicklungspsychologie bis zur Sozialpsychologie. Für LehrerInnen dürften die Lern- und die Motivationspsychologie von besonderem Interesse sein. Auch didaktisch ist das Buch gelungen: mit zahlreichen Abbildungen, Tabellen, Info-Kästen und einer schlüssigen Gliederung. Als Grundwissen Psychologie ist es deshalb überaus empfehlenswert.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Gerd Mietzels Einführung in die Psychologie ist inzwischen zu einem Standardwerk geworden. Auf verständliche und ansprechende Weise stellt der Autor das notwendige psychologische Grundwissen dar, ohne das man heutzutage in Ausbildung und beruflicher Praxis kaum mehr auskommt. Unter der Internet-Adresse: http://www.regiosurf.net/supplement finden die Leser ein interaktives multimediales Tutorium zu diesem Lehrbuch, das Möglichkeiten zur Vertiefung und Erweiterung des Gelesenen eröffnet. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
1. Ziele, Ansätze und Anwendungen in der Psychologie 11 1.1 Studium des Verhaltens und Erlebens als Aufgabe der Psychologie 12 1.2 Psychologie als Forschungsgebiet 15 1.2.1 Kritische Auseinandersetzung mit vorgefundenen Erklärungen und Herausarbeitung eigener Fragen 16 1.2.2 Einige Kennzeichen wissenschaftlicher Untersuchungen 17 1.3 Unterschiedliche Sichtweisen menschlichen Verhaltens 25 1.3.1 Die biologische Sichtweise 25 1.3.2 Die behavioristische Sichtweise 27 1.3.3 Die konstruktivistische Sichtweise. 34 1.3.4 Die psychoanalytische Sichtweise 37 1.3.5 Die humanistische Sichtweise. 41 1.3.6 Vergleich unterschiedlicher Sichtweisen 43 1.4 Einige Arbeitsbereiche der Angewandten Psychologie 44 1.4.1 Aufgaben Klinischer Psychologen. 46 1.4.2 Aufgaben von Arbeits-und Organisationspsychologen . 50 1.5 Erkenntnisse der Grundlagen- und der Angewandten Forschung in nachfolgenden Kapiteln 59 2. Psychologie der menschlichen Entwicklung 61 2.1 Kennzeichnung der Entwicklungspsychologie. 62 2.2 Methoden zum Studium von Veränderungen 64 2.2.1 Erfassung von Veränderungen im Längsschnitt 64 2.2.2 Erfassung von Veränderungen im Querschnitt. 66 2.2.3 Kombination von Längsschnitt-und Querschnittmethode. 67 2.3 Erklärungen von Veränderungen im menschlichen Lebenslauf 68 2.3.1 Biologische Grundlagen der Entwicklung. 68 2.3.2 Das Anlage-Umwelt-Problem 72 2.4 Ausgewählte Forschungsbereiche der Entwicklungspsychologie 88 2.4.1 Veränderungen im körperlich-motorischen Bereich 88 2.4.2 Sozial-emotionale Bindungen in der frühen Kindheit . 92 2.4.3 Entwicklung ausgewählter kognitiver Funktionen 98 2.4.4 Veränderungen im Lebenslauf, die eng oder nur geringfügig mit dem Alter zusammenhängen 103 3. Psychologie der Wahrnehmung 110 3.1 Sinnesorgane: Eingangspforte für physikalische Reize 111 3.1.1 Allgemeine Kennzeichen der Sinnesorgane 111 3.2 Aufbau und Funktionsweise des Sehorgans 119 3.2.1 Elektromagnetische Schwingungen als Grundlage visueller Wahrnehmungseindrücke 119 3.2.2 Umsetzung physikalischer Energie in nervöse Impulse durch Rezeptoren 120 3.2.3 Theorien zur Erklärung des Farbensehens 122 3.2.4 Verarbeitung und Weiterleitung visueller Informationen durch das Zentralnervensystem 125 3.3 Interpretation registrierter Reize durch Wahrnehmungsprozesse 128 3.3.1 Visuelle Reize als Grundlage der Wahrnehmung 129 3.3.2 Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. 131 3.3.3 Organisation der Wahrnehmung 141 3.3.4 Über das Zusammenwirken datenabhängiger und kognitionsgeleiteter Prozesse 152 4. Grundlegende Prozesse des Lernens 157 4.1 Kennzeichnung des Lernens 157 4.1.1 Unterscheidung zwischen Lernen und Verhalten. 157 4.1.2 Relativ überdauernde Verhaltensveränderung 158 4.1.3 Lernen als Ergebnis von Übung und Erfahrung 159 4.1.4 Theorien des Lernens 160 4.2 Lernen durch Konditionierung 162 4.2.1 Klassische Konditionierung 162 4.2.2 Operante Konditionierung. 173 4.3 Kognitive Sichtweisen des Lernens 191 4.3.1 Latentes Lernen und kognitive Landkarten 193 4.3.2 Vom Versuch-und-Irrtum-Verhalten zur Einsicht 194 4.3.3 Lernen durch Nachahmung von Vorbildern. 197 5. Das Problemlösen und seine Voraussetzungen 202 5.1 Entstehung und Anwendung von Begriffen . 203 5.1.1 Begriffe als Klassen 203 5.2 Exkurs: Ordnung und Kontrolle durch das Selbstkonzept 208 5.3 Anpassung an Umweltbedingungen durch Problemlösen 212 5.3.1 Stadien des Problemlösungsprozesses 212 5.3.2 Behinderung der Lösungssuche durch frühere Erfahrungen 220 5.4 Problemlösungsverhalten als Ausdruck der Intelligenz 223 5.4.1 Die Suche nach Methoden zur Messung der Intelligenz: Wege und Irrwege . . . 224 5.4.2 Bewältigung alltäglicher Probleme durch praktische Intelligenz 235 5.4.3 Die Umweltbedingtheit intelligenten Verhaltens 239 5.4.4 Wege der Intelligenzforschung: Vom Produkt zum Prozeß 240 6. Psychologie des Gedächtnisses 242 6.1 Gedächtnis als Informationsverarbeitung . 243 6.1.1 Das sensorische Register: Eingangspforte für Sinnesreize 245 6.1.2 Das Kurzzeitgedächtnis 248 6.1.3 Das Langzeitgedächtnis 255 6.2 Das Vergessen und seine Erklärung 265 6.2.1 Der Zerfall von »Spuren« 266 6.2.2 Wechselseitige Störung von früher und später Gelerntem: Interferenz 266 6.2.3 Unzugänglichkeit von Gedächtnisinhalten aufgrund fehlender Abrufreize . . . 267 6.2.4 Motiviertes Vergessen 268 6.3 Möglichkeiten der Förderung des Behaltens 269 6.3.1 Regeln zur Gestaltung der Übungstätigkeit . 270 6.3.2 Mnemotechniken als Hilfen bei der Erarbeitung von schwer organisierbarem Lernmaterial 275 7. Psychologie der Motivation 282 7.1 Motiviertes Verhalten und seine Erklärung 283 7.1.1 Kennzeichnung motivierten Verhaltens 283 7.1.2 Bestandteile motivationspsychologischer Erklärungen 285 7.2 Theorien einzelner Motivationsbereiche 288 7.2.1 Das Eßverhalten und seine Erklärung 288 7.2.2 Aggressionen und ihre Erklärung 295 7.2.3 Einige Bedingungen zur Förderung der Lernmotivation. 318 8. Psychologie der Gefühle und die Auseinandersetzung mit Streß 328 8.1 Kennzeichnung und Klassifikation der Gefühle 329 8.2 Die Rolle des autonomen Nervensystems und der Hormone 331 8.3 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Gefühlserlebnissen 336 8.3.1 Das Gehirn als zentrale Schaltstelle für Gefühlserleben und körperliche Reaktionen 337 8.3.2 Beziehungen zwischen körperlichen Veränderungen und bestimmten Gefühlserlebnissen 338 8.3.3 Gefühlserlebnisse als Ergebnis physiologischer Erregung und kognitiver Prozesse 342 8.3.4 Die Theorie entgegengesetzter Prozesse 346 8.4 Die Übermittlung von Gefühlserlebnissen in sozialen Kontakten . 349 8.4.1 Biologische Grundlagen des Gefühlsausdrucks 349 8.4.2 Regeln zur Darstellung von Gefühlen in sozialen Situationen 351 8.4.3 Möglichkeiten der Vortäuschung »falscher« Gefühle 354 8.5 Streß: Folgen und Bewältigung 357 8.5.1 Kennzeichnung von Streß 358 8.5.2 Entstehungsbedingungen von Streß 360 8.5.3 Persönlichkeit und Streßgefährdung 364 8.5.4 Möglichkeiten zur Abwehr von Streß 368 9. Psychologie sozialer Prozesse 374 9.1 Gewinnung eines Eindrucks von anderen durch soziale Wahrnehmung ....357 9.1.1 Die Entstehung erster Eindrücke 376 9.1.2 Ursachenzuschreibung in der Personenwahrnehmung 381 9.2 Unterschiedliche Wahrnehmung von Menschen aus Wir- und Fremdgruppen . . 392 9.3 Psychologie des Vorurteils 395 9.4 Von der Begegnung zur sozialen Anziehung 400 9.4.1 Vertrautheit durch wiederholte Begegnungen 401 9.4.2 Gleich und gleich gesellt sich gern 404 9.4.3 Die Norm der Gegenseitigkeit 405 9.4.4 Sozial-emotionale Bindung durch Liebe 406 9.5 Der Einfluß von Gruppen auf ihre Mitglieder 411 9.5.1 Bestimmung sozialer Wirklichkeiten . 412 9.5.2 Vermeidung sozialer Zurückweisung durch Anpassung an andere 413 9.5.3 Die Reaktion der Mehrheit auf ihre Außenseiter . 415 9.5.4 Veränderung von Mehrheitsüberzeugungen durch Außenseiter. 416 Literaturverzeichnis 421 Register 461 Bildnachweise 470 Interaktives Multimediales Tutorium 475 |
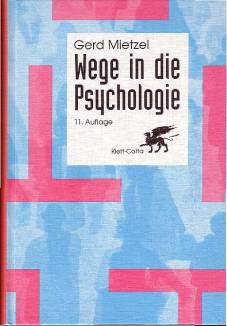
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen