|
|
|
Umschlagtext
Verstehen Sie besser, was Sie und andere Menschen wirklich bewegt!
Von Kindesbeinen an werden wir von verschiedensten inneren und äußeren Faktoren beeinflusst und angetrieben. Oft ist uns dabei nicht klar, was uns und unsere Familie wirklich bewegt. Aber nur wenn wir erkennen, was sich in unserem Inneren abspielt, können wir Entwicklungen bei uns und bei unseren Kindern tatsächlich beeinflussen und fördern. Der Entwicklungspsychologe Jürg Frick zeigt, wie wichtig Entwicklungsvorstellungen über sich und andere sind, welche Bedürfnisse, Lebensmotive und Lebensstile vorkommen, warum Kinder überhaupt groß werden möchten, welche Rolle der Schuleintritt, die Gleichaltrigen oder Ängste bei Heranwachsenden spielen, welche Schutzfaktoren (Resilienz) sowie Warnsignale für problematische Entwicklungen wir heute kennen, wie wichtig das Selbstvertrauen und das Selbstkonzept, aber auch das Neinsagen-Können für das Leben sind. Der Anhang enthält zur Vertiefung und Reflexion die Beschreibung von 28 Lebensstiltypen, ein persönliches Entwicklungspanorama sowie einen Entwicklungsfragebogen. Rezension
Im Prinzip handelt es sich bei diesem Buch um eine Entwicklungspsychologie des Kindes- un Jugendalters. Allerdings ist die Darstellung lebenspraktischer und verständlicher verfasst als viele entsprechende Bücher. Neben den sehr konkreten Phänomenen in dieser Lebensphase wie Ängste, Schuleintritt, Peers oder Suizidgefährdung werden auch umfassendere (Theorie-)Konzepte vorgestellt, in die die konkreten Phänomene eingeordnet werden können: Entwicklungsmodelle, Selbstkonzepte, Lebensstiltypen, Resilienz etc. Das alles ist sehr praxisrelevant verfasst und hilft, die konkreten Alltags- und Lebensprobleme von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen, zu begleiten und zu beeinflussen (Untertitel!).
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Geleitwort Franz Petermann 13
Vorwort 15 1. Einführung 19 Zum Aufbau dieses Buches 20 2. Wie wirken und wie beeinflussen uns Entwicklungsmodelle? 27 Zur Einführung: Acht Auffassungen über Entwicklung 28 Haupt-Typen von Entwicklungsmodellen 30 Wenn arme und schwarze Kinder von Natur aus dümmer sind 33 Unterstützen statt aufgeben: Der «Märtplatz» 35 Fragen und Denkanstöße 38 Literaturhinweise 38 3. Was treibt den Menschen an? 41 Einleitung 42 Ein Modell der Persönlichkeit: Entwicklungsfaktoren 42 Elf Grundbedürfnisse des Menschen 50 Die 16 Lebensmotive nach Reiss 54 Die vier Prioritäten des Menschen nach Schottky und Schoenaker 56 Quellen und Entwicklungswege der Prioritäten 61 Die 28 Lebensstiltypen nach Mosak/Frick 63 Schematische Darstellung der Entwicklung der Persönlichkeit 66 Fragen und Denkanstöße 67 Literaturhinweise 68 4. Mit dem «Entwicklungspfadmodell» Lebenswege besser verstehen 69 Einleitung 70 Entwicklungspfade und Entwicklungsbaum nach Sroufe 70 Entwicklungspfadmodell «Wanderung» 73 Der Entwicklungsverlaufzweier Schwestern 75 Ungünstiger und günstiger Entwicklungsverlauf 77 Entwicklungspfade als Muster 78 Indikatoren für ungünstige Entwicklungsverläufe 80 Indikatoren für günstige Entwicklungsverläufe 81 Fragen und Denkanstöße 82 Literaturhinweise 83 5. Warum möchten Kinder groß sein? 85 Drei Szenen 86 Kleine Kinder fühlen sich unterlegen 86 Sich stark fühlen über eigenes Tun 88 In der Peer-Gruppe die Identität entwickeln 90 Fragen und Denkanstöße 92 Literaturhinweise 92 6. Ängste im Kindes- und Jugendalter 93 Zum Einstieg: Einige Äußerungen über die Angst 94 Einleitung 94 Angst ist natürlich und notwendig 95 Angst und Entwicklungsabschnitte 96 Erscheinungsformen der Angst 98 Die Körpersprache der Angst 102 Schulängste 103 Übergangsobjekte und Fantasiegefährtinnen 104 Viele mögliche Auslöser und Ursachen von Ängsten 106 Wann ist Angst normal, wann wird sie problematisch? 109 Angststörungen 110 Gott und die Angst: Religiöse Ängste 112 Elterliche, erziehungsbedingte Einflussfaktoren 113 Wann ist Hilfe nötig? 115 Francescos Umgang mit der Angst 115 Von der Angst zum Mut: Viele Möglichkeiten derEinflussnahme 116 Der konstruktive Umgang mit Ängsten: Ein Beispiel 117 Fragen und Denkanstöße 121 Literaturhinweise 121 7. Welche Bedeutung hat der Schuleintritt? 123 Der Schuleintritt als psychologische Herausforderung für das Kind 124 Erwartungen und Erfahrungen in den ersten Schultagen und Schulwochen 130 Wie fühlen sich Kinder in der ersten Schulwoche? 133 Fragen und Denkanstöße 134 Literaturhinweise 135 8. Die Rolle von Peers und Freunden in Kindheit und Jugend 137 Einleitung 138 Zur Entwicklung des Freundschaftsbegriffs und zur Entwicklung von Freundschaften 139 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Peer-Freundschaften und Geschwister-Beziehungen 144 Weitere Merkmale, Bedeutungen und Möglichkeiten von Freundschafts- und Peer-Beziehungen im Kindes- und Jugendalter 145 Gibt es Störfaktoren für Freundschaften? 149 Freundschaftsförderndes elterliches Verhalten 149 Umgang und Unterstützung von Freundschaft durch Erzieherinnen und Lehrpersonen 150 Die acht wichtigsten Freundschaftsfaktoren 152 Freunde bedeuten Leben 155 Fragen und Denkanstöße 156 Literaturhinweise 156 9. Mit welchen Aufgaben werden Heranwachsende konfrontiert? 157 Einleitung 158 Das Konzept der Entwicklungsaufgaben 158 Stufenspezifische Entwicklungsaufgaben 159 Konflikte im Umgang mit Entwicklungsaufgaben 163 Worüber machen sich Jugendliche am meisten Gedanken? 164 Wann zählt man zu den Erwachsenen? 165 Spezifische Entwicklungsaufgaben 166 Die persönliche Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben: Gedanken einer Oberstufenschülerin 166 Entwicklungsaufgabe «Identität»: Aufsatz einer Oberstufenschülerin 169 Entwicklungsaufgaben und Coping-Strategien 171 Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Einflussfaktoren 175 Zum Schluss: Kein Ende! 176 Fragen und Denkanstöße 177 Literaturhinweise 178 10. Wie wichtig ist das Selbstkonzept? 179 Einleitung 180 Zur Entwicklung des Selbstkonzepts 180 Selbstkonzeptbereiche 182 Positive und negative Selbstkonzepte 186 Dynamisches und statisches Selbstkonzept 187 Die Differenzierung des Selbstkonzepts 189 Selbstkonzeptfaktoren in der Selbstbeschreibung einer 14-jährigen Heranwachsenden 191 Verhalten und Umfeld, Selbstkonzept und Leistung 193 Innere Stimmen als Ausdruck des Selbstkonzepts 194 Zur Veränderung des Selbstkonzepts 196 Gesellschaftliche Bewertung der Selbstkonzepte 196 Fragen und Denkanstöße 197 Literaturhinweise 198 11. Resilienz: Welche Schutzfaktoren helfen? 199 Einleitung 200 Das Risikofaktorenkonzept 200 Resilienz oder Resilienzen? 203 Resilienzfaktoren: Die wichtigsten Schutzfaktoren 204 Interaktion von Risiko und Resilienz: Ein Beispiel 210 Zu Chancen und Gefahren des Resilienzkonzeptes 212 Fragen und Denkanstöße I 213 Fragen und Denkanstöße II 215 Fragen und Denkanstöße III 216 Literaturhinweise 216 12. Zeichen und Warnsignale bei suizidgefährdeten Heranwachsenden 219 Der plötzliche Jugendsuizid aus heiterem Himmel: Ein Mythos 220 Was sind mögliche Zeichen oder Warnsignale für eine erhöhte Suizidgefahr bei Jugendlichen? 220 Wichtige Signale zur psychischen Situation I: Zeichnungen, Bilder, Illustrationen 223 Wichtige Signale zur psychischen Situation II: Gedichte und Notizen 227 «Trust is freedom»: Aufsatz einer 15-jährigen Oberstufenschülerin 228 Abschiedsbriefe 230 Nicht sterben, sondern nicht mehr leiden wollen oder können! 231 Merkpunkte zur Krisenintervention 232 Fragen und Denkanstöße 234 Literaturhinweise 234 13. Interview l: Merkmale, Wirkung und Entwicklung von Souveränität 235 Einleitung 236 Interview 236 Fragen und Denkanstöße 243 Literaturhinweise 243 14. Interview II: Wie wichtig ist Selbstvertrauen? 245 Einleitung 246 Interview 246 Fragen und Denkanstöße 250 Literaturhinweise 250 15. Interview III: Warum ist Neinsagen für die Entwicklung wichtig? 253 Einleitung 254 Interview 254 Denkanstöße und Denkangebote: Elf hilfreiche Punkte zum Neinsagen 262 Literaturhinweise 263 16. Hinweise für ein entwicklungsförderndes ABC des Lebens 265 Einleitung 266 ABC 267 Zum Schluss 271 Fragen und Denkanstöße 272 Literaturhinweise 272 17. Mit Aphorismen und Sprüchen (eigene) Entwicklungsprozesse anregen 275 Einleitung 276 Aphorismen und Sprüche - eine Auswahl 278 Fragen und Denkanstöße 288 Literaturhinweise 289 Anhang 291 Anhang A: Die 28 Lebensstiltypen nach Mosak/Frick 291 Anhang B: Persönliches Entwicklungspanorama 311 Anhang C: Kleiner Entwicklungsfragebogen 315 Literaturverzeichnis 317 Personenregister 347 Sachwortregister 351 |
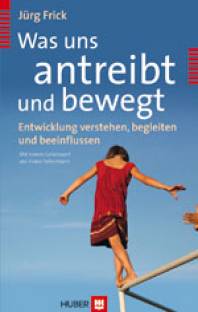
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen