|
|
|
Umschlagtext
Die meisten Menschen haben eine relativ einheitliche Vorstellung davon, wie das Sterben verläuft: in einem kurzen, oft im Zustand der Bewusstlosigkeit erfolgenden Übergang vom Leben zum Tod, verbunden mit dem Erlöschen der Vitalfunktionen.
Die Autoren zeigen die Einseitigkeit dieses und ähnlicher Denkmuster auf und führen neue, bislang nicht etablierte Sichtweisen ein. So geht das Buch z. B. der auf den ersten Blick überflüssig erscheinenden Frage nach, warum es schlimm ist, tot zu sein. Ein Kapitel widmet sich bewusst naiv gestellten Fragen, die wir alle im Bewusstsein unserer Vergänglichkeit in uns tragen. Für die Autoren ist hierbei eine leicht verständliche Vermittlung der Sachverhalte und das Aufwerfen von grundlegenden kritischen Fragen kein Gegensatz, sondern eine Grundvoraussetzung ihres Ansatzes. Das Buch vermittelt durch seine Beiträge einen vielschichtigen Blick auf die gesellschaftliche Diskussion zum Umgang mit Menschen in der Endphase ihres Lebens. Joachim Wittkowski, geb. 1945, ist Diplom-Psychologe und gehört als außerplanmäßiger Professor der Philosophischen Fakultät II der Universität Würzburg an. Einer seiner Forschungsschwerpunkte gilt Fragen zu Sterben, Tod und Trauer (Thanatopsychologie). Sein bei der WBG erschienenes Buch >Psychologie des Todes< war viel beachtet und wurde weithin rezipiert. Er ist aktives Mitglied der International Work Group on Death, Dying and Bereavement. Hans Strenge, geb. 1949, ist Privatdozent für Neurologie und Medizinische Psychologie, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie sowie stellvertretender Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie der Universität Kiel. Er beschäftigte sich u. a. mit den medizinischen und psychosozialen Aspekten von Herztransplantationen und den Einstellungen Studierender zur Organspende. Rezension
›Warum der Tod kein Sterben kennt‹ ist ein kontroverser Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion über den Umgang mit Menschen in der Endphase ihres Lebens. In einer zunehmend überalternden Gesellschaft werden die Themen Sterben / Tod immer virulenter, zumal sich durch neue medizintechnische Möglichkeiten viele neue ethische Fragestellungen mit dem Ende des Lebens verbinden: Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Patientenverfügung, Hospiz und Palliativmedizin, Organentnahme - um nur einiges zu nennen. U.a. zu diesen neureren Fragestellungen finden sich in disem Buch einschlägige Kapitel. Nicht weniger wichtig als das rasante Wachstum der technischen Eingriffsmöglichkeiten am und nach dem Ende des Lebens ist der Wandel des Umgangs mit Sterben und Tod in unserer postmodernen Gesellschaft. Das Buch vermittelt durch seine Beiträge einen vielschichtigen Blick auf die gesellschaftliche Diskussion zum Umgang mit Menschen in der Endphase ihres Lebens.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
WBG-Preis EUR 24,90 Buchhandelspreis EUR 29,90 Warum ist es schlimm, tot zu sein? Diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Frage stellen die Autoren dieses Buches und hinterfragen damit kritisch gängige Denkmuster. ›Warum der Tod kein Sterben kennt‹ ist ein kontroverser Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion über den Umgang mit Menschen in der Endphase ihres Lebens. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Kapitel 1: Der kulturgeschichtliche Hintergrund von Sterben und Tod 13 J. Wittkowski und H. Strenge 1.1 Anthropologische Prämissen 15 1.2 Allgemeine Kennzeichen des mittelalterlichen Weltbildes 16 1.3 Traditionelle Orientierungen gegenüber Sterben und Tod 17 1.4 Allgemeine Kennzeichen des modernen Weltbildes 18 1.5 Umgang mit Sterben und Tod in der Moderne 21 1.6 Das Todessystem 24 1.7 Resümee 26 Literatur 28 Kapitel 2: Sterben - Ende ohne Anfang? 29 J. Wittkowski 2.1 Sterben und Tod in der aktuellen öffentlichen Diskussion 30 2.1.1 Gleichsetzung oder Verwechslung von »Sterben« und »Tod« 30 2.1.2 »Guter Tod« und »gutes Sterben« 36 2.1.3 Auswirkungen eines unscharfen Sterbebegriffs 37 2.2 Sterben aus traditioneller medizinischer Sicht 39 2.3 Sterben aus Sicht der Verhaltenswissenschaften und der Palliativmedizin 41 2.3.1 Aspekte des Sterbens 41 2.3.2 Fehlen einer Begriffsbestimmung des Sterbens 41 2.3.3 Implizite Kennzeichnungen des Sterbens 44 2.3.4 Explizite Definitionen des Sterbens 54 2.3.4.1 Explizite Definitionen verschiedener Provenienz 54 2.3.4.2 Explizite Definitionen aus dem Bereich der Soziologie 60 2.3.4.3 Resümee 63 2.4 Ein umfassender Begriff des Sterbens 64 2.4.1 Die eigene Defintion 64 2.4.2 Erläuterung der eigenen Definition 67 2.4.3 Wie man zum Sterbenden werden kann 69 2.5 Gültigkeitsbereich des psychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Sterbebegriffs 72 2.5.1 Sterben aufgrund einer körperlichen Krankheit 73 2.5.2 Sterben infolge eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe 77 2.5.3 Sterben infolge äußerer Gewalteinwirkung 78 2.5.4 Hinrichtung 78 2.5.5 Sterben durch eigene Hand 80 2.5.6 Sterben als Kleinkind/Plötzlicher Kindstod 81 2.5.7 Sterben im hohen Alter bzw. an Altersschwäche 82 2.6 Sterben - Ende mit Anfang! 85 2.7 Konsequenzen aus einem psychologisch-verhaltenswissenschaftlichen Konzept des Sterbens 88 2.7.1 Forschung 89 2.7.2 Begleitung und Betreuung Sterbender 91 2.7.3 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Betreuungspersonen 92 2.7.4 Entscheidungen auf politischer Ebene und Rechtsprechung 94 Literatur 96 Kapitel 3: Leben und Tod in den Zeiten der Organverpflanzung 105 H. Strenge 3.1 Einleitung 105 3.2 Das Konstrukt des Hirntodes 106 3.2.1 Klinische Kriterien 107 3.2.2 »Kritische« Kriterien 108 3.3 Der Hirntod und seine Erscheinung 111 3.3.1 Das klinische Bild: Schein der Lebendigkeit 111 3.3.2 Das emotionale Bild 112 3.3.3 Betreuung an der Nahtstelle: Der verordnete Statuswechsel 117 3.4 Todesdiagnostik und Interaktionen beim Organspendevorhaben in der Praxis 119 3.4.1 Die Diagnostik des Todeszeitpunkts 119 3.4.2 Interaktionen beim Transplantationsvorhaben 121 3.5 Schwangere Hirntote: Lebensspende einer Toten 125 3.6 Herztod und Organverpflanzung 126 3.6.1 Maßnahmen zur Unterstützung des medizinisch kontrollierten Sterbens 129 3.6.2 Interessenkonflikte vor kontrolliertem Herztod und Organspende 131 3.7 »Dead donor rule« und neue Aspekte 132 3.8 Der versprachlichte Tod: Linguistischer Lackmustest für Klarheit? 136 3.9 Unvereinbare Todesauffassungen 139 3.10 Sterben als letzter Lebensvollzug: Angewiesen auf Anerkennung,durch andere? 141 3.11 Leben und Sterben: Neue Konzeptionen? 145 3.12 Zusammenfassung und Ausblick 149 Literatur 155 Kapitel 4: Ethische Betrachtungen zur Hirntod-Problematik 163 W. Lenzen 4.1 Einleitung 163 4.2 Die »Minimalethik« des Neminem laedere 163 4.3 Epikurs Irrtum - oder: Wieso es doch schlimm ist, tot zu sein 166 4.4 Empfängnisverhütung und Abtreibung 169 4.5 Posthume Geburt 172 4.6 Ethische Probleme der Organtransplantation 176 4.6.1 Explizite Einwilligung oder fehlender Widerspruch? 176 4.6.2 Zur Problematik des Hirntodes 179 Literatur 187 Kapitel 5: Fragwürdiges zu Leben, Sterben und Tod. Psychologische, medizinische und philosophische Perspektiven 190 W. Lenzen, H. Strenge und J. Wittkowski 5.1 Allgemeine Aspekte 190 5.2 Leben 192 5.3 Sterben 196 5.4 Tod 199 5.5 Ethische Aspekte 204 Kapitel 6: Zeitgemäße Choreographien bei der Begegnung mit Leben und Tod 211 H. Strenge und J. Wittkowski 6.1 Der Staat als Lieferant kollektiver Sicherheit und die Endlichkeit des Lebens 213 6.2 Die Bedeutung der politischen Strukturen für die Wahrnehmung von Sterben und Tod 214 6.3 Der Einfluss deutungsmächtiger Interessengruppen auf die Kennzeichnung von Sterben und Tod 217 6.3.1 Der Tod und die leise Hintergrundaktivität der Gewebemedizin 218 6.3.2 Der Tod und die machtvolle Einflussnahme des Verwandtschaftssystems 220 6.3.3 Das Sterben in Hospizarbeit und Palliativmedizin 221 6.4 Fazit und Ausblick 223 Literatur 226 Register 229 Weitere Titel aus der Reihe Wissen |
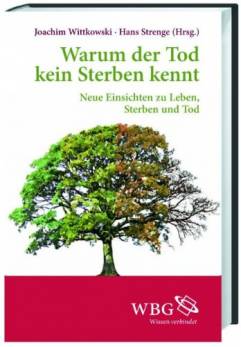
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen