|
|
|
Rezension
Antje-Karina Gerwins Dissertationsschrift „Vom Weghörer zum Hinhörer“ ist ein ausgesprochen fundierter und zugleich praxisnaher Beitrag zur musikpädagogischen Forschung. Im Zentrum steht die Frage, wie Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Erprobungsstufe gezielt für das bewusste Hören sensibilisiert werden können – ein Anliegen, das im schulischen Musikunterricht zwar häufig betont, aber selten systematisch umgesetzt wird.
Gerwin analysiert in ihrem Buch zunächst die Stellung des Hörens im Kontext der allgemeinen Sinneswahrnehmung und greift dabei auch auf Erkenntnisse der Neurowissenschaften zurück. Besonders eindrucksvoll ist ihre Schilderung der veränderten Hörgewohnheiten heutiger Jugendlicher und der akustischen Reizüberflutung, die in vielen Lebenswelten den differenzierten Umgang mit Klang erschwert oder überlagert. Aus dieser Diagnose entwickelt sie ein pädagogisches Konzept, das Hören nicht nur als rezeptive Fähigkeit versteht, sondern als aktiven, reflexiven Prozess. Besonders wertvoll für die Unterrichtspraxis sind die im Buch dargestellten Unterrichtsbausteine und konkreten Beispiele. Gerwin bezieht akustische Täuschungen ebenso ein wie gezielte Hörübungen, die nicht nur das auditive Wahrnehmungsvermögen schulen, sondern auch ästhetisches Erleben fördern. Dazu tragen insbesondere die skizzierten Unterrichtsbeispiele zu György Ligeti bei. Ihre Beispiele zeigen, wie sich über das Hören Verbindungen zu anderen Fächern und Sinnesbereichen herstellen lassen – etwa im interdisziplinären Zugang zu Sprache, Bewegung oder bildender Kunst. Für Musiklehrkräfte, die in der Sekundarstufe I unterrichten, bietet „Vom Weghörer zum Hinhörer“ eine wertvolle theoretische Grundlage ebenso wie zahlreiche Impulse für die Unterrichtsgestaltung. Das Buch eignet sich sowohl für die Aus- und Fortbildung als auch als Ideengeber für erfahrene Lehrpersonen, die den oft unterschätzten Bildungswert des Hörens wieder stärker in den Mittelpunkt rücken möchten. Ein lesenswerter Beitrag, der bewusst macht, dass Hören mehr ist als Wahrnehmung – nämlich ein Bildungsprozess im besten Sinne. Verlagsinfo
Wie wird man von einem Weghörer zu einem Hinhörer? Die Fähigkeit und Bedeutung des Hörens und Zuhörens scheint in unserer heutigen Gesellschaft in den Hintergrund getreten zu sein. Der Mensch wird häufig als "optisches Wesen" bezeichnet. Unsere Umwelt ist in den letzten Jahrzehnten durch die Industrialisierung, Globalisierung und damit verbundene Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft stetig lauter geworden. Diese "akustische Umweltverschmutzung" muss sich auf unsere nicht-verschließbaren und ständig geöffneten Ohren und das Hören in irgendeiner Form ausgewirkt haben. "Vom Weghörer zum Hinhörer" beleuchtet das Verhältnis unserer Sinne zueinander mit Fokus auf den Hörsinn. Dabei werden Erkenntnisse aus verschiedenen Teildisziplinen unter besonderer Berücksichtigung der Neurowissenschaften herangeführt. Unterrichtsbeispiele zu akustischen Täuschungen dienen als Anregung für den Schulunterricht. Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Autorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi 1. Kontextanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1 Visuelle Sammlungen kontra Klang-Konservierungen . . . . . . . 1 1.2 Die Weghör-Gesellschaft als Folge akustischer Umweltverschmutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2.1 „Phonopollution“ 6 1.2.2 Weghören als Schutzmechanismus 7 1.3 Erziehung zum Weghören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.4 Bereitschaft zum Hinhören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. Der Visualprimat historisch betrachtet – ein kurzer Rückblick auf die Sinnesorgane Auge und Ohr und deren Verhältnis zueinander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1 Auge contra Ohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1.1 Vorzüge des Sehsinns? 20 2.1.2 „Der Adel des Hörens“ 23 2.2 Kritik am Visualprimat – Plädoyer fürs Hören . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.3 Von der Gleichberechtigung der menschlichen Sinne . . . . . . . 35 3. Die Bedeutung des (Musik-) Hörens in ausgewählten Lebensstadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1 Pränatales Hören und die Zeit nach der Geburt . . . . . . . . . . . . . 40 3.2 Der Eintritt in das (Grund-) Schulleben und die Erprobungsstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.3 Später Lebensabend und Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4. (Zu-) Hören? (Zu-) Hören! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.1 (Zu-) Hören als Grundlage von Kommunikation . . . . . . . . . . . . 59 4.2 Die Individualität des (Musik-) Hörens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.3 Arten des (Zu-) Hörens und Horchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4.3.1 Typologisierung nach Tischler und Moroder-Tischler . . . . 69 4.3.2 Fünf Hörwinkel nach Jünger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.4 Warum ist differenziertes (Zu-) Hörenlernen wichtig? . . . . . . . 73 4.5 Aktive Musikhörer mittels „Hören durch Tun“ . . . . . . . . . . . . . . 75 4.5.1 „Hören durch Tun“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.5.2 Aktives Musikhören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.6 Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5. Rekurs auf klassische musikpädagogische Ansätze zum Hören . . . 85 5.1 Fritz Jöde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5.2 Michael Alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5.3 Dankmar Venus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5.4 Heinz Antholz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5.5 Hermann Rauhe, Hans-Peter Reinecke und Wilfried Ribke . . . 103 5.6 Christoph Richter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.7 Auditive Wahrnehmungserziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6. Aspekte des Hörens in gegenwärtigen musikpädagogischen Ansätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.1 Bläserklassen als Beispiel für Musizierklassen . . . . . . . . . . . . . . . 117 6.1.1 „Essential Elements“ und „Junior Band“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.1.2 „Leitfaden Bläserklasse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6.1.3 „Addizio!“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6.2 Live-Arrangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.3 Musik – Bewegung – Tanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 6.4 Aufbauender Musikunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6.5 Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 7. Ideen zur Umsetzung im Schulunterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.1 Urs Frauchiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 7.2 Gerhard Sammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 7.3 Zwischenfazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 8. Akustische Täuschungen als Schlüssel zum Hörenlernen . . . . . . . . 141 8.1 Neurobiologische und entwicklungspsychologische Begründungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 8.2 Didaktische Perspektiven und Anknüpfungspunkte . . . . . . . . . 150 8.3 Ein Seitenblick auf die Lehrpläne und Richtlinien (NRW) . . . 153 9. Ent-Täuschungen durch Hören: György Ligeti als Klang-(Flächen-)Magier und Hörerzieher im Musikunterricht . . 157 9.1 Zum Begriff der „Ent-Täuschung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 9.2 Warum Musik von György Ligeti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 9.3 Warum Schüler der Erprobungsstufe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 10. Unterrichtsbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.1 Beispiel 1: Atmosphères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.1.1 Entfaltung der Unterrichtsreihe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 10.2 Beispiel 2: Selbstportrait mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 10.2.1 Sachanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 10.2.2 Entfaltung der Unterrichtsreihe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 10.3 Methoden der Unterrichtseihen 1 und 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 10.4 Ziele der Unterrichtsreihen 1 und 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 11. Weitere mögliche Unterrichtsgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 11.1 Täuschungen mit der „Shepard-Skala“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 11.1.1 Ligeti: Klavieretüde: „Columna Infinitâ“ . . . . . . . . . . . . . . . 179 11.1.2 Ligeti: Klavieretüde „L’escalier du diable“ . . . . . . . . . . . . . . 179 11.1.3 Pink Floyd: „Echoes“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 11.2 Täuschungen durch Ergänzungen im Kopf des Hörers . . . . . . . 181 11.2.1 John Lennon: „Imagine“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 11.2.2 Tim Bendzko: „Muss nur noch kurz die Welt retten“ . . . . . 181 12. Rechtliche Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 12.1 (Ge-)hörSCHUTZ – Rechtliche Grundlagen im Umweltschutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 12.2 (Ge-)hörBILDUNG – Rechtliche Grundlagen in den Lehrplänen (NRW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 12.2.1 G8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 12.2.2 G9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 13. Exkurs: Hörvermittlung in der akademischen Musiklehrerausbildung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 14. Schlussbetrachtung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Dank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 |
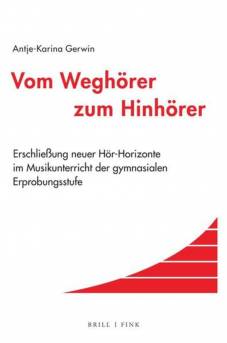
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen