|
|
|
Umschlagtext
Wenn ein Kind auf dem Gebiet der Schriftsprache versagt, ist es unerlässlich, die Ursachen dafür zu kennen, um ihm möglichst gezielt helfen zu können. Methoden der genauen Beobachtung werden hier ausführlich und praxisnah vorgestellt.
Aus den Ergebnissen lässt sich dann mit Hilfe dieses Buches ein spezifischer Förderplan erarbeitet, und zwar für schulische LRS- Gruppen wie auch für außerschulische Einzelförderung. Das breite Repertoire der vorgeschlagenen Arbeitsformen kann im Sinne von Prävention und Integration oft auch im Regelunterricht angewendet werden. Rezension
Was tun, wenn ein Kind nicht richtig Schreiben und Lesen kann? Besonders kommt es hierbei auf eine richtige Diagnose und schnelle Förderung an. In diesem Buch sind detaillierte Hintergründe über die so genannte Lese-Rechtschreib-Schwäche aufgeführt. Von der Diagnose bis zur Förderung ist alles genauestens beschrieben. Zum leichteren Verständnis ist ein Fallbeispiel aufgeführt.
Zu Beginn einer jeden Diagnose ist die Beobachtung das Wichtigste. Hierfür ist extra ein Beispiel-Beobachtungsbogen enthalten, der kopiert und genutzt werden kann. Ebenfalls ist ein Elterngesprächsbogen sowie einzelne Förderpläne enthalten. Dieses Buch hilft einem dabei, schnell zu Ergebnissen und damit zu einer raschen Förderung zu kommen. Es sind alle Informationen nicht nur theoretisch beschrieben sondern auch praxisnah erklärt. B.Bühler, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
LRS-Schüler
Einleitung 0. Dennis- ein Kind mit besonderen Bedürfnissen I. Welchen technischen Stand hat ein Kind im Schreib-Lese-Prozess 0. Teilstrategien des Lesens und Schreibens und ihre Beobachtung 1. Konsequenzen für die LRS- Förderung 2. Die Grundsatzentscheidung für ein Förderkonzept 2.1 Lautgetreues Frühtraining 2.2 Ganzheitliches Training im Regelbereich II. Überlegungen zur Untersuchung von Vorläuferfunktionen des Lesens und Schreibens 1. Was fehlt Dennis, was braucht Dennis? Funktionsmodell vs. Entwicklungsmodell 2. Multikausale Verursachung der LRS: ein Überblick III: Die gezielte Einzelbeobachtung 1. Vorbemerkung 2. Verhalten und anamnetischer Hintergrund 2.1 Informelle Verhaltensbeobachtung 2.2 Leitfaden für ein anamnetisches Elterngespräch 3. Der LRS- Beobachtungsbogen 3.1 Gleichgewichtsempfinden 3.2 Koordination, Körperschema, Tonus 3.3 Seitigkeit 3.4 Augenfunktionen 3.5 Taktiles Empfinden, Hand-, Finger- und Graphomotorik 3.6 Hinweise, die ein Entspannungs-, Konzentrations-, bzw. Gedächtnistraining sinnvoll erscheinen lassen 3.7 Rhythmusgefühl, Zeitempfinden, Selbststeuerung 3.8 Auditive Wahrnehmung und Sprachfunktionen 4. Förderplan für Einzelschüler 5. Gruppenförderplan 6. Hilfsstellen und -adressen IV: Die Durchführung des Beobachtungsverfahrens 1. Vorbemerkungen 1.1 Schwächen und Stärken erkennen! 1.2 Hinweis zur Intelligenzmessung 2. Verhalten und anamnetischer Hintergrund 2.1 Die Informelle Verhaltensbeobachtung 2.2 Die Durchführung des anamnetischen Elterngesprächs 3. Durchführungshinweise zur gezielten Einzelbeobachtung 3.1 Gleichgewichtsempfinden 3.2 Koordination, Körperschema, Tonus 3.2.1 Koordination 3.2.2 Körperschema 3.2.3 Tonus 3.3 Seitigkeit und Wahrnehmungsrichtung 3.3.1 Handseitigkeit 3.3.2 Wahrnehmungsrichtung 3.3.3 Visuelle Seitigkeit 3.3.4 Auditive Seitigkeit 3.3.5 Zusammenfassende Beurteilung 3.4 Augenfunktionen 3.4.1 Augenmotorik und Gesichtsfeld 3.4.2 Hinweise auf Sehschärfe und Farbtüchtigkeit 3.4.3 Auge/Hand-Koordination 3.4.4 Weitere Hinweise 3.5 Taktile Wahrnehmung, Hand-, Finger- und Graphomotorik 3.5.1 Taktile Wahrnehmung 3.5.2 Hand-, Finger- und Graphomotorik 3.6 Hinweise, die ein Entspannungs-, Konzentrations- und Gedächtnistraining sinnvoll erscheinen lassen 3.7 Rhythmusgefühl, Zeitempfinden und Selbststeuerung 3.8 Auditive Wahrnehmung 3.8.1 Auditive Wahrnehmung 3.8.2 Mund- und Sprechmotorik 3.8.3 Sprache 4. Die Bewertung psychosozialer Einflüsse 5. Einkleidung der Beobachtung in eine Märchenhandlung 6. Praxiserfahrungen 6.1 Allgemeine Hinweise 6.2 Beispiele für ein gestrafftes Vorgehen auf der SEK I 6.2.1 Fünf weiter Kinder mit besonderen Bedürfnissen 6.2.2 Die Informelle Verhaltensbeobachtung 6.2.3 Das anamnetische Elterngespräch 6.2.4 Die gezielte Beobachtung von Vorläuferfunktionen 6.2.5 Konsequenzen 6.2.6 Zusammenfassung V. Funktionstraining nach dem Förderplan 1. Notwendigkeit und Stellenwert eines sprachfreien Funktionstrainings 2. Parallelisierung von Beobachtungsprotokoll und Fördervorschlägen 3. Vorschläge für Standardanfänge von Förderstunden 3.1 Gleichgewichtsempfinden 3.2 Training von Koordination, Körperschema 3.3 Stabilisierung der Seitigkeit und Wahrnehmungsrichtung 3.4 Visuelle Sensibilisierung: Augenfunktionen und andere Trainingsbereiche 3.5 Taktiles Empfinden, Hand-, Finger- und Graphomotorik 3.6 Entspannungs-, Konzentrations- und Gedächtnistraining 3.7 Rhythmusgefühl, Zeitempfinden, Selbststeuerung 3.8 Auditive Wahrnehmung und Sprachfunktionen 4. Aufstellen weiterer Funktionsübungen 4.1 Gleichgewichtswahrnehmung 4.2 Training von Koordination, Körperschema und Tonus 4.3 Stabilisierung von Seitigkeit und Wahrnehmungsrichtung 4.4 Visuelle Sensibilisierung 4.4.1 Training der Augenmotorik 4.4.2 Training der Auge/Hand Koordination 4.4.3 Visuelles Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstraining 4.4.4 Gruppenspiele zu visuellen Teilfunktionen 4.5 Taktiles Empfinden, Hand-, Finger- und Graphomotorik 4.5.1 Taktile Wahrnehmung allgemein 4.5.2 Graphomotorische Basisfunktionen: Arm- Hand und Fingerübungen 4.6 Entspannungs-, Konzentrations- und Gedächtnistraining 4.6.1 Entspannung 4.6.2 Konzentrations- und Gedächtnistraining 4.7 Rhythmusgefühl, Zeitempfinden, Selbststeuerung 4.7.1 Rhythmisches Training 4.7.2 Zeitempfinden 4.7.3 Hilfen zur Selbststeuerung 4.8 Auditive Wahrnehmung und Sprachfunktion 4.8.1 Auditive Sensibilisierung 4.8.2 Exkurs: Schulexternes Training bei zentralen Hörstörungen 4.8.3 Bewegungsübungen der Sprechmotorik 4.8.4 Übungen zur Steigerung der Sprachsensibilität VI. Lese- und Schreibtraining nach dem Förderplan 1. Gleichgewichtsempfinden 2. Koordination, Köperschema, Tonus 2.1 Koordination 2.2 Körperschema 2.3 Tonus 3. Seitigkeit: Hilfen für Linkshänder und richtungsunsichere Kinder 4. Augenfunktionen 4.1 Hinweise zum Druck von Lesetexten und Arbeitsvorlagen 4.2 Einsatz von Farben, auch in Computer-Programmen 4.3 Weitere optische Lesehilfen, auch mit dem Computer 4.4 Zusammenstellung vorwiegend optisch orientierter Übungsformen zum Wortbildtraining 4.4.1 Arbeit mit Wort-, Bild und Buchstabenkarten 4.4.2 Geheimschriften Exkurs: NLP und Rechtschreibtherapie 5. Taktiles Empfinden, Hand-, Finger- und Graphomotorik 5.1 Taktile Wahrnehmung allgemein 5.2 Graphomotorisches Basistraining 5.3 Auge-Hand-Koordination 5.4 Schreibmotorische Entlastung 5.5 Die Arbeit mit Handzeichen 6. Entspannungs-, Konzentrations- und Gedächtnistraining 6.1 Entspannung 6.2 Konzentration 6.3 Gedächtnis: Formen der systematischen Wiederholung 7. Rhythmusgefühl, Zeitempfinden, Selbststeuerung 7.1 Intensives sprachrhythmisches Silbentraining 7.2 Zeitempfinden 7.3 Selbststeuerung, Selbstinstruktion 7.4 Unmittelbares Erfolgs- Feedback 8. Auditive Sensibilisierung und sprachliche Basisfunktionen 8.1 Steigerung der phonematischen Bewusstheit 8.2 Sprechmotorische Hilfen 8.3 Akustisch-sprechmotorische Leseübungen 8.4 Übungen zu Steigerung der Sprachsensibilität 8.5 Sinnvolles Üben und Lernen 8.5.1 Ansprechen aller Sinne 8.5.2 Gesprochene Sprache und Semantik 8.5.3 Plädoyer für den Grundwortschatz 8.6 Weitere methodische Vorschläge für das Schreiben 8.7 Weitere methodische Vorschläge für das Lesen 8.8 Der Aspekt der Lauttreue und die Stufung der Buchstabenfolge als methodisch didaktisches Grundprinzip der Prävention im Erstlese- und Schreibunterricht und in der LRS- Frühförderung VII. Anhang 1. Teilleistungsschwächen als Hintergrund von Legasthenie und Verhaltensauffälligkeiten- ein theoretischer Überblick 1.1 Schwerkraftwahrnehmung- Propriozeption- taktiles Empfinden 1.2 Bilateralintegration, Seitigkeit und Wahrnehmungsrichtung 1.3 Sehen 1.4 Hören 1.5 Sprachstörungen als Störungen der geistigen Entwicklung 1.6 Synopse medizinischer und biochemischer Risiken 1.7 Abschließende Überlegungen 2. Die Arbeit mit LRS- Schülern im Regelunterricht 3. Barbara von Ende und Reinhild Fincke-Samland: Kinder lernen Schreiben und Lesen im projektorientierten Unterricht: Möglichkeiten der LRS- Prävention im differenzierenden Schriftspracherwerb 4. Die Einbeziehung der Eltern in die Förderarbeit 5. Die Hess. LRS- Verordnung vom 22.10.1985 6. Erkennen von LRS- Schülern in der Orientierungsstufe Literatur Stichwortverzeichnis |
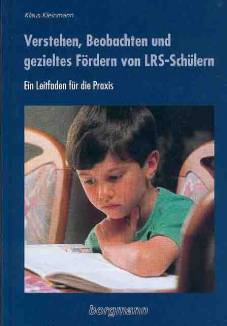
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen