|
|
|
Umschlagtext
1933 wurden im nationalsozialistischen Deutschland in konzertierten Aktionen hunderttausende Bücher missliebiger Autor:innen öffentlich verbrannt. Diese Bücherverbrennungen waren mehr als nur eine kulturpolitische Säuberungsaktion, sie waren zentraler Bestandteil im komplexen Gefüge des nationalsozialistischen Machtdurchsetzungsprozesses. Sie in ihrer Gesamtheit zu betrachten, hat sich das Projekt Verbrannte Orte zum Ziel gesetzt und mittlerweile über 160 Bücherverbrennungen dokumentiert: als Fotografien jener Orte, wie sie heute aussehen. Sie zeigen unspektakuläre Plätze der Alltäglichkeit, nur an wenigen weisen Erinnerungszeichen auf das Geschehene hin. Wie aber betrachten wir diese Orte, wenn wir wissen, was dort passiert ist?
Eine Auswahl der Fotografien steht im Mittelpunkt des Buches. Ergänzt werden diese durch Texte, welche die Hintergründe der Bücherverbrennungen beleuchten. Einige Biografien betroffener Autor:innen werden vorgestellt und durch einen detaillierten Blick auf das Thema Exil begleitet. Außerdem wird erörtert, was die Bücherverbrennungen von 1933 mit Demokratie und Meinungsfreiheit von heute zu tun haben. Rezension
Dresden, Braunschweig, Heidelberg, Kaiserslautern, Berlin, Düsseldorf, Magdeburg, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Greifswald, Hannover, Halle an der Saale, Hamburg, Mannheim, Lübeck, Schwerin, Mainz, Freiburg, Erfurt, Ulm und Rendsburg. Was verbindet diese Städte miteinander? Hier fanden von März bis Oktober 1933 öffentliche Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten statt. Insgesamt lassen sich für den Zeitraum 160 öffentliche Bücherverbrennungen nachweisen. Verbrannt wurden hunderttausende Bücher von Schriftsteller:innen, Publizist:innen und Wissenschaftler:innen, die den Nazis missfielen. In die Flammen geworfen wurden u.a. Werke von Heinrich Mann, Carl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, Karl Kraus, Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Arnold Zweig, Erich Kästner, Karl Marx, Sigmund Freud und auch von heute weniger bekannten Autor:innen wie Alice Berend, Ernst Weiß, Josef Hofbauer, Adrienne Thomas und Eva Leidmann. Zahlreiche Schriftsteller:innen und Intellektuelle mussten darauf ins Exil fliehen. Es gibt nur wenige Gedenkorte, die an die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen erinnern. Am bekanntesten ist das Mahnmal auf dem Bebelplatz in Berlin mit leeren in den Boden eingelassenen Regalreihen.
Als umso verdienstvoller ist es anzusehen, dass das Gedenkprojekt „Verbrannte Orte“ die Orte der Bücherverbrennungen dokumentiert hat. Dazu wurden die genauen Plätze, Straßen, Stadien und Felder, auf denen die Scheiterhaufen errichtet und die Werke verbrannt wurden, identifiziert sowie in ihrem gegenwärtigem Zustand fotografiert. Die Ergebnisse finden sich veröffentlicht in dem Band „Verbrannte Orte. Nationalsozialistische Bücherverbrennungen in Deutschland“, erschienen 2023 im Mandelbaum Verlag. Herausgegeben wird das Buch von Jan Schenck, dem Gründer des Gedenkprojekts. Es enthält eine Auswahl der identifizierten Orte der Bücherverbrennungen. Jeweils auf einer Doppelseite werden die heutigen Standorte der Bücherverbrennungen abgelichtet, zudem sind Informationen zu deren Ablauf und Organisation, zum Teil mit Auszügen aus örtlichen Tageszeitungen abgedruckt. Außerdem enthält das Buch fünf aufschlussreiche Texte über die Hintergründe der Bücherverbrennungen. Lehrkräfte der Fächer Geschichte und Deutsch werden durch den vorliegenden Band motiviert, sich in ihrem Fachunterricht mit den Bücherverbrennungen oder in einem fächerübergreifenden Projekt mit dem Thema „Nationalsozialistische Machtübernahme vor Ort“ auseinanderzusetzen. Fazit: Der Band „Verbrannte Orte. Nationalsozialistische Bücherverbrennungen in Deutschland“ leistet einen wichtigen Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur und ist zugleich als eine politische Mahnung zu lesen. Denn Heinrich Heine erkannt schon 1823 in seiner Tragödie „Almansor“: „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“ Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Jan Schenck (Hg.) Verbrannte Orte Nationalsozialistische Bücherverbrennungen in Deutschland 1933 wurden im nationalsozialistischen Deutschland in konzertierten Aktionen hunderttausende Bücher missliebiger Autor:innen öffentlich verbrannt. Diese Bücherverbrennungen waren mehr als nur eine kulturpolitische Säuberungsaktion, sie waren zentraler Bestandteil im komplexen Gefüge des nationalsozialistischen Machtdurchsetzungsprozesses. Sie in ihrer Gesamtheit zu betrachten, hat sich das Projekt Verbrannte Orte zum Ziel gesetzt und mittlerweile über 160 Bücherverbrennungen dokumentiert: als Fotografien jener Orte, wie sie heute aussehen. Sie zeigen unspektakuläre Plätze der Alltäglichkeit, nur an wenigen weisen Erinnerungszeichen auf das Geschehene hin. Wie aber betrachten wir diese Orte, wenn wir wissen, was dort passiert ist? Eine Auswahl der Fotografien steht im Mittelpunkt des Buches. Ergänzt werden diese durch Texte, welche die Hintergründe der Bücherverbrennungen beleuchten. Einige Biografien betroffener Autor:innen werden vorgestellt und durch einen detaillierten Blick auf das Thema Exil begleitet. Außerdem wird erörtert, was die Bücherverbrennungen von 1933 mit Demokratie und Meinungsfreiheit von heute zu tun haben. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
Jan Schenck „Verbrannte Orte“ 9 Zur Entstehung eines Gedenkprojekts Werner Treß Die Bücherverbrennungen 1933 13 Hintergründe, Betroffene und Phasen Jan Schenck Betrachten wir Orte anders, wenn wir 25 wissen, was dort geschehen ist? Aufnahmen Andrea Voß Über die Verb(r)annten 151 Sylvia Asmus „Man darf da nicht bequem werden 167 und die Augen schließen“ Literatur und Exil John Steinmark Meinungsfreiheit und die Vernichtung 179 des Demokratischen Über die anhaltende Aktualität der Bücherverbrennungen Verwendete und weiterführende Literatur 185 Autor*innen 189 Ortsverzeichnis 191 |
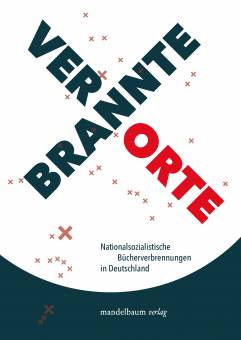
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen