|
|
|
Umschlagtext
Schicksale von DDR-Heimkindern
Von den Eltern im Stich gelassen oder vernachlässigt. An den Rand gedrängt, weil sie politisch oder sozial nicht angepasst waren – knapp 500.000 Kinder und Jugendliche haben das Heimsystem der DDR durchlaufen. Ihre Erfahrungen sind oftmals von Gewalt und Unterdrückung geprägt. Angelika Censebrunn-Benz befasst sich seit Jahren mit der Geschichte der Jugendhilfe in der DDR. Sie hat zahlreiche ehemalige Heimkinder getroffen und interviewt. In ihrem Buch gibt sie einen Überblick über die Geschichte der Zwangserziehung in der DDR und zeichnet in einfühlsamen Porträts Lebenswege ehemaliger Heimkinder nach. Mit einem Vorwort von Wolfgang Thierse Rezension
Mehr als 30 Jahre ist es nun her, dass die Deutsche Einheit vollzogen wurde. Manche Wunden aber bleiben, unabhängig historischer Ereignisse. Genau eine dieser Ursachen rückt das vorliegende Buch der Historikerin Angelika Censebrunn-Benz in den Fokus der Leserschaft. In der Tat ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte: der Umgang staatlicher Stellen mit Kindern und Jugendlichen, die ihre maßgebliche Entwicklungs- und Reifungszeit in den Heimen der ehemaligen DDR verbringen mussten.
Einleitend skizziert die Autorin das ausgeklügelte System des DDR-Heime, den Aufbau, die Grundlagen und Zielsetzungen der "Erziehung" in den genannten Heimen. Einen breiten Raum widmet Cernsebrunn-Benz neben den Kurzbeschreibungen verschiedener Heime (nebst Einordnung in die Hierarchie des Heimsystems) der Darstellung persönlicher Schicksale ehemaliger Heimkinder. Grundlage für diese Schilderungen stellen in erster Linie Interviews, Telefonate und persönliche Treffen mit den Betroffenen dar. Die nachwirkenden Folgen staatlicher Erziehung in den Heimen lässt die Leserschaft teilhaben an den persönlichen Schicksalen. So fällt das Fazit der Autorin auch recht ernüchternd aus: in kaum einem Fall gelang den Heimkindern ein reibungsloser Übergang in das Privat- und Berufsleben. Der Inhalt des Buches spricht ein Thema an, das eher ein Schattendasein fristet. Um so erschütternder sind die Lebensgeschichten der Persönlichkeiten, die bereit waren, sich zu ihren Erlebnissen zu äußern. Die Grenzen des Vorstellbaren werden immer wieder aufs Neue gesprengt. Die Lebensgeschichten der ehemaligen Kinder sind Beleg für ein dunkles Kapitel deutscher Vergangenheit in einem Unrechtssystem. Das Fazit gelingt der Autorin besonders gut. Hier fasst sie die schrecklichen Befunde ihrer Forschungen nicht nur zusammen, sie kommentiert es auch sehr persönlich und einfühlsam. Die Porträts gelingen aus meiner Sicht recht unterschiedlich. Allen gemein ist ein schreckliches Erleben, der Bezug zu den Personen und die "Mitnahme" der Leser gelingt, die persönliche Betroffenheit welche die Porträts bewirken sind differenziert zu sehen. Dietmar Langusch, Lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Wie erging es den Heimkindern in der DDR? Von den Eltern im Stich gelassen oder vernachlässigt. An den Rand gedrängt, weil sie politisch oder sozial nicht angepasst waren – knapp 500.000 Kinder und Jugendliche haben das Heimsystem der DDR durchlaufen. Ihre Erfahrungen sind oftmals von Gewalt und Unterdrückung geprägt. Angelika Censebrunn-Benz befasst sich seit Jahren mit der Geschichte der Jugendhilfe in der DDR. Sie hat zahlreiche ehemalige Heimkinder getroffen und interviewt. In ihrem Buch gibt sie einen Überblick über die Geschichte der Zwangserziehung in der DDR und zeichnet in einfühlsamen Porträts Lebenswege ehemaliger Heimkinder nach. Mit einem Vorwort von Wolfgang Thierse Angelika Censebrunn-Benz, Dr. phil., geb. 1981, Studium der Neueren deutschen Geschichte und Philologie an der TU Berlin; Forschung und Publikationen zur Geschichte des NS, insbesondere zum KZ-System; 2011-2017 Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, mehrere Jahre im Büro von Iris Gleicke, Ostbeauftrage der Bundesregierung; seit 2018 Initiatorin und Projektleiterin des Projektes „Zeitzeugenarchiv ehemaliger Heimkinder der DDR“, Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, 2019 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Heimerziehung in Spezialheimen der DDR“. Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Wolfgang Thierse 9
Einleitung 13 Rahmenbedingungen staatlicher Fürsorge 21 Die DDR als Wohlfahrtsstaat 22 »Umerziehung« im Spezialheim - Jugendhilfe in der DDR . . . 27 Zum Umdenken bewegen - den Willen brechen 40 Theoretische Grundlagen der Erziehung: Das Idol Makarenko . . 45 Gewalt als Erziehungsmethode: Das Heimpersonal 50 Alles für das Kollektiv - Demütigung und Verlust der Privatheit 55 Das Leben nach dem Heim 61 Schicksale und Leidensorte 67 »Von Natur aus bin ich nicht aggressiv« Die unfreiwillige Karriere zum kriminellen Gewalttäter 68 Das Jugendhaus Wriezen: Ein Gefängnis für junge Menschen 80 »Das hätte sie gar nicht sehen sollen« Die lebenslange Suche nach der Schwester 82 Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau: Endstation der DDR-Jugendhilfe 89 »Weil wir uns alle geschämt haben dafür« Im Heim wegen versuchter Republikflucht der Eltern 93 Das Spezialkinderheim Ernst Schneller in Eilenburg: Jugendwerkhof, Aufnahmeheim, Durchgangsheim 101 »Dresche wollte ich nicht kriegen, bin lieber stiften gegangen«Erziehungsziel erreicht. Im Heim missbraucht. lebenslang beschädigt 104 Der Jugendwerkhof Neues Leben in Wolfersdorf 112 »Nie wieder mit dem Vater allein«Vom Versagen des Elternhauses 119 Der Jugendwerkhof August Bebel in Burg bei Magdeburg 129 »Indira Ghandi ist schwanger« Die Entwicklung eines Hochbegabten zum Störenfried 132 Das Durchgangsheim Bad Freienwalde 143 »Die Dämonen wird man nicht los« Die Überwindung der Vergangenheit im beruflichen Erfolg 146 Das Kinderheim Makarenko in Königsheide, Berlin-Treptow 151 »Habe oft Suizidgedanken, aber ich will leben« Über die Aufarbeitung der Traumata 154 Jugendwerkhof Ernst Thälmann in Lutherstadt Wittenberg 165 »Das ganze Leben bestand aus Strafe« Stasitauglich nach der Umerziehung? 168 Der Jugendwerkhof Lila Hermann in Rödern 179 »Du bist gebrochen worden, egal wie« Wenn Heim und Elternhaus kein Zuhause bieten 182 Das Normalkinderheim Anna Schumann in Großdeuben 187 »Ich führe ein gutes Leben. Mit vielen Schatten« Als Trennungskind im Heim 189 Der Jugendwerkhof Clara Zetkin in Crimmitschau 194 »Wenn ich mich aufhänge, haben sie weniger Mühe mit mir« Mit Medikamenten ruhiggestellt 197 Schwierigkeiten des Überlebens und der Umgang mit zerstörter Kindheit und Jugend 205 Ein Fazit 206 Anhang 221 Karte der genannten Jugendhilfeeinrichtungen der DDR 223 Bildnachweise 225 Anmerkungen 227 |
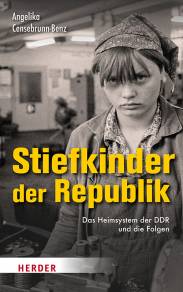
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen