|
|
|
Umschlagtext
Worin unterscheiden sich Sozialisationsprozesse in Reformschulen von denen in Regelschulen? Führt ein reformpädagogisches Lernarrangement wirklich zu einer höheren Schulzufriedenheit, zu weniger Schulangst, zu einem besseren Selbstvertrauen? Wird in Reformschulen das soziale Lernen tatsächlich besser gefördert? Diese und andere Fragen werden am Beispiel der Laborschule in Bielefeld untersucht - und zwar auf der Basis standardisierter Schülerbefragungen von LaborschülerInnen und Jugendlichen des Regelschulsystems. Diese werden ergänzt durch Gruppendiskussionen mit Lehrkräften: Sie interpretieren die Ergebnisse der Schülerbefragung und ziehen daraus Konsequenzen für die Schulentwicklung. Die Untersuchung liefertzum einen eine detaillierte Beschreibung einer reformpädagogischen Schule aus Schülersicht und macht deutlich, welche Chancen, aber auch welche Grenzen mit einer solchen reformpädagogischen Praxis verbunden sind. Zugleich wird aufgezeigt, wie Lehrerinnen und Lehrer in eine solche Forschung einbezogen werden können, um Impulse für die Entwicklung der pädagogischen Praxis zu geben. Die Arbeit knüpft damit an aktuelle Diskurse der Schulforschung und Schulentwicklung an und leistet einen empirisch fundierten Beitrag zur Theorie schulischer Sozialisation und zur Konzeptentwicklung in der schulischen Evaluation.
Verlagsinfo
Wird in Reformschulen das soziale Lernen tatsächlich besser gefördert? Diese und andere Fragen werden am Beispiel der Laborschule in Bielefeld untersucht - und zwar auf der Basis standardisierter Schülerbefragungen von LaborschülerInnen und Jugendlichen des Regelschulsystems. Beate Wischer, Jg. 1969, Dr. phil, war bis 1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Wissenschaftlichen Einrichtung Laborschule, danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sonderpädagogik an der Universität Hannover. Sie ist zur Zeit Referendarin für das Lehramt für die Sekundarstufe I/II an der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Bielefeld. Inhaltsverzeichnis
I. Einführung 9
1.1 Die Studie im Überblick 9 1.1.1 Fragestellung und Erkenntnisperspektiven 10 1.1.2 Überblick zum methodischen Vorgehen 11 1.2 Das Forschungsfeld: Die Laborschule 12 1.2.1 Das reformpädagogische Konzept der Laborschule 13 1.2.2 Die Kooperation zwischen Schule und Wissenschaft 15 1.2.3 Die Absolventenstudie 17 1.3 Sozialisation und Evaluation: Die doppelte Erkenntnisperspektive 19 1.3.1 Soziales Lernen in Regelschulen und Reformschulen die Sozialisationsperspektive 19 1.3.2 Die Laborschule zwischen Anspruch und Wirklichkeit die Evaluationsperspektive 23 1.3.3 Verschränkung der Perspektiven 26 2. Theoretische Bezüge 29 2.1 Die sozialisatorische Perspektive 29 2.1.1 Konzepte schulischer Sozialisationsforschung 30 2.1.2 Theoretische Basisannahmen 32 2.1.3 Probleme schulischer Sozialisationsforschung 34 2.1.4 Zusammenfassung und kritische Einordnung 35 2.1.5 Perspektiven der eigenen Studie 37 2.2 Die evaluative Perspektive 37 2.2.1 Evaluation im Regelschulsystem 37 2.2.2 Evaluation an der Laborschule 44 2.2.4 Perspektiven der eigenen Studie 47 3. Forschungsansatz und methodisches Vorgehen 49 3.1 Gegenstand und Fragestellung der Untersuchung 49 3.2 Methodologische Einordnung 50 3.2.1 Zum Problem pädagogischer Wirkungen 50 3.2.2 Das Beobachtermodell als erkenntnistheoretischer Bezugsrahmen 54 3.2.3 Schlussfolgerungen für den eigenen Forschungsansatz 56 3.3 Standardisierte Schülerbefragungen 59 3.3.1 Datenquellen: Absolventenstudie und SFB-Projekt 59 3.3.2 Schulkontext und individuelle Merkmale: unabhängige Variablen 61 3.3.3 Verhalten und Einstellungen der SchülerInnen: zentrale abhängige Variablen 66 3.3.4 Vergleichsperspektiven und Auswertungsstrategie 67 3.3.5 Auswertungsverfahren 71 3.3.6 Überblick zu den Stichproben 71 3.3.7 Soziale Zusammensetzung und Leistungsniveau von Labor- und RegelschülerInnen 73 3.4 Gruppendiskussionen mit LehrerInnen 81 3.4.1 Gruppendiskussion als Forschungsinstrument 81 3.4.2 Gruppendiskussion als Bestandteil der Absolventenstudie 81 3.4.3 Durchführung und Auswertung 82 3.5 Überblick zum weiteren Vorgehen 83 4. Die schulische Lernumwelt: Lernkultur 85 4.1 Forschungskonzepte und Ansätze 87 4.2 Forschungsergebnisse für das Regelschulwesen 89 4.2.1 Zur Verbreitung schülerorientierter Lernarrangements 89 4.2.2 Die ,Effekte' unterschiedlicher Lernarrangements 91 4.2.3 Zusammenfassung 93 4.3 Pädagogische Ansprüche der Laborschule 94 4.4 Forschungsleitende Überlegungen 95 4.5 Ergebnisse der eigenen Forschung 96 4.5.1 Beurteilung des Unterrichts 96 4.5.2 Die Beurteilung des Unterrichts in heterogenen Gruppen 108 4.5.3 Die Qualität der räumlichen Lernumgebung und die zeitliche Rhythmisierung des Schullebens 116 4.6 Fazit 123 4.6.1 Evaluative Bedeutung 123 4.6.2 Sozialisatorische Bedeutung 126 5. Die schulische Lernumwelt: Erziehungskultur 129 5.1 Forschungskonzepte und Ansätze 129 5.2 Forschungsbefunde aus dem Regelschulwesen 132 5.2.1 Ausprägungen des sozialen Klimas 132 5.2.2 Personenbezogene Einflüsse 134 5.2.3 Effekte des Sozialklimas 135 5.3 Pädagogische Zielsetzungen der Laborschule 136 5.4 Bisherige Forschungsbefunde für die Laborschule 137 5.5 Forschungsleitende Überlegungen 139 5.6 Ergebnisse der eigenen Forschung 140 5.6.1 Klimadimensionen im Schulformvergleich 141 5.6.2 Stammgruppenklima und Schulklima an der Laborschule 156 5.6.3 Zusammenhänge zwischen den einzelnen Klimadimensionen 167 5.7 Fazit 168 5.7.1 Evaluative Bedeutung 169 5.7.2 Sozialisatorische Bedeutung 172 6. Schulbezogene Persönlichkeitsaspekte 177 6.1 Forschungskonzepte und Ansätze 177 6.2 Forschungsergebnisse für das Regelschulwesen 180 6.2.1 Schulzufriedenheit und schulisches Wohlbefinden 180 6.2.2 Schulisches Selbstkonzept 181 6.2.3 Zusammenfassung 184 6.3 Pädagogische Ansprüche der Laborschule 185 6.4 Forschungsleitende Überlegungen 187 6.5 Ergebnisse der eigenen Forschung 187 6.5.1 Schulzufriedenheit und schulisches Wohlbefinden 188 6.5.2 Die Attribuierung guter und schlechter Leistungen 196 6.5.3 Das schulische Fähigkeitskonzept 200 6.5.4 Schul- und Leistungsangst 204 6.5.5 Selbstwertgefühl 210 6.5.6 Zusammenfassende Betrachtung des schulischen Selbstvertrauens 212 6.6 Fazit 225 6.6.1 Sozialisatorische Bedeutung 225 6.6.2 Evaluative Bedeutung 229 7. Die Absolventenstudie als Evaluationsinstrument 233 7.1 Konzept und Anlage 233 7.1.1 Gegenstand der Evaluation 235 7.1.2 Erhebungsinstrument und -verfahren 236 7.1.3 Ergebnisrückmeldung und Kooperation mit der Schule 237 7.2 Datenkommunikation durch Gruppendiskussionen 240 7.2.1 Auszug aus einer Diskussion 241 7.2.2 Analytische Betrachtung 243 7.3 Fazit 247 7.3.1 Der Nutzen der Absolventenstudie für die Laborschule und weiterführende Perspektiven 247 7.3.2 Anregungen für den Schulentwicklungsdiskurs 249 8. Resümee und Ausblick 251 8.1 Die Ambivalenz schulpädagogischer Programmatik 251 8.2 Die Laborschule: Evaluation eines pädagogischen Programms 255 8.2.1 Einfache und komplexe Erwartungen und ihre Einlösung 256 8.2.2 Pädagogische Erwartungen im gesellschaftlichen Funktionszusammenhang 259 8.2.3 Folgerungen für die Laborschule 261 8.3 Fazit: Pädagogische Programmatik und empirische Forschung 262 9. Literatur 265 |
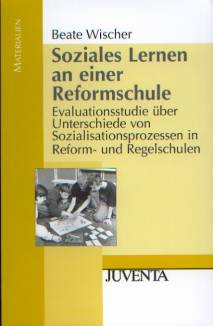
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen