|
|
|
Umschlagtext
Dieses Buch konfrontiert die Religionspädagogik mit Beobachtungen und Erkenntnisgewinnen der Geistigbehindertenpädagogik und modelliert eine Didaktik des Religionsunterrichts, der auch dem schwer geistigbehinderten Schüler gerecht wird. Dabei zeigt sich, daß Unterricht, der Lernende und Lehrende als Subjekte handeln läßt, den Religionsunterricht nicht nur für behinderte Schüler fördert. Die elementaren und praxisbezogenen Aussagen zu einem subjektorientierten Religionsunterricht nähern sich so dem Entwurf eines »Religionsunterrichts für alle«.
Hans-Jürgen Röhrig, geb. 1957; Studium der Sonderpädagogik in Köln, 1984 -1988 Leitung einer heilpädagogischen Außengruppe; seit 1989 Unterrichtsbeauftragter an der Universität Köln, Abordnung als Sonderschullehrer im Hochschuldienst (1994-1998), seit 1998 Konrektor an der Schule für Geistigbehinderte in St. Augustin; 1999 Promotion zum Dr. päd. in Köln. Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung 1. Die Unterrichtswirklichkeit - Darstellung einer Unterrichtseinheit 2. Methodische Zugänge 2.1 Geisteswissenschaftliche Pädagogik 2.2 Der hermeneutisch - pragmatische Ansatz 2.3 Die Forschungsaufgabe - Festlegung der Fragestellung 3. Religionsunterricht im Spiegel des Menschenbildes 3.1 Michaels Beschreibung - elementares Verständnis (V 1) 3.2 Theoretische Ausführungen zum Phänomen Menschenbild 3.2.1 Geschlossene Menschenbilder 3.3 Die Bedeutung der Menschenbilder für die Unterrichtspraxis - erweitertes Verständnis (V 2) 4. Perspektivwechsel: das Phänomen »Geistige Behinderung» 4.1 Vorbemerkungen zur benutzten Terminologie 4.2 Systematische Teilinterpretationen der Unterrlichtseinheit . . 4.2.1 Auswertung - erweitertes Verständnis (V 3) 4.3 Informationen über Michael 4.3.1 Auswertung - erweitertes Verständnis (V 4) 4.4 Das Phänomen »Geistige Behinderung« bei verschiedenen Autorinnen und Autoren 4.4.1 Zur erkenntnistheoretischen Legitimation verschiedener Sichtweisen 4.4.2 »Geistige Behinderung« aus systemischer Sicht (WAGNER) 4.4.3 »Geistige Behinderung« als Menschsein mi der Beziehung zur Welt (FORNEFELD) 4.4.4 »Geistige Behinderung« aus ethischer Sicht (KLEINBACH) 4.4.5 »Geistige Behinderung« aus systemisch-kritischer Sicht (FEUSER) 4.4.6 »Geistige Behinderung« aus ökosytemischer Sicht (SPECK) 4.5 Paradigmata vor dem Hintergrund »Geistiger Behinderung».. 4.5.1 Normalisierungsprinzip 4.5.2 Soziale Abhängigkeit 4.5.3 Selbstbestimmung 4.6 Auswertung - erweitertes Verständnis (V 5) 5. Das Phänomen »Geistige Behinderung« - Perspektivwechsel in der Rellgionspädagogik? 5.1 Religionsunterricht als Gegenstandsbereich der Religionspädagogik (das Verhältnis von Theologie u. Pädagogik) 5.2 Übertrag - Bestandsaufnahme - Perspektivwechsel in der Religionspädagogik- bzw. didaktik? 6. Beiträge der religionspädagogischen Fachdidaktiken und Konzeptionen für einen subjektorientierten Religionsunterricht 6.1 Entstehung des Religionsunterrichts als Schulfach (18.Jh.) - Katechetischer Religionsunterricht 6.2 Idealistischer - und dogmatischer Religionsunterricht (19.Jh.) -Teilinterpretation/Bezüge zur Unterrichtseinheit 6.3 Evangelische Unterweisung - Kerygmatischer Religionsunterricht (20. Jh.) 6.4 Henneneutischer Religionsunterricht 6.5 Der problemorientierte Religionsunterricht in seinen verschiedenen Ausprägungen 6.6 Korrelationsdidaktik 6.7 Symboldidaktischer Religionsunterricht 6.8 Erfahrungsorientierter Religionsunterricht 6.9 Elementare Bibeldidaktik 6.10 Kontextdidaktik 6.11 Elementarisierter Religionsunterricht 6.12 Kommunikativer Religionsunterricht 6.13 Ansätze einer »konstruktiv-Iaitischen Religionsdidaktik» 6.14 Integrativer Religionsunterricht 6.15 Interreligiöser Religionsunterricht 6.16 Diakonischer Religionsunterricht 7. Zur Konzeption eines subjektorientierten Religionsunterrichts 7.1 Erkenntnistheoretische Legitimation 7.2 Theologische Legitimation 7.3 Pädagogisch-anthropologische Legitimation 7.4 Gesellschaftliche Legitimation 7.5 Didaktische Legitimation 7.6 Juristische Legitimation 7.7 Die drei Basiskomponenten: Lehrer - Schüler - Bibel 7.7.1 Das Verhältnis der drei Basiskomponenten (Lehrer/Schüler/Bibel) 7.7.2 Das Selbstverständnis des Subjekts: der Schüler 7.7.3 Das Selbstverständnis des Subjekts: der Lehrer 7.7.4 Das Subjekt (Schüler) - Subjekt (Lehrer) - Verhältnis 7.7.5 Die Frage nach der religiösen Sozialisation 7.7.6 Die Stellung und die Arbeit mit der Bibel 7.7.7 Symbole - eine Sprache der Bibel 7.8 Weitere Aspekte des subjektorientierten Religionsunterichts 7.8.1 Planungsmöglichkeiten - Religionsuntenicht als Angebot 7.8.2 Auf dem Weg zu einem offenen Religonsunterricht 7.8.3 Der Stellenwert von Curricula und Zielen 7.8.4 Die Frage nach der konfessionellen Ausrichtung nach der »confessio« 7.8.5 Die Frage nach dem gemeinsamen Religionsunterricht mit behinderten und nichtbehinderten Schülern 7.9 Ergebnisse 8.Literaturverzeichnis 9. Verzeichnis der Abbildungen 10. Verzeichnis der Bibelstellen |
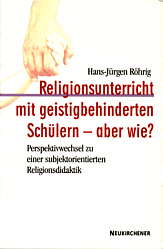
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen