|
|
|
Umschlagtext
Eberhard Winklers Buch gibt einen Überblick über die klassischen Disziplinen der Praktischen Theologie, Biblische Kriterien, empirische Voraussetzungen und praktische Möglichkeiten, das Evangelium mitzuteilen und miteinander zu teilen, werden im Blick auf kirchenleitendes Handeln, Gottesdienst, Kasualien, Seelsorge, Diakonie und Religionspädagogik dargestellt. Aktuelle Probleme (Säkularisierung, Gemeindeaufbau, Religion außerhalb der Kirche) werden als Herausforderung für eine zeitgemäße Verkündigung begriffen. Der sorgfältige methodische und didaktische Aufbau ermöglicht, das Buch in Unterricht und Studium sinnvoll einzusetzen und es als Vorbereitung für das Erste und Zweite Theologische Examen zu verwenden,
Eberhard Winkler, geb. 1933 in Königsberg; Tischlerlehre; Theologiestudium, Promotion und Habilitation in Rostock; Pastor in Rostock und Halle; 1966 Dozent, 1969 Professor für Praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle; ehrenamtlich Pastor einer kleinen Dorfgemeinde. Rezension
Die theologische Disziplin der "Praktischen Theologie" umfasst die Bereiche: Kybernetik, Liturgik, Homiletik, Kasualien, Seelsorge, Diakonie und Religionspädagogik. Religionslehrer/innen interessiert zumeist nur der Bereich der Religionspädagogik. Gleichwohl kann ein Einblick in andere Bereiche wie Seelsorge oder Diakonie gelegentlich ganz nützlich sein. Auch sind die Darstellungen über die Religionspädagogik in diesen Gesamtdarstellungen der "Praktischen Theologie" in der Regel recht komprimiert und umreißen die wesentlichen Entwicklungen. - Winklers "elementar"-Lehrbuch zur "Praktischen Theologie" sei insofern Religionslehrer/inne/n empfohlen.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
1 Was ist Praktische Theologie? 11 2 Praktisch-theologische Kybernetik 15 2.1 Ekklesiologische Grundlagen und Voraussetzungen 15 2.1.1 Volkskirche und Diaspora 15 2.1.2 Kirche und Gemeinde 17 2.1.3 Empirische und geglaubte Kirche 18 2.1.4 Merkmale rechter Kirche (notae ecclesiae).... 19 2.1.5 Allgemeines Priestertum und Amt 20 2.2 Das Amt und die Ämter: Berufe in der Kirche 22 2.3 Konzepte des Gemeindeaufbaus 25 2.4 Kirchenrecht 29 2.4.1 Grundlegende Fragen 29 2.4.2 Kirchenmitgliedschaft 32 2.4.3 Kirchensteuer 34 2.4.4 Pfarrerdienstrecht 36 2.4.5 Staatskirchenrecht 37 3 Der Gottesdienst 40 3.1 Hauptprobleme der Liturgik 40 3.2 Biblische Grundlagen 42 3.3 Das geschichtliche Erbe 45 3.3.1 Die Alte Kirche 45 3.3.2 Die reformatorische Erneuerung 46 3.3.3 Die Aufklärung und die Gegensätze 48 3.3.4 Das 20. Jahrhundert 49 3.4 Die ökumenische Perspektive 50 3.5 Evangelisches Gottesdienstverständnis heute 52 3.5.1 Gottes Dienst und die Antwort der Menschen 52 3.5.2 Gottesdienst als darstellendes Handeln 53 3.5.3 Gottesdienst als Gemeindeaufbau 53 3.6 Elemente des Gottesdienstes 55 3.6.1 Wort und Sakrament 55 3.6.2 Symbol und Ritual 56 3.6.3 Das Gebet 58 3.6.4 Musik 60 3.6.5 Nonverbale Elemente 62 3.7 Der gottesdienstliche Raum 64 3.8 Die gottesdienstliche Zeit 67 3.8.1 Der Sonntag 67 3.8.2 Das Stundengebet 73 4 Predigtlehre (Homiletik) 75 4.1 Warum wird gepredigt? Theologische Begründung der Predigt 75 4.2 Wer predigt? Die predigende Person und der kirchliche Auftrag 78 4.3 Wem wird gepredigt? Die Rolle der Gemeinde und die Predigt als Kommunikation 83 4.3.1 Die Bedeutung der Gemeinde für die Predigt 83 4.3.2 Die Predigt als Kommunikation 87 4.4 Wo wird gepredigt? 89 4.4.1 Der Raum der Predigt 89 4.4.2 Die Predigt im Gottesdienst 91 4.4.3 Missionarische Verkündigung 93 4.5 Wie wird gepredigt? 94 4.5.1 Schritte der Predigtvorbereitung 94 4.5.2 Sprache und Vortrag der Predigt 101 4.6 Was wird gepredigt? 102 4.6.1 Biblisch predigen 103 4.6.2 Evangelisch predigen 104 4.6.3 Aktuell predigen 106 5 Kasualien 109 5.1 Die Besonderheit der Kasualien 109 5.2 Die Taufe 113 5.2.1 Theologische Grundlagen 113 5.2.2 Zur Praxis der Taufe 116 5.3 Die Konfirmation 119 5.3.1 Theologische Grundlagen 119 5.3.2 Zur Praxis der Konfirmation 121 5.4 Die Trauung 124 5.4.1 Theologische Grundlagen 124 5.4.2 Zur Praxis der kirchlichen Trauung 126 5.5 Die Bestattung 129 5.5.1 Theologische Grundlagen 129 5.5.2 Zur Praxis der Bestattung 133 6 Seelsorge 137 6.1 Begriff und Grundlagen 137 6.1.1 Allgemeine und spezielle Seelsorge 137 6.1.2 Biblische Grundlagen der Seelsorge 139 6.1.3 Empirische Voraussetzungen 141 6.1.4 Psychotherapie und Seelsorge 144 6.2 Konzeptionen der Seelsorge in der Gegenwart 147 6.2.1 Die kerygmatische Seelsorge 147 6.2.2 Partnerzentrierte Seelsorge 148 6.2.3 Glaubenshilfe als Lebenshilfe 149 6.3 Aufgaben der Seelsorge 151 6.3.1 Die Suche nach Sinn 151 6.3.2 Trost 154 6.3.3 Glaube, Aberglaube und Zweifel 158 6.3.4 Beziehungsprobleme 163 6.4 Methodische Möglichkeiten der Seelsorge 168 7 Diakonie 174 7.1 Allgemeine und spezielle Diakonie 174 7.2 Biblische Grundlagen der Diakonie 177 7.3 Höhepunkte in der Geschichte der Diakonie 180 7.3.1 Die Alte Kirche 180 7.3.2 Die Reformation 181 7.3.3 Pietismus und Erweckungsbewegung 182 7.4 Diakonie in der modernen Gesellschaft 184 7.5 Gemeindediakonie 186 7.6 Diakonie im Ehrenamt 188 7.7 Ökumenische Diakonie 191 7.7.1 Weltweite Diakonie 191 7.7.2 Katholische Diakonie (Caritas) 193 7.8 Diakonie als praktische »Ehrfurcht vor dem Leben« 194 7.8.1 Die Arbeit mit behinderten Menschen 194 7.8.2 Die Arbeit mit alten Menschen 197 7.8.3 Die Arbeit mit suchtkranken Menschen 199 8 Religions- und Gemeindepädagogik 204 8.1 Christliche Bildung, Erziehung und Sozialisation.... 204 8.2 Schule und Kirche als Bildungsträger 207 8.2.1 Die Begründung des Religionsunterrichts in der Schule 207 8.2.2 Die Kirchen als Bildungsträger 208 8.3 Religionspädagogische Konzeptionen im 20. Jahrhundert 211 8.3.1 Die Evangelische Unterweisung 211 8.3.2 Der hermeneutisch orientierte Religionsunterricht 212 8.3.3 Die Problem- und Humanorientierung 213 8.3.4 Die Ergänzungsmodelle 214 8.4 Die didaktische Analyse 215 8.4.1 Wer? 215 8.4.2 Was? Warum / Wozu? 216 8.5 Zur Methodik 217 8.5.1 Die Verlaufsplanung 217 8.5.2 Die Sozialformen 219 8.5.3 Das Gespräch 220 8.5.4 Das Erzählen 222 8.5.5 Die Arbeit mit Bildern 224 8.5.6 Das Spiel 225 8.5.7 Liturgie im Unterricht 226 8.6 Kirchliche Arbeit mit Kindern 227 8.6.1 Das Kindergartenalter 227 8.6.2 Der Kindergottesdienst 228 8.6.3 Christenlehre und andere Kindergruppen 229 8.7 Kirchliche Jugendarbeit 230 8.8 Kirchliche Erwachsenenbildung 233 |
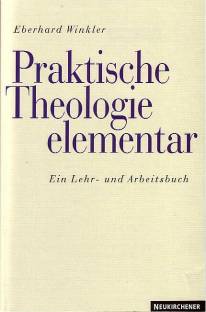
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen