|
|
|
Umschlagtext
Der "Atkins" ist und bleibt das führende Lehrbuch in der Physikalischen Chemie! Ein muß für alle Studenten mit Chemie im Haupt- oder Nebenfach.
Die hervorragende didaktische Aufbereitung des Themas und die klare, prägnante Sprache des erfahrenen Lehrbuchautors machen selbst komplizierte Sachverhalte leicht verständlich. Darüber hinaus garantieren mehr als 200 Beispiele mit ausführlichen Lösungsweg sowie mehr als 1200 Übungsaufgaben zum Selbststudium eine optimale Prüfungsvorbereitung. "Insgesamt stellen Lehrbuch und Arbeitsbuch eine hervorragende Einführung in die Physikalische Chemie dar." W. Göpel, Physikalische Blätter Rezension
Dieses Buch lässt sich gut lesen, ist verständlich geschrieben und macht Zusammenhänge deutlich.
Wer auf mathematische Herleitungen verzichten möchte, kann dies einfach tun, weil sie in einem extra Kasten angegeben sind. Andererseits läßt sich vieles leichter mit einer mathematischen Herleitung nachvollziehen. Durch den großen Umfang kann detaillierter auf Dinge eingegangen werden, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, die einem aber das Verständnis wesentlich erleichtern. Die vielen Beispiele helfen einem dann schließlich nachzuvollziehen, ob man das gelesene nun wirklich verstanden hat. Für die Lösungen der Übungsaufgaben, die praktischer Weise in leichte und schwere sowie Rechenaufgaben und Theoretische Aufgaben unterteilt sind, muss man leider zusätzlich das Arbeitsheft erwerben. Jacqueline Weinheimer, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
0 Einführung: Überblick und Hintergrund
0.1 Grundbegriffe 0.2 Gleichgewicht 0.3 Struktur 0.4 Veränderung 0.5 Zusammenfassung Teil I: Gleichgewicht 1 Die Eigenschaften der Gase 1.1 Das ideale Gas 1.1.1 Die Zustände der Gase 1.1.2 Die Gasgesetze 1.1.3 Die kinetische Gastheorie 1.2 Reale Gase 1.2.1 Zwischenmolekulare Wechselwirkungen 1.2.2 Die van-der-Waalssche Gleichung 1.2.3 Das Prinzip der übereinstimmenden Zustände 2 Der Erste Hauptsatz: Grundlagen 2.1 Grundbegriffe 2.1.1 Arbeit, Wärme und Energie 2.1.2 Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik 2.2 Arbeit und Wärme 2.2.1 Volumenarbeit 2.2.2 Wärme und Enthalpie 2.3 Thermochemie 2.3.1 Die Standardenthalpie 2.3.2 Bildungsenthalpien 2.3.3 Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsenthalpien 3 Der Erste Hauptsatz: Hilfsmittel 3.1 Zustandsfunktionen und totale Differentiale 3.1.1 Zustandsfunktionen 3.1.2 Die Temperaturabhängigkeit der Enthalpie 3.1.3 Der Zusammenhang zwischen Cv und Cp 3.2 Adiabatische Volumenarbeit 3.2.1 Spezialfälle 3.2.2 Die Adiabaten idealer Gase 4 Der Zweite Hauptsatz: Grundlagen 4.1 Die Richtung freiwilliger Prozesse 4.1.1 Die Verteilung der Energie 4.1.2 Die Entropie 4.1.3 Entropieänderungen bei irreversiblen Prozessen 4.1.4 Entropieänderungen bei speziellen Prozessen 4.1.5 Der Dritte Hauptsatz der Thermodynamik 4.2 Der Wirkungsgrad thermischer Prozesse 4.2.1 Der Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen 4.2.2 Energetische Aspekte der Kälteerzeugung 4.3 Die Beschränkung auf das System 4.3.1 Freie Energie und Freie Enthalpie 4.3.2 Die molare Freie Standardenthalpie 5 Der Zweite Hauptsatz: Hilfsmittel 5.1 Die Verbindung von Erstem und Zweitem Hauptsatz 5.1.1 Eigenschaften der Inneren Energie 5.1.2 Eigenschaften der Freien Enthalpie 5.2 Das chemische Potential 5.2.1 Das chemische Potential eines reinen Stoffes 5.2.2 Das chemische Potential einer Mischungskomponente 5.2.3 Weitere Bedeutung von ß 5.3. Reale Gase: Die Fugazität 5.3.1 Standardzustände realer Gase 5.3.2 Die Beziehung zwischen Fugazität und Druck 6 Physikalische Umwandlungen reiner Stoffe 6.1 Phasendiagramme 6.1.1 Phasengrenzlinien 6.1.2 Phasendiagramme spezieller Stoffe 6.2 Die Stabilität von Phasen: Phasenübergänge 6.2.1 Die Abhängigkeit der Stabilität von den Bedingungen 6.2.2 Die Lage der Phasengrenzlinien 6.2.3 Die Klassifikation der Phasenübergänge nach Ehrenfest 7 Die Eigenschaften einfacher Mischungen 7.1 Die thermodynamische Beschreibung von Mischungen 7.1.1 Partielle molare Größen 7.1.2 Thermodynamik von Mischphasen 7.1.3 Das chemische Potential flüssiger Phasen 7.2 Die Eigenschaften von Lösungen 7.2.1 Flüssige Mischungen 7.2.2 Kolligative Eigenschaften 7.3 Aktivitäten 7.3.1 Die Aktivität des Lösungsmittels 7.3.2 Die Aktivität des gelösten Stoffes 8 Phasendiagramme 8.1 Phasen, Komponenten, Freiheitsgrade 8.1.1 Definitionen 8.1.2 Die Phasenregel 8.2 Zweikomponentensysteme 8.2.1 Die Druckabhängigkeit der Zusammensetzung: Dampfdruckdiagramme 8.2.2 Die Temperaturabhängigkeit der Zusammensetzung: Siedediagramme 8.2.3 Flüssig/Flüssig-Phasendiagramme 8.2.4 Flüssig/Fest-Phasendiagramme 8.2.5 Ultrareinheit und kontrollierte Verunreinigung 8.3 Dreikomponentensysteme 8.3.1 Phasendiagramme in Dreieckskoordinaten 8.3.2 Begrenzt mischbare Flüssigkeiten 8.3.3 Der Einfluß gelöster Salze 9 Das Chemische Gleichgewicht 9.1 Freiwillig ablaufende chemische Reaktionen 9.1.1 Das Minimum der Freien Enthalpie 9.1.2 Die Zusammensetzung von Reaktionsgemischen im Gleichgewicht 9.2 Die Verschiebung des Gleichgewichts bei Änderung der Reaktionsbedingungen 9.2.1 Der Einfluß des Druckes auf das Gleichgewicht 9.2.2 Der Einfluß der Temperatur auf das Gleichgewicht 9.3 Ausgewählte Anwendungen 9.3.1 Die Gewinnung von Metallen aus ihren Oxiden 9.3.2 Säuren und Basen 9.3.3 Biologische Prozesse: Die Thermodynamik des ATP 10 Elektrochemie im Gleichgewicht 10.1 Thermodynamische Eigenschaften von Ionen in Lösung 10.1.1 Thermodynamische Bildungsfunktionen 10.1.2 Ionenaktivitäten 10.2 Elektrochemische Zellen 10.2.1 Elektrodenreaktionen und Elektroden 10.2.2 Zelltypen 10.2.3 Standard-Elektrodenpotentiale 10.3 Anwendungen der Standardpotentiale 10.3.1 Die elektrochemische Spannungsreihe 10.3.2 Löslichkeitskonstanten 10.3.3 Messung von pH- und pK-Werten 10.3.4 Potentiometrische Titrationen 10.3.5 Thermodynamische Funktionen aus der Messung des Zellpotentials Teil II: Struktur 11. Quantentheorie: Einführung und Grundlagen 11.1 Die Anfänge der Quantenmechanik 11.1.1 Das Versagen der klassischen Physik 11.1.2 Der Welle-Teilchen-Dualismus 11.2 Die Dynamik mikroskopischer Systeme 11.2.1 Die Schrödinger-Gleichung 11.2.2 Die Wahrscheinlichkeitsinterpretation 11.3 Prinzipien der Quantenmechanik 11.3.1 Operatoren und Observablen 11.3.2 Superpositionen und Erwartungswerte 12 Quantentheorie: Methoden und Anwendungen 12.1 Translation 12.1.1 Das Teilchen im Kasten 12.1.2 Bewegung in zwei Dimensionen 12.1.3 Der Tunneleffekt 12.2 Schwingung 12.2.1 Die Energieniveaus 12.2.2 Die Wellenfunktionen 12.3 Rotation 12.3.1 Rotation in zwei Dimensionen 12.3.2 Rotation in drei Dimensionen 12.3.3 Der Spin 13 Atomstruktur und Atomspektren 13.1 Struktur und Spektren Wasserstoff ähnlicher Atome 13.1.1 Die Struktur wasserstoffähnlicher Atome 13.1.2 Atomorbitale und ihre Energien 13.1.3 Spektroskopische Übergänge und Auswahlregeln 13.2 Die Struktur von Mehrelektronenatomen 13.2.1 Die Orbitalnäherung 13.2.2 Selbstkonsistente Orbitale 13.3 Die Spektren von Mehrelektronenatomen 13.3.1 Singulett-und Triplettzustände 13.3.2 Spin-Bahn-Kopplung 13.3.3 Termsymbole und Auswahlregeln 13.3.4 Der Einfluß magnetischer Felder 14 Molekülstruktur 14.1 Die Valenzbindungstheorie 14.1.1 Das Wasserstoffmolekül 14.1.2 Homoatomare zweiatomige Moleküle 14.1.3 Vielatomige Moleküle 14.2 Die Molekülorbitaltheorie 14.2.1 Das Wasserstoffmolekül-lon 14.2.2 Homoatomare zweiatomige Moleküle 14.2.3 Die Bezeichnung von Molekülzuständen 14.2.4 Heteroatomare zweiatomige Moleküle 14.3 Molekülorbitale in vielatomigen Molekülen 14.3.1 Walsh-Diagramme 14.3.2 Die Hückel-Näherung 14.3.3 Die Bändertheorie der Festkörper 15 Molekülsymmetrie 15.1 Die Symmetrieelemente von Körpern 15.1.1 Symmetrieoperationen und Symmetrieelemente 15.1.2 Die Klassifikation von Molekülen nach ihrer Symmetrie 15.1.3 Konsequenzen der Molekülsymmetrie 15.2 Charaktertafeln 15.2.1 Charaktertafeln und Symmetriebezeichnungen 15.2.2 Symmetrie und Orbitalüberlappung 15.2.3 Auswahlregeln und Symmetrie 16 Spektroskopie 1: Rotations- und Schwingungsübergänge 16.1 Allgemeine Merkmale spektroskopischer Methoden 16.1.1 Experimentelle Grundlagen 16.1.2 Die Intensität von Spektrallinien 16.1.3 Die Breite von Spektrallinien 16.2 Reine Rotationsspektren 16.2.1 Die Energieniveaus der Rotation 16.2.2 Rotationsübergänge 16.2.3 Raman-Rotationsspektren 16.2.4 Kernstatistik 16.3 Die Schwingung zweiatomiger Moleküle 16.3.1 Molekülschwingungen 16.3.2 Auswahlregeln für Schwingungsübergänge 16.3.3 Anharmonizität 16.3.4 Rotationsschwingungsspektren 16.3.5 Raman-Schwingungsspektren zweiatomiger Moleküle 16.4 Die Schwingungen vielatomiger Moleküle 16.4.1 Normalschwingungen 16.4.2 Schwingungsspektren vielatomiger Moleküle 16.4.3 Raman-Schwingungsspektren vielatomiger Moleküle 17 Spektroskopie 2: Elektronenübergänge 17.1 Die Eigenschaften elektronischer Übergänge 17.1.1 Die Schwingungsstruktur von Elektronenspektren 17.1.2 Spezielle Arten von elektronischen Übergängen 17.2 Das Schicksal angeregter Zustände 17.2.1 Fluoreszenz und Phosphoreszenz 17.2.2 Dissoziation und Prädissoziation 17.3 Laser 17.3.1 Das Laserprinzip 17.3.2 Laserbauarten 17.3.3 Laseranwendungen in der Chemie 17.4 Photoelektronenspektroskopie 17.4.1 Die Grundlagen 17.4.2 UV-Photoelektronenspektroskopie 17.4.3 Röntgen-Photoelektronenspektroskopie 18 Spektroskopie 3: Magnetische Resonanz 18.1 Kernresonanz 18.1.1 Die Energien von Kernen in einem Magnetfeld 18.1.2 Die chemische Verschiebung 18.1.3 Die Feinstruktur des Spektrums 18.2 Pulstechniken in der NMR 18.2.1 Der Vektor der Magnetisierung 18.2.2 Linienbreiten und Reaktionsgeschwindigkeiten 18.2.3 Der Kern-Overhauser-Effekt 18.2.4 Zweidimensionale Kernresonanz 18.2.5 Kernresonanz in Festkörpern 18.3 Elektronenspinresonanz 18.3.1 Derg-Faktor 18.3.2 Die Hyperfeinstruktur 19 Statistische Thermodynamik: Grundlagen 19.1 Die Verteilung von Molekülzuständen 19.1.1 Verteilungen und Gewichte 19.1.2 Die molekulare Zustandssumme 19.2 Innere Energie und Entropie 19.2.1 Die Innere Energie 19.2.2 Die statistische Definition der Entropie 19.3 Die kanonische Zustandssumme 19.3.1 Die kanonische Gesamtheit 19.3.2 Die thermodynamische Information in der Zustandssumme 19.3.3 Unabhängige Moleküle 20 Statistische Thermodynamik: Anwendungen 20.1 Grundlegende Beziehungen 20.1.1 Die Berechnung thermodynamischer Funktionen 20.1.2 Die molekulare Zustandssumme 20.2 Anwendungen der statistischen Thermodynamik 20.2.1 Mittlere Energien 20.2.2 Wärmekapazitäten 20.2.3 Zustandsgieichungen 20.2.4 Nullpunktsentropien 20.2.5 Gleichgewichtskonstanten 21 Strukturaufklärung mit Beugungsmethoden 21.1 Die Struktur von Kristallen 21.1.1 Gitter und Elementarzellen 21.1.2 Die Identifikation von Gitterebenen 21.2 Die Beugung von Röntgenstrahlen 21.2.1 Das Braggsche Gesetz 21.2.2 Das Pulververfahren 21.2.3 Röntgenbeugung an Einkristallen 21.3 Die Ergebnisse von Röntgenbeugungsexperimenten 21.3.1 Die Struktur der Metalle: Kugelpackungen 21.3.2 Ionenkristalle 21.3.3 Absolute Konfigurationen 21.4 Neutronen- und Elektronenbeugung 21.4.1 Neutronenbeugung 21.4.2 Elektronenbeugung 22 Die elektrischen und magnetischen Eigenschaften von Molekülen 22.1 Elektrische Eigenschaften 22.1.1 Permanente und induzierte Dipolmomente 22.1.2 Der Brechungsindex 22.2 Zwischenmolekulare Wechselwirkungen 22.2.1 Wechselwirkungen zwischen Dipolen 22.2.2 Abstoßende Beiträge: Die Gesamtwechselwirkung 22.2.3 Wechselwirkungen in Molekularstrahlen 22.3 Magnetische Eigenschaften 22.3.1 Die magnetische Suszeptibilität 22.3.2 Permanente magnetische Momente 22.3.3 Induzierte magnetische Momente 23 Makromoleküle 23.1 Größe und Form von Makromolekülen 23.1.1 Mittlere Molmassen 23.1.2 Kolligative Eigenschaften 23.1.3 Die Sedimentation 23.1.4 Viskosität 23.1.5 Lichtstreuung 23.2 Konformation und Konfiguration 23.2.1 Statistische Knäuel 23.2.2 Helix- und Faltblattstrukturen 23.2.3 Tertiär-und Quartärstrukturen Teil III: Veränderung 24 Die Bewegung von Molekülen 24.1 Die Bewegung von Molekülen in Gasen 24.1.1 Stöße mit Wänden und Oberflächen 24.1.2 Die Geschwindigkeit der Effusion 24.1.3 Der Transport gegen einen Gradienten 24.1.4 Die Transporteigenschaften eines idealen Gases 24.2 Die Bewegung von Molekülen und Ionen in Flüssigkeiten 24.2.1 Die Struktur von Flüssigkeiten 24.2.2 Die Bewegung von Molekülen in Flüssigkeiten 24.2.3 Die Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen 24.2.4 lonenbeweglichkeiten 24.2.5 Leitfähigkeit und Ion-Ion-Wechselwirkungen 24.3 Diffusion 24.3.1 Die thermodynamische Kraft 24.3.2 Die Diffusionsgleichung 24.3.3 Diffusionswahrscheinlichkeiten 24.3.4 Eine statistische Betrachtung der Diffusion 25 Die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen 25.1 Empirische Reaktionskinetik 25.1.1 Experimentelle Methoden 25.1.2 Die Geschwindigkeit von Reaktionen 25.1.3 Integrierte Geschwindigkeitsgesetze 25.1.4 Reaktionen in der Nähe des Gleichgewichts 25.1.5 Die Temperaturabhängigkeit von Reaktionsgeschwindigkeiten 25.2 Theorie der Reaktionskinetik 25.2.1 Elementarreaktionen 25.2.2 Aufeinanderfolgende Elementarreaktionen 25.2.3 Unimolekulare Reaktionen 26 Die Kinetik komplexer Reaktionen 26.1 Kettenreaktionen 26.1.1 Der Verlauf von Kettenreaktionen 26.1.2 Explosionen 26.1.3 Photochemische Reaktionen 26.2 Polymerisationen 26.2.1 Kettenpolymerisation 26.2.2 Schrittweise Polymerisation 26.3 Katalyse und Oszillationen 26.3.1 Homogene Katalyse 26.3.2 Autokatalyse 26.3.3 Oszillierende Reaktionen 26.3.4 Chemisches Chaos 27 Molekulare Reaktionsdynamik 27.1 Reaktive Stöße 27.1.1 Die Stoßtheorie 27.1.2 Diffusionskontrollierte Reaktionen 27.1.3 Die Stoffbilanzgleichung 27.2 Die Theorie des aktivierten Komplexes 27.2.1 Die Reaktionskoordinate und der Übergangszustand 27.2.2 Die Eyring-Gleichung 27.2.3 Eine Thermodynamische Betrachtung des aktivierten Komplexes 27.3 Die Dynamik molekularer Stöße 27.3.1 Reaktive Stöße 27.3.2 Potentialhyperflächen 27.3.3 Theoretische und experimentelle Ergebnisse 28 Die Eigenschaften von Oberflächen 28.1 Die Eigenschaften flüssiger Oberflächen 28.1.1 Oberflächenspannung 28.1.2 Gekrümmte Oberflächen 28.1.3 Die Kapillarwirkung 28.2 Oberflächenaktive Substanzen 28.2.1 Der Oberflächenüberschuß 28.2.2 Die experimentelle Untersuchung von Oberflächenfilmen 28.3 Kolloide 28.3.1 Klassifikation und Herstellung von Kolloiden 28.3.2 Struktur und Stabilität von Kolloiden 28.4 Struktur und Wachstum von Oberflächen 28.4.1 Das Wachstum von Oberflächen 28.4.2 Die Zusammensetzung von Oberflächen 28.5 Adsorption an Oberflächen 28.5.1 Physisorption und Chemisorption 28.5.2 Adsorptionsisothermen 28.5.3 Die Geschwindigkeit von Oberflächenprozessen 28.6 Die katalytische Aktivität von Oberflächen 28.6.1 Adsorption und Katalyse 28.6.2 Beispiele für Katalyse an Oberflächen 29 Dynamische Elektrochemie 29.1 Elektrodenprozesse 29.1.1 Die elektrische Doppelschicht 29.1.2 Die Geschwindigkeit der Ladungsübertragung 29.1.3 Die Polarisation von Elektroden 29.2 Elektrochemische Prozesse 29.2.1 Elektrolyse 29.2.2 Die Eigenschaften von Zellen unter Belastung 29.2.3 Brennstoffzellen und sekundäre Zellen 29.3 Korrosion 29.3.1 Die Geschwindigkeit der Korrosion 29.3.2 Korrosionsschutz 30 Grundlagen der Thermodynamik irreversibler Prozesse 30.1 Entropieproduktion 30.1.1 Entropieproduktion bei der Wärmeleitung 30.1.2 Flüsse und Kräfte 30.1.3 Die phänomenologischen Gleichungen 30.1.4 Entropieproduktion bei der Diffusion 30.1.5 Entropieproduktion bei chemischen Reaktionen 30.2 Allgemeine irreversible Thermodynamik linearer Prozesse 30.2.1 Alte Reziprozitätsrelationen 30.2.2 Die Reziprozitätsrelationen von Onsager 30.2.3 Anwendungen der Reziprozitätsrelationen von Onsager 30.2.4 Der stationäre Zustand 30.2.5 Anmerkungen zu linearen Prozessen 30.2.6 Die Kopplung von Flüssen 30.3 Thermodynamik nichtlinearer irreversibler Prozesse 30.3.1 Das Evolutionskriterium und der stationäre Zustand 30.3.2 Katalyse und Regelung 30.3.3 Das Evolutionskriterium und das kinetische Potential 30.3.4 Information als thermodynamische Größe 30.3.5 Evolution Weiterführende Informationen 1 Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung 2 Beziehungen zwischen partiellen Ableitungen 3 Elektrostatik 4 Die Debye-Hückel-Theorie 5 Klassische Mechanik 6 Quantenmechanik 7 Differentialgleichungen 8 Der harmonische Oszillator 9 Die Rotationsbewegung 10 Schwerpunktskoordinaten 11 Die Abtrennung der inneren Bewegung 12 Das Pauli-Prinzip 13 Gruppen 14 Unbestimmte Multiplikatoren 15 Die Elastizität von Gummi 16 Die ungeordnete Bewegung Tabellenanhang Register |
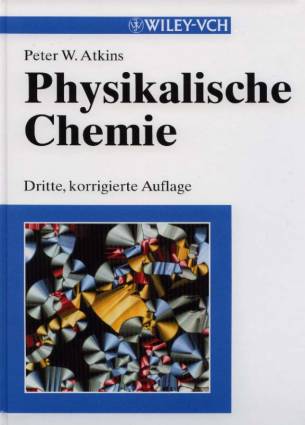
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen