|
|
|
Umschlagtext
1 Hinweise zur Nutzung der Anleitungen für Schülerexperimente
Experimente sind im Unterricht für die Motivierung und die sichere Aneignung von physikalischen Grundlagen durch die Schüler besonders wirksam, wenn sie von den Schülern selbst durchgeführt werden. Ihr Einsatz sollte in alle didaktischen Phasen des Unterrichts erfolgen. Der Umfang der experimentellen Aufgabe kann dabei einen sehr unterschiedlichen Zeitaufwand erfordern. Die selbstständige experimentelle Tätigkeit der Schüler wird jedoch nur effektiv sein, wenn die Schüler so angeleitet werden, dass sie die Aufgabe erfolgreich lösen können, dabei aber weder über- noch unterfordert werden. Die nachfolgenden Anleitungen sind in der Schulpraxis erprobt. Trotzdem müssen sie an die konkreten Zielstellungen des Lehrers und die jeweilige Unterrichtssituation angepasst werden. Deshalb sind die Anleitungen so angelegt, dass sie leicht verändert werden können. Dazu zählt, das einzelne Aufträge aus umfassenderen Anleitungen ausgewählt werden können. Auch das getrennt - gemeinschaftliche Bearbeiten von Teilaufträgen durch verschiedene Schülergruppen ist bei einigen Experimenten möglich. Angegeben sind drei Gruppen von Anleitungen: a) Experimente für den Anfangsunterricht (meist Klassen 6 - 7), b) Experimente für die Mittelstufe (Klassen 7-10 bzw. 8-10), c) Praktikumsexperimente (Klassen 9 und 10). Die vorliegenden Anleitungen sind in der Regel in folgende Abschnitte gegliedert: Aufgabe: Hier wird die komplexe Aufgabenstellung formuliert. In den meisten Fällen ergibt sich diese aus dem zum Schülerexperiment hinführendem Unterrichtsgespräch. Entschließt sich der Lehrer dazu, die Anfertigung eines gesonderten Protokolls von den Schülern zu fordern, dann kann diese Formulierung übernommen werden. Am Ende eines jeden Experiments sollte im Zusammenhang mit der Formulierung des Resultats eine Rückbesinnung auf die Aufgabenstellung erfolgen. Vorbereitung: Zur Sicherstellung des Erfolgs der experimentellen Arbeit müssen häufig Kenntnisse zu fachlichen Grundlagen oder zu Arbeitsverfahren reaktiviert werden. Das kann im Verlaufe des Unterrichtsgesprächs oder in selbstständiger Schülerarbeit erfolgen. Die Arbeitsaufträge sollen dazu eine Anregung geben. Es ist auch möglich, dass die Schüler bestimmte formale Vorbereitungen treffen sollen (z. B. Anlegen von Messwertetabellen), die eine rationelle Durchführung des Experiments unterstützen. Die Aufträge zur Vorbereitung können gegebenenfalls auch in häuslicher Arbeit erfüllt werden. Durchführung: Diese Aufträge sollen die erfolgreiche Abfolge experimenteller Handlungen anleiten. Entschließt sich der Lehrer für eine umfangreiche Einbeziehung der Schüler in die Planung des jeweiligen Experiments, dann stellen diese Aufträge lediglich eine Anregung für den Lehrer und eine Zusammenfassung für den Schüler dar. Bei mehreren Experimentieranleitungen können auch nur einzelne Aufträge für die Bearbeitung durch die Schüler ausgewählt werden. Auswertung: Dieser Abschnitt enthält die Niederschriften zu den Beobachtungen und Messungen. Auch hier muss der Lehrer entscheiden, inwieweit die Schüler schon selbstständig arbeiten sollen. Bei einfachen Experimenten oder Experimentierfolgen werden einzelne Gliederungsabschnitte auch weggelassen oder zusammengefasst. Die Hinweise für den Lehrer enthalten Empfehlungen, die dem Lehrer Möglichkeiten der didaktischen Einordnung des Schülerexperiments in den Unterricht aufzeigen. Es werden Hinweise zu Variationen gegeben. In einer Liste sind Geräte und Hilfsmittel angeführt, die bei der Erprobung des Experiments verwendet wurden. Das schließt die Durchführung des Experiments mit anderen Geräten nicht aus. Bei einigen Experimenten empfiehlt sich aber dann eine vorherige Erprobung. Zu den Aufträgen der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung werden konkrete Hinweise gegeben, die einen optimalen Erfolg der experimentellen Schülertätigkeit unterstützen bzw. auf Besonderheiten aufmerksam machen. Ais Nachschlagewerk, dass die Schüler sowohl bei der Vorbereitung ais auch bei der Nachbereitung der Experimente nutzen können, empfiehlt sich das für Schüler der Sekundarstufe l entwickelte Werk Basiswissen Schule Physik ISBN 3-89818-010-7 oder ISBN 3-411-71461-1 Dieses Nachschlagewerk ist auch im Internet unter www.schuelerlexikon.de zu finden. 2 Experimente für den Anfangsunterricht Hinweise und Empfehlungen Die nachfolgenden Anleitungen sind für den physikalischen Anfangsunterricht konzipiert. Sie sind in diesem Teil so angelegt, dass sie von Schülern genutzt werden können, die noch wenig Erfahrungen im selbstständigen Experimentieren haben. Aus diesem Grunde sollen die Anleitungen vom Lehrer so verwendet werden, dass mehrere Funktionen des selbstständigen Experimentierens erfüllt werden: 1. Die Schüler werden durch eine didaktisch gegliederte Abfolge von Arbeitsaufträgen in kleinen Schritten zur Lösung der Experimentieraufgabe geführt. Dabei eignen sie sich physikalische Grundkenntnisse an bzw. vertiefen diese. Deshalb empfiehlt es sich die Experimente unmittelbar im Unterrichtsablauf einzusetzen. Dabei sind einige Anleitungen zur Motivierung (z. B. Temperatur und Wärme), andere in der Erarbeitungsphase (z. B. Reflexion des Lichtes) oder zur Vertiefung durch Übung (z. B. Massebestimmung) und Anwendung (z. B. Bewegungen von Körpern) besonders geeignet. Sie können häufig nach geringfügigen Änderungen auch in anderen didaktischen Funktionen eingesetzt werden (z. B. Volumenbestimmung). Die Detailliertheit der Arbeitsaufträge kann entsprechend den Möglichkeiten der Schüler auch zurückgenommen werden, wenn dadurch eine kreative Variation der Aufgabenlösung durch die Schüler erreicht werden soll und kann. 2. Die Anleitungen berücksichtigen, dass die Schüler im Anfangsunterricht meist erstmalig mit den Experimentiergeräten bekannt werden. Deshalb empfiehlt es sich mitunter eine bestimmte Reihenfolge der Schülerexperimente einzuhalten. So können beispielsweise im Experiment ,,Ausbreitung des Lichtes" Kenntnisse zum Aufbau und zur Handhabung der Experimentierleuchte und zur Methode der Untersuchung des Lichtweges in der Tischebene vermittelt und geübt werden, die für weitere optische Experimente Voraussetzung sind. Beim Experiment zur Reflexion des Lichtes sind dann nur weitergehende Erläuterungen zu den hinzukommenden Experimentiergeräten erforderlich. Bei den Experimenten zur Bildentstehung werden die Gerätekenntnisse durch solche zum Umgang mit den Geräten der optischen Bank erweitert. Eine bessere Konzentration der Schüler auf die experimentelle Aufgabe wird dadurch unterstützt. Bei den Experimenten zur Volumenbestimmung werden im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Messzylindern Fertigkeiten zum Ablesen analoger Messgeräteskalen angestrebt, die beim Wägen auf der Schnellwaage, beim Ablesen von Kraftmesserskalen und Thermometern sowie bei elektrischen Messgeräten genutzt werden können. Ähnliches bezieht sich auch auf den Umgang mit Wärmequellen, bei denen besonders Kenntnisse zum Gesundheits- und Brandschutz vertieft werden können. 3. Die Schüler sollen Kenntnisse über physikalische Arbeitsverfahren erwerben und zunehmend selbstständig bei Schülerexperimenten anwenden. So werden zum Beispiel beim Experiment ,,Bewegung von Körpern" die Merkmale einer gleichförmigen Bewegung reaktiviert, um die vorliegende Bewegung daraufhin zielgerichtet zu untersuchen. Sie wenden dabei u. U. erstmals die Methode der Interpretation eines Diagramms im Physikunterricht an. Verlagsinfo
Zur Unterstützung des experimentellen Physikunterrichts sind in den Kopiervorlagen Experimentieranleitungen Anleitungen für solche Experimente zusammengestellt, nach denen der Schülerweitgehend selbständig arbeiten kann. Um das systematische Herangehen zu fördern, sind alle Experimente in Aufgabe, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung gegliedert. Die Experimente für die Sekundarstufe I decken den Gesamtlehrgang ab: Enthalten sind neben 12 einfachen Experimenten für den Anfangsunterricht etwa 70 Experimente für die Mittelstufe und 25 Praktikumsexperimente. Die Anleitungen sind so gestaltet, dass für jedes Experiment ein Blatt vorgesehen ist. Die Vorbereitung und Auswertung des jeweiligen Experiments kann teilweise auf diesem Blatt vorgenommen werden, das der Schüler dann auch in seine Unterlagen einheften kann. Für Lehrerinnen und Lehrer enthalten die Kopiervorlagen zu jedem Experiment didaktische Hinweise, Hinweise zu Geräten und Hilfsmitteln sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Im Kombipaket erhalten Sie die Kopiervorlagen Experimentieranleitungen in der Printversion und auf CD-ROM. In der elektronischen Variante liegen die Experimentieranleitungen ais Word-Dokumente vor und können so vom Lehrer leicht verändert und seinen spezifischen Bedingungen angepasst werden. Inhaltsverzeichnis
Schüller experimentieren im Physikunterricht
Experimentieranleitungen für die Sekundarstufe l 1 Hinweise zur Nutzung der Anleitungen für Schülerexperimente 2 Experimente für den Anfangsunterricht - Hinweise und Empfehlungen Bestimmung des Volumens A 1 Bestimmung der Masse A 2 Dichte von Stoffen A 3 Bewegung von Körpern A 4 Temperatur und Wärme A 5 Schmelzen von Eis A 6 Ausbreitung des Lichtes A 7 Reflexion des Lichtes A 8 Brechung des Lichtes A 9 Brechung an planparalleler Platte und Prisma A 10 Bildentstehung durch Sammellinsen A 11 Bildentstehung beim Auge A 12 3 Experimente für die Mittelstufe - Hinweise und Empfehlungen 3.1 Mechanik Gewichtskräfte von Hakenkörpern M 1 Hookesches Gesetz M 2 Reibung M 3 Kräfte an Rollen M 4 Goldene Regel der Mechanik M 5 Kräfte und Wege an Rollen M 6 Geneigte Ebene l M 7 Geneigte Ebene II M 8 Hebelgesetz l M 9 Hebelgesetz II M 10 Newtonsches Grundgesetz M 11 Wirkungsgrad l M 12 Wirkungsgrad II M 13 Archimedisches Gesetz l M 14 Archimedisches Gesetz II M 15 Schwimmen von Körpern M 16 3.2 Wärmelehre Temperatur und Wärme W 1 Wärmequellen l W 2 Wärmequellen II W 3 Grundgleichung der Wärmelehre W 4 Wärmekapazität von Messanordnungen W 5 Wärmeaustausch W 6 Heizwert von Brennstoffen W 7 Temperaturverlauf beim Abkühlen W 8 Volumenänderung von Flüssigkeiten W 9 Schmelztemperatur W 10 Schmelzwärme von Eis W 11 Verdunsten W 12 Volumenänderung von Gasen bei Temperaturänderung W 13 3.3 Elektrizitätslehre Ladungstrennung E 1 Elektrische Stromkreise E 2 Messen elektrischer Stromstärken E 3 Elektrische Stromstärken im unverzweigten und im verzweigten Stromkreis E 4 Messen elektrischer Spannungen E 5 Elektrische Spannungen im unverzweigten und im verzweigten Stromkreis E 6 Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke E 7 Elektrische Leistung eines Gerätes E 8 Elektrischer Widerstand von Bauelementen E 9 Widerstandsbestimmung E 10 Spezifischer elektrischer Widerstand E 11 Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes eines Drahtes von dessen Länge und Querschnittsfläche E 12 Kennlinie einer Metallfadenlampe E 13 Widerstände im unverzweigten und im verzweigten Stromkreis I E 14 Widerstände im unverzweigten und im verzweigten Stromkreis II E 15 Untersuchungen am Spannungsteiler I E 16 Untersuchungen am Spannungsteiler II E 17 Kraftwirkung einer Spule E 18 Relaisschaltungen E 19 Elektromagnetische Induktion I E 20 Elektromagnetische Induktion II E 21 Elektromagnetische Induktion III E 22 Messen von Wechselstromgrößen E 23 Transformator E 24 Wechselstromwiderstände E 25 Spule und Kondensator im Wechselstromkreis E 26 Leitungsvorgänge in Metallen E 27 Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von Halbleiterbauelementen E 28 Halbleiterdiode E 29 Transistor E 30 Transistor ais Schalter E 31 3.4 Optik Brechung des Lichtes O 1 Bildentstehung durch Sammellinsen O 2 Beobachtungen am optischen Gitter O 3 Interferenz und Spektren O 4 3.5 Schwingungen und Wellen Schwingungsdauer eines Federschwingers S 1 Schwingungsdauer eines Fadenpendels S 2 Ermittlung der Fallbeschleunigung mit einem Fadenpendel S 3 Mechanische Schwinger S 4 Untersuchungen an Schwingern S 5 4 Praktikumsexperimente -Hinweise und Empfehlungen Dichte von festen und flüssigen Stoffen P 1 Geradlinige Bewegungen P 2 Newtonsches Grundgesetz P 3 Reibung bei Bewegung auf geneigter Ebene P 4 Schallgeschwindigkeit P 5 Gekoppelte Fadenpendel P 6 Energieumwandlungen an Schwingern P 7 Wärmekapazität eines Kalorimeters und spezifische Wärmekapazität P 8 Spezifische Wärmekapazität flüssiger Stoffe P 9 Kennlinien elektrischer Bauelemente I P 10 Kennlinien elektrischer Bauelemente II P 11 Helligkeitssteuerung einer Glühlampe P 12 Thermistor als Mess-Sensor P 13 Halbleiterdiode P 14 IC-IB-Kennlinie eines Transistors P 15 Relaisschaltungen P 16 Belasteter Gleichstrommotor P 17 Wirkungsgrad eines Transformators P 18 Spule und Kondensator im Wechselstromkreis P 19 Erzwungene Schwingungen – Resonanz im Schwingkreis P 20 Eigenfrequenz eines Schwingkreises P 21 Brechzahl und Totalreflexion P 22 Lichtbrechung und Totalreflexion P 23 Brennweite von Sammellinsen P 24 Brennweite einer Sammellinse - optische Bilder P 25 Beugung am Gitter P 26 |
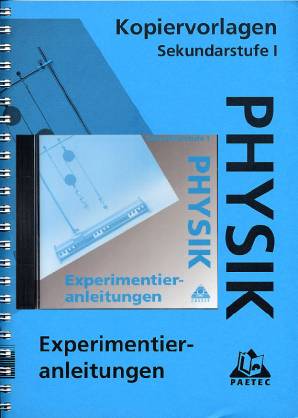
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen