|
|
|
Umschlagtext
"Optimales Sportwissen" ist ein Lehr- und Lernbuch für Schüler der gymnasialen Oberstufe, aber auch Sportstudenten im Grundstudium und interessierte Sporttreibende werden es mit Gewinn lesen. Dank großer Beliebtheit bei Schülern und Lehrern liegt es nun bereits in der 2. Auflage vor.
Auf verständliche und kompakte Art bringt es dem Leser die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Bereichen Sportbiologie, Trainingslehre und Sportmedizin nahe. Berücksichtigt werden dabei sowohl der Breiten- und Gesundheitssport als auch der Leistungssport. Weitere Schwerpunkte sind die Methodik und Praxis des Kraft-, Ausdauer- und Schnelligkeitstrainings sowie das Koordinationstraining. Der sportmedizinische Teil beinhaltet auch das wichtige Thema Doping. Die Kapitel über Ernährung im Sport und über Sportpsychologie - ergänzt durch das Thema Motivation - runden das umfassende Buch ab. Eine didaktisch hochwertige, lesefreundliche Gestaltung mit hervorgehobenen Definitionen und Schlagwörtern, zahlreichen Praxisbeispielen sowie Übungsaufgaben motiviert Schüler zur aktiven Arbeit mit diesem Buch und ermöglicht eine selbständige und optimale Erarbeitung der Thematik. Neu in der 2. Auflage: Neu hinzugekommen sind die Kapitel über Blut, Atmung und Gefäßsystem sowie deren jeweilige Anpassungserscheinungen im Sport. Zahlreiche Abbildungen wurden ergänzt und leicht verständliche Erläuterungen anhand von Praxisbeispielen gegeben. Rezension
von Christian Prior
"Optimales Sportwissen" bietet ein kompaktes, leicht verständliches Grundlagenbuch für den Sportunterricht. In übersichtlich strukturierten Kapiteln werden alle relevanten Themen der Sportwissenschaft grundlegend erklärt und verständlich behandelt. Viele übersichtliche Grafiken unterstützen dies. Durch kurze Aufgabenstellungen am Ende der Kapitel wird ein selbstständiges Erarbeiten und Lernen der Thematiken unterstützt. Durch kompakte Zusammenfassungen und ausreichende Praxisbeispiele ist der Transfer in den schulischen als auch sportlichen Alltag ausreichend gesichert. In Kombination mit den separat erhältlichen Arbeitsmaterialien stellt dieses Werk eine sehr gute Grundlage für Sportlehrer dar, die ich nur noch ungern missen möchte. Fazit:ein absolute empfehlenswertes Buch, sowohl zum schnelle Nachschlagen, als auch zur Unterrichtsvorbereitung! Zudem ein recht kostengünstiges Lehrwerk! Verlagsinfo
Sportwissen optimal und kompakt - als Lehr- und Lernbuch für den Sportunterricht Schwerpunkte: Theorie und Methodik Trainingsprinzipien Sportbiologie Kraft, Kondition, Schnelligkeit Koordination Sportverletzungen Sporternährung Sportpsychologie Vorzüge: schülernah geschrieben Markierung der wichtigsten Begriffe Markierung von Definitionen Übungsbeispiele aus der Praxis zahlreiche Abbildungen Aufgaben zur Wiederholung selbstständige Erarbeitung Für das Buch wurde in der Zwischenzeit die Schulbuchzulassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Landes Niedersachsen erteilt. Darüber hinaus wird es für den Einsatz an Schulen in Baden-Württemberg empfohlen. Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort zur 2. Auflage 1 Theorie und Methodik des Trainings und Trainierens 1.1 Sportliche Leistungsfähigkeit 1.2 Langrfistige Trainingsplanung 1.2.1 Allgemeine Grundlagenausbildung 1.2.2 Nachwuchstraining 1.2.3 Hochleistungstraining 1.3 Zusammenfassung 2 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Trainings und Trainingsprinzipien 2.1 Allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Trainigs 2.1.1 Qualitätsgesetz (physiologisches Gesetz) 2.1.2 Reizschwellengesetz 2.1.3 Gesetz der Anpassungsfähigkeit 2.1.4 Gesetz der Homöostase und Sumperkompensation 2.1.5 Gesetz zum Verlauf der Leistungsentwicklung 2.1.6 Gesetz der Trainierbarkeit 2.2 Trainingsprinzipien 2.2.1 Übergeordnetes Leistungsprinzip: Prinzip der Entwicklungs- und Gesundheitsförderung 2.2.2 Prinzip der progressiven Belastungssteigerung 2.2.3 Prinzip der Variation der Trainingsbelastung 2.2.4 Prinzip der Wiederholung und Kontinuität 2.2.5 Prinzip der Periodisierung und Zyklisierung 2.2.6 Prinzip der zunehmenden Spezialisierung 3 Sportbiologie 3.1 Aktiver Bewegungsapparat, Muskulatur und Energiebereitstellung 3.1.1 Arten des Muskelgewebes und Aufbau des Skelettmuskelgewebes 3.2 Energiebereitstellung im Muskel 3.2.1 Anaerobe Energiegewinnung 3.2.2 Aerobe und anaerobe Schwelle 3.2.3 Aerobe Energiegewinnung 3.3 Bedeutung in der Praxis 3.4 Muskelkater 3.5 Herz-Kreislauf-System und sportliches Training 3.5.1 Anatomisch-physiologische Grundlagen zum Aufbau und zur Funktion des Herzens 3.5.2 Kenngrößen der Herzfunktion 3.5.3 Anpassungserscheinungen des Herz-Kreislauf-Systems an die Ausdauerbelastungen 3.5.4 Bedeutung der Pulsfrequenzkontrolle 3.6 Blut 3.6.1 Funktionen 3.6.2 Zusammensetzung 3.6.3 Blutzellen 3.6.4 Plasma 3.6.5 Anpassungserscheinungen an körperliche Belastungen 3.7 Blutdruck 3.7.1 Gefäßsystem 3.7.2Anpassungserscheinungen an sportliche Belastungen 3.8 Atmung und sportliche Belstung 3.8.1 Lungenvolumina 3.8.2 Verhalten bei körperlicher Belastung 3.9 Passiver Bewegungsapparat und sportliches Training 3.9.1 Gelenke und ihre Bedeutung für den Sportler 3.9.2 Kniegelenk 3.9.3 Sprunggelenk 3.9.4 Wirbelsäule 3.9.5 Schultergelenk 4 Ausdauertraining 4.1 Ausdauerarten 4.2 Grundlagenausdauer 4.2.1 Bedeutung der Grundlagenusdauer 4.2.2 Azyklische Spielausdauer 4.3 Sportmedizinische Grundlagen des Ausdauertrainings 4.3.1 Maximales Sauerstoffaufnahmevermögen 4.3.2 Ermüdung 4.3.3 Übertraining 4.3.4 Regeneration 4.4 Ausdauertraining - Kurzcharakteristik von Ausdauersportarten 4.5 Methodik des Ausdauertrainings 4.5.1 Intensitätsbestimmung 4.5.2 Laktatschwellenkonzept 4.5.3 Ausdauertrainingsbereiche - abgeleitet von der maximalen Herzfrequenz 4.5.4 Ausdauertraining nach der Karvonen-Formel 4.5.5 Minimaltrainingsprogramme 4.6 Praxisbeispiel zum Ausdauertraining 4.6.1 Trainingsplan für einen 12-Minuten-Lauf 4.6.2 Trainingsplan für einen 30-Minuten-Lauf 4.7 Zusammenfassung 4.8 Methodik des Ausdauertrainings 4.9 "Klassische" Methoden der Belastungssteuerung im Konditionstraining 4.9.1 Dauermethode 4.9.2 Wiederholungsmethode 4.9.3 Intervallmethode 5 Kraftraining 5.1 Bedeutung der Kraft 5.1.1 Trainierbarkeit der Kraft 5.1.2 Kraft bestimmende Faktoren 5.2 Maximalkraft 5.2.1 Trainingsmittel zur Verbesserung der Maximalkraft 5.2.2 Pyramidentraining 5.2.3 Circuittraining 5.3 Kraftausdauer 5.3.1 Training der Kraftausdauer 5.4 Schnellkraft 5.4.1 Training der Schnellkraft 5.5 Reaktivkraft 5.6 Zusammenhang der Kraft mit anderen motorischen Hauptbeanspruchungsformen 5.7 Allround-Krafttrainingsprogramm in einem Fitnessstudio 5.8 Krafttraining nach dem subjektiven Belastungsempfinden 5.8.1 Praktische Umsetzung im Krafttraining 6 Schnelligkeitstraining 6.1 Sportbiologische Grundlagen der Schnelligkeit 6.2 Aktionsschnelligkeit (Bewegumgsschnelligkeit) 6.2.1 Azyklische Aktionsschnelligkeit 6.2.2 Zyklische Aktionsschnelligkeit 6.3 Belastungsgefüge im Schnelligkeitstraining 6.4 Schnelligkeitsausdauer 6.5 Handlungsschnelligkeit 6.6 Reaktionsschnelligkeit 6.7 Training der Schnelligkeit 6.7.1 Wiederholungsmethode 6.7.2 Motorische Hauptbeanspruchunsformen und Schnelligkeit 6.8 Schnelligkeitstraining im Kindes- und Jugendalter 7 Beweglichkeitstraining 7.1 Arten der Beweglichkeit 7.2 Bedeutung der Beweglichkeit 7.3 Praxishinweise zum Beweglichkeitstraining - Dehungsübungen 7.4 Zusammenfassung 8 Koordinationstraining 8.1 Koordinative Fähigkeiten 8.1.1 Orientierungsfähigkeit 8.1.2 Differenzierungsfähigkeit 8.1.3 Kopplungsfähigkeit 8.1.4 Gleichgeweichtsfähigkeit 8.1.5 Rythmisierungsfähigkeit 8.1.6 Reaktionsfähigkeit 8.1.7 Umstellungsfähigkeit 8.1.8 Antizipation 8.2 Analysemodell nach Neumaier 8.2.1 Optischer Analysator 8.2.2 Akkustischer Analysator 8.2.3 Kinästhetischer Analysator 8.2.4 Vestibulärer Analysator 8.2.5 Taktiler Analysator 8.2.6 Trainingsmethodische Konsequenzen 8.3 Entwicklung der Koordination vom frühen Schulkindalter bis ins Seniorenalter 8.4 Methodische Grundsätze und methodische Maßnahmen im Koordinationstraining 8.5 Koordination im Gesundheitssport 8.6 Koordination im Bewegungslernen/Techniktraining 8.7 Risiken und Gefahren des Koordinationstrainings 9 Training im Freizeitsport - Fitnesstraining 9.1 Ziele und Inhalte des Fitnesstrainings 9.2 Gestaltung des Fitnesstrainings 9.3 Methodik des Ausdauertrainings im Fitnessbereich 9.4 Krafttraining und Fitness 9.5 Beweglichkeitstraining und Fitness 9.6 Ernährung und Fitnesstraining 10 Gesundheitssport 10.1 Zugänge zum Gesundheitssport 10.2 Gesundheitskonzepte 10.2.1 Bindungsmodell 10.2.2 Salutogenesemodell 10.2.3 Bewältigungsmodell 10.2.4 Risikofaktorenmodell 10.3 Gesundheits-ABC der Sportarten 10.4 Geeignete Sportarten bei Bluthochdruck 11 Aufwärmen im Sport 11.1 Ziele im allgemeinen Aufwärmen 11.2 Ziele im speziellen Aufwärmen 12 Sport und Ernährung 12.1 Besondere Bedingungen des Sports 12.2 Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt 12.2.1 Thermoregulation 12.2.2 Zusammenhang zwischen Flüssigkeitsverlust und Leistungsfähigkeit 12.2.3 Trinken während sportlicher Belastung 12.2.4 Ausgewählte Getränke im Überblick 12.3 Feste Nahrung 12.3.1 Kohlenhydrate 12.3.2 Fette 12.3.3 Proteine 12.3.4 Vitamine 12.4 Gewichtsreduktion und Sport 12.5 Zusammenfassung 12.6 Zusammenspiel von Ernährung, Herz-Kreislauf-System und Energiebereitstellung 13 Psychologische Aspekte des Sporttreibens 13.1 Konzentration im Sport 13.1.1 Ziel 13.1.2 Bedürfnisse, Motivation, Wünsche 13.1.3 Entspannung 13.1.4 Zeit 13.1.5 Konzentrationsrichtungen 13.1.6 Konzentrationstraining und -kontrolle 13.2 Motivation im Sport 13.3 Leistungsmotivation im Sport 14 Sportverletzungen 14.1 Hauptursache von Sportverletzungen und Sportschäden 14.2 Sportverletzungen - PECH gehabt? 14.3 Beispiele zu Sportverletzungen 15 Doping 15.1 Definition und Dopingliste 15.2 Dopingkontrollen 15.3 Begründung des Dopingverbots Glossar Abkürzungen Literatur Sachregister |
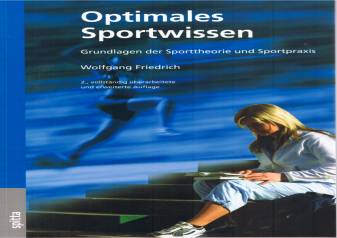
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen