|
|
|
Umschlagtext
Wir verdrängen Tod und Sterben als Tatsache und Erfahrung nicht, wir lassen sie uns wie maßgebliche Teile unseres Lebens von anderen aus den Händen nehmen. In diesem aus dem Blickwinkel der Gesundheitswissenschaften geschriebenen Buch wird untersucht, wie es dazu kommen konnte, wer davon zu unserem Nachteil profitiert und was getan werden kann, um über die Wiederaneignung von Tod und Sterben zu einem gesünderen Leben zu gelangen.
Dass wir Tod und Sterben »verdrängen« würden, stimmt nicht. Richtig ist, dass wir uns die Definitionshoheit über das, was sie für uns bedeuten und wie wir mit ihnen, insbesondere mit der ambivalenten Tatsache unseres eigenen Sterbens, umgehen sollten, haben ebenso aus der Hand nehmen lassen, wie die Verantwortung für wichtige Bereiche unseres Privat- und Arbeitslebens. In diesem, aus dem Blickwinkel der Gesundheitswissenschaften geschriebenen Buch wird untersucht, warum und wie es dazu kommen konnte, wer heute davon profitiert, was uns infolge dieser Enteignung verloren geht und was getan werden kann, um über die Wiederaneignung von Tod und Sterben zu einem gesünderen Leben zu gelangen. Für den Anfang sollten wir lernen, wieder selbstverständlicher mit ihnen zu leben. Rezension
Lange Zeit dominierte die sog. Verdrängungsthese den gesellschaftlichen Diskurs über Sterben und Tod. Der hier anzuzeigende, für Gesellschaftkunde- wie Religionslehrkräfte gleichermaßen erhellende Band aus der Perspektive der Gesundheitswissenschaften wählt einen anderen Ansatz: Der Mensch muss sich Sterben und Tod bewußt wieder aneignen, wieder die Hoheit über sie gewinnen, nachdem sie ihm in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend aus der Hand genommen worden ist. Positiv gewendet bedeutet das: Gesundheitsförderung als einen möglichen Weg zu gesundem Sterben wahrzunehmen (vgl. Kap. 8) und Tod und Sterben als Themen und gesundes Leben als Ziel lebenslangen Lernens zu begreifen (vgl. Kap. 9), so dass sich insgesamt über die Wiederaneignung von Tod und Sterben ein Weg zum gesünderen Leben ergibt (vgl. Kap. 10).
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einführung 13
Kapitel 1 Exkurs über „Angst“ 18 Kapitel 2 Über das Verhältnis von Gesundheit, Krankheit, Tod und Sterben 23 2.1 Die neue Welt der Gesundheit 24 2.2 Was wir unter Krankheit verstehen sollten 28 2.3 Tod und Sterben heute 31 2.4 Gesundheit, Krankheit, Tod und Sterben – vereinbare oder separate Welten? 34 2.5 Erste Konturen einer noch fernen Kultur gesunden Sterbens 37 Kapitel 3 Der Umgang mit Tod und Sterben in den Weltreligionen 40 3.1 Die wichtigsten Triebkräfte für den religiösen Umgang mit Tod und Sterben 43 3.1.1 Gattungsgeschichtlich relevante Triebkräfte 44 3.1.2 Individual-psychische Triebkräfte 46 3.1.3 Gesellschaftliche Triebkräfte 47 3.2 Tod und Sterben im Judentum 49 3.3 Tod und Sterben im Christentum 53 3.4 Tod und Sterben im Islam 59 3.5 Tod und Sterben im Hinduismus 64 3.6 Tod und Sterben im Buddhismus 68 3.7 Zusammenfassung 71 Kapitel 4 Tod und Sterben aus Sicht der herkömmlichen Wissenschaften 73 4.1 Was die herkömmlichen Wissenschaften sind und was sie leisten 74 4.2 Tod und Sterben aus Sicht der Theologie 75 4.3 Tod und Sterben aus Sicht der Naturwissenschaften 77 4.4 Tod und Sterben aus Sicht der „Management“-Wissenschaften (Demographie, Ökonomie, Recht) 81 4.5 Tod und Sterben aus Sicht der Sozialwissenschaften 84 4.5.1 Die Psychologie 85 4.5.2 Die Soziologie 88 4.5.3 Die Gerontologie 90 4.6 Tod und Sterben aus Sicht der Krankheitswissenschaften 93 4.6.1 Medizinische Versorgungsforschung 94 4.6.2 Pflegeforschung 97 4.7 Tod und Sterben aus der Sicht der Philosophie und Ethik 100 4.8 Zusammenfassung 103 Kapitel 5 Der Tod als singuläres Ereignis und das Sterben als individuelles Geschehen 105 5.1 Geschichte(n) individuellen Sterbens 106 5.1.1 Der ebenso beliebte wie problematische Früher-heute-Vergleich 107 5.1.2 Qualifizierungsversuche des aktuellen Umgangs mit Tod und Sterben 108 5.2 Zur Verteilung von Tod und Sterben in Deutschland 111 5.3 Einstellungen zu Tod und Sterben – exemplarische Befunde 116 5.3.1 Vorstellungen über Tod und Sterben 116 5.3.2 Nahtoderfahrungen 122 5.4 Über das Verhältnis von selbstbestimmtem Leben und menschenwürdigem Sterben 125 Kapitel 6 Zur gesellschaftlichen Konstruktion von Tod und Sterben 129 6.1 Individualisierung und das Schwinden der Primärerfahrung – eine Zeitdiagnose 131 6.2 Die Familie als Konstruktionsinstanz 135 6.3 Die Kirchen 138 6.4 Das Gesundheitswesen 141 6.4.1 Sterben im Krankenhaus und in Pflegeheimen 143 6.4.2 Palliativmedizinische Sterbebegleitung – das gute Sterben I 146 6.4.3 Hospizliche Versorgung – das gute Sterben II 149 6.5 Die Bestattungswirtschaft 151 6.6 Erziehungseinrichtungen und Medien als Konstruktionsinstanzen von Tod und Sterben 155 6.6.1 Erziehungseinrichtungen – hauptsächlich Kindergärten und Schulen 155 6.6.2 Elektronische Medien – vor allem Fernsehen und Internet 159 6.7 Zusammenfassung 162 Kapitel 7 Tod und Sterben in den Gesundheitswissenschaften 164 7.1 Gesundheitswissenschaften – (k)ein sinnvoller thematischer Ort für Tod und Sterben? 165 7.2 Tod und Sterben in der gesundheitswissenschaftlichen Versorgungs- und Pflegeforschung 167 7.3 Tod und Sterben in der Salutogenese-Forschung 172 7.4 Durch Innewerden der Endlichkeit zur identischen Persönlichkeit – die Sozialisationsperspektive 175 Kapitel 8 Gesundheitsförderung als ein möglicher Weg zu gesundem Sterben 181 8.1 Tödliche Krankheiten verhindern oder menschenwürdiges Sterben fördern? 182 8.1.1 Humanisierung der Sterbebegleitung 183 8.1.2 Krankheitsorientierte Verhaltensprävention 184 8.1.3 Gesundheitsförderndes Intervenieren 185 8.2 Theoretische Überlegungen zu einer auf den Umgang mit Tod und Sterben gerichteten Interventionsstrategie 190 8.2.1 Eine kommunizierbare Theorie braucht eindeutige Begriffe 191 8.2.2 „Menschenwürdiges“ Sterben in der aktuellen Diskussion 196 8.2.3 Rahmenbedingungen für ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Sterben 205 8.2.4 Ist menschenwürdiges Sterben lernbar? 210 8.3 Vorläufige Zusammenfassung 214 Kapitel 9 Tod und Sterben als Themen und gesundes Leben als Ziel lebenslangen Lernens 216 9.1 Argumente für ein lebensbegleitendes und modular organisiertes Interventionsprogramm 218 9.2 Modul 1 – Zur Förderung von Urvertrauen, Bindungsfähigkeit und Affektkontrolle in und mit Familien 222 9.2.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 222 9.2.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 226 9.2.3 Mögliche Wirkungen der Förderungsarbeit in und mit Familien 231 9.3 Modul 2 – „Mama, wann kommt Opa wieder?“ – Ansatzpunkte für ein Begegnungsprogramm mit Tod und Sterben im Vorschulalter 231 9.3.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 232 9.3.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 234 9.3.3 Mögliche Wirkungen der kita- und familiengestützten Arbeit mit Vorschulkindern 237 9.4 Modul 3 – „Wie ist das, wenn man tot ist?“ – Kommunikationschancen im (Grund-)Schulalter 238 9.4.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 239 9.4.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 242 9.4.3 Mögliche Wirkungen der schul- und familiengestützten Arbeit mit Kindern im Schulalter 245 9.5 Modul 4 – Jugend – „Sterben? Das tun doch nur die Anderen, oder …?“ 247 9.5.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 248 9.5.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 249 9.5.3 Mögliche Wirkungen der Informations- und Bewältigungsarbeit mit Jugendlichen 251 9.6 Modul 5 – „Schon möglich, aber daran mag ich jetzt noch nicht denken!“ – mit Erwachsenen über den Tod, das Sterben und das Leben reden 253 9.6.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 253 9.6.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 256 9.6.3 Mögliche Wirkungen der Informations- und Bewältigungsarbeit mit Erwachsenen 259 9.7 Modul 6 – Gegen Selbstaufgabe und die Angst vor dem Vergessenwerden in der letzten Lebensphase 261 9.7.1 Physiologische, sozial- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen 262 9.7.2 Inhalte und förderungsstrategisches Vorgehen 263 9.7.3 Mögliche Wirkungen der Informations- und Betreuungsarbeit mit älteren und mit hoch betagten Menschen 266 9.8 Modul 7 – Entwicklung und Einsatz einer solidarischen, auf die Belange sozial Benachteiligter und älterer Menschen ausgerichteten Gesamtpolitik 267 9.8.1 Neubestimmung des Verhältnisses von Subsidiarität und Solidarität 269 9.8.2 Mögliche Wirkungen einer solidarisch-subsidiären Förderungspolitik für ältere Menschen 272 Kapitel 10 Über die Wiederaneignung von Tod und Sterben zum gesünderen Leben – ein Fazit 275 10.1 Zur Unterscheidung von normalem, gutem und gesundem Sterben 278 10.2 Über den Zusammenhang von gesundem Sterben und gesundem Leben 281 10.3 Gesunde Gesellschaft als Bedingung für gesundes Leben und Sterben 284 Abbildungen 290 Literatur 292 Einführung „Offenbar gibt es keine Vorstellung, wie seltsam sie auch sein mag, an die Menschen nicht mit inniger Liebe zu glauben bereit sind, wenn sie ihnen nur Erleichterung von dem Wissen verschafft, dass sie eines Tages nicht mehr existieren werden, wenn sie ihnen nur Hoffnung auf eine Form der Ewigkeit ihrer Existenz gibt.“ Norbert Elias Die Themen Tod und Sterben gehören zu den letzten wirklichen Tabus1 unserer aufgeklärten, verwissenschaftlichten und technisch nahezu omnipotenten Gesellschaft, in der – wie uns die soziologische Systemforschung lehrt (Luhmann 1984) – so gut wie nichts überlebt, wenn es keinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft und zur Funktionstauglichkeit ihrer Mitglieder leistet. Dies führt uns zu der Frage nach dem „Warum“ und dem „Wie“ der eher in Kauf genommenen als bewusst gesuchten Entlastung von der Auseinandersetzung mit dem Lebensende, einer der sichersten Tatsachen, die wir kennen und akzeptieren müssen. Nicht weniger interessant und wissenschaftlich ergiebig ist es, sich mit den individuellen aber auch kollektiven Folgen des Entlastungsgeschehens und mit den Interessen derer zu beschäftigen, die aus dem etablierten Umgang mit Tod und Sterben ihren politischen und wirtschaftlichen, vor allem ihnen, weniger den Betroffenen und der Gesellschaft insgesamt zugutekommenden Nutzen ziehen. Mit den meisten dieser Fragen haben sich die unterschiedlichsten Wissenschaften, unter ihnen Theologie, Philosophie, Rechts-, Natur- und Sozialwissenschaften sowie die Medizin, auf eine für sie typische Weise (Müller 2005) auseinander gesetzt. Ihre Erkenntnisse in Gestalt einer sozialwissenschaftlich fundierten „Thanatologie“, einer Lehre von Tod und Sterben 1 Tabuisiert werden kann ein Tatbestand oder Thema nicht nur dadurch, dass man ihn/es tot schweigt, beziehungsweise unterdrückt. Für die hier behandelten Themen Tod und Sterben trifft das nicht zu, weil nur über wenige andere so viel geredet und geschrieben worden ist. Gegenstände dieser Art können aber auch dadurch der angemessenen Bearbeitung und Bewältigung durch die Betroffenen entzogen, tabuisiert werden, dass man es bestimmten Experten- oder Berufsgruppen erlaubt, die Deutungshoheit und die Leitung öffentlicher Diskurse über das, was sie sind, welche Rolle sie spielen und wie man mit ihnen umzugehen habe, fast vollständig an sich zu reißen. (Feldmann 2004), zusammen zu fassen und in Forschung und Lehre voran zu treiben, wäre der Bedeutung, den ihre Gegenstände allein schon wegen ihrer gesellschafts- und kulturkonstituierenden Wirkungen besitzen, durchaus angemessen. Trotzdem soll der Vielfalt existierender Perspektiven im Rahmen der hier vorgelegten gesundheitswissenschaftlichen Untersuchung noch eine weitere Sichtweise hinzugefügt werden. Im Kanon der etablierten Wissenschaften sind die Gesundheitswissenschaften eine noch relativ junge Stimme und müssen wegen ihrer dem Gegenstand, der Gesundheit und deren Herstellungs- bzw. Aufrechterhaltungsbedingungen geschuldeten Interdisziplinarität (Hurrelmann & Laaser 2001) selbst noch um Anerkennung innerhalb des von Monodisziplinen dominierten Wissenschaftsbetriebs kämpfen. Von daher ist zunächst nicht zu erwarten, dass sie (die Gesundheitswissenschaften) der Todes- und Sterbensforschung völlig neue, bislang noch nicht existierende Erkenntnisbestände hinzu zu fügen vermögen. Das mag später geschehen und ist nicht die primäre Absicht dieses Buches. Tod und Sterben in gesundheitswissenschaftlicher Absicht zu thematisieren, ist wichtig, weil von seiner Endlichkeit aus nicht nur das Leben (Jones 2000), sondern vor allem das Er-Leben des Lebens und mit ihm dasjenige, was dieses Erleben wesentlich formt, nämlich Episoden von Gesundheit und Krankheit, auf eine beiden Phänomenen besonders angemessene Weise in den Blick geraten. Im Zuge der hier verfolgten Argumentationslinien soll außerdem untersucht werden, ob und inwieweit Menschen durch das stärkere Innewerden der Endlichkeit der menschlichen Existenz und durch die kommunikative (Wieder-)Aneignung zu einer betroffeneren Sicht auf Tod und Sterben gebracht werden können. Und es wird darüber hinaus zu fragen sein, ob und unter welchen Umständen sie diese Betroffenheit zu verstärkter Verantwortungsübernahme für das eigne und das Leben der Anderen motivieren und ihre Bereitschaft erhöhen kann, ihr Leben auf eine möglichst befriedigende, selbstbestimmte und gesundheitsbewusste Weise zu organisieren. Ferner kann die Beschäftigung mit Tod und Sterben aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive dazu beitragen, das Selbstverständnis dieses neuen, immer noch um Identitätsfindung bemühten, interdisziplinären Wissenschaftskonsortiums und die Gesundheitsförderung als eines ihrer zentralen Anwendungsgebiete konzeptionell genauer zu justieren (Schnabel 2009). Beiden Themen eine analytisch und praktisch nützliche Perspektive abzugewinnen, die auf die Verbesserung von Gesundheit und Überlebensfähigkeit zielt, statt sich auf der Furcht vor ewiger Verdammnis oder dem Wunsch nach Krankheitsvermeidung um fast jeden Preis zu gründen, wird außerdem bezeugen, dass die Gesundheitswissenschaften durch das, was die Krankheitswissenschaften (Medizin und ihre naturwissenschaftlichen Basiswissenschaften, Pflegewissenschaft, Medizinpsychologie und -soziologie) tun und was sie in Bezug auf die Gesundheits-, Todes- und Sterbensthematik erarbeitet haben, nicht zu ersetzen sind.2 Der erste analytische Teil des Buchs beginnt mit einem Exkurs über Angst (Kap. 1). Untersucht wird die Frage, inwieweit deren geschichtsnotorische Instrumentalisierung durch beruflich interessierte Expertengruppen an der Entstehung der Umgangsformen mit Tod und Sterben beteiligt ist, für die die neuere Thanatologie keine besseren Bezeichnungen als die der Tabuisierung, Verdrängung und/oder Entfremdung findet. In einem ersten Teil (Kap. 2) werden danach die begrifflich-analytischen Voraussetzungen diskutiert, um Leben und Tod unter dem Aspekt des „gesunden Sterbens“ in eine neue Beziehung zueinander zu setzen, die sich von den herrschenden Denk-, Bearbeitungs- und Verarbeitungsroutinen deutlich unterscheidet. Daran anschließend werden zunächst einmal die Sichtweisen untersucht und verglichen, mit denen sich die Weltreligionen (Kap. 3) und die klassischer Weise auf diese Themen abonnierten Einzelwissenschaften (Kap. 4) mit Tod und Sterben auseinandersetzen. In einem auf diese Detailerkenntnisse bezogenen Perspektivwechsel wird sich das Buch sodann mit der Frage beschäftigen, was uns Tod und Sterben heute aus biographisch-ontogenetischer Sicht bedeuten (Kap 5). Hier bietet sich die Gelegenheit, mit dem Sozialisationsparadigma eine Betrachtungsweise ins Spiel zu bringen, die Tod und Sterben anders zu thematisieren erlaubt als das Gros konventioneller Ansätze, die sie als private, verschleierungsbedürftige, ängstigende, krankheitswertige, von der Normalität gesunden Überlebens abweichende Ereignisse betrachten. Dem schließt sich ein weiteres Kapitel (Kap. 6) an, welches dem historischgesellschaftlichen Umgang mit Tod und Sterben gewidmet ist und dabei der Frage nachgeht, welche gesellschaftlichen Instanzen und Berufsgruppen aus den seit Jahrhunderten praktizierten Umgangsformen mit diesen beiden Phänomenen den größten Nutzen ziehen. Diesen Zusammenhängen nach- 2 Der grundlegende Gedanke, Tod und Sterben zum Thema einer kritischen Sozialund Gesundheitspädagogik zu machen, die die Menschen zur selbst- und gesundheitsbewussteren Lebensplanung animiert, ist nicht völlig neu. Konzeptionell vorgedacht, aber zu teilweise fragwürdigen Schlussfolgerungen geführt, haben dies u. a. Josef Hoffmann (1991) oder Gerhard Schmied, Franco Rest und Jürgen Brommert im Rahmen einer von der Arbeitsgruppe „Provokationen zur Gesundheit“ 1994 und 1995 veranstalteten Vortragsreihe, deren Texte in einem von der Gesundheitsakademie Bremen und dem Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, NRW 1996 herausgegebenen Sammelband erschienen sind. Seit dem sind Tod und Sterben auch zu Themen mehrerer Expertentagungen gemacht worden und haben Eingang in die Sozialarbeit und die Erwachsenenbildung, insbes. mit Berufstätigen und älteren Menschen gefunden. Eine auf den Erkenntnissen der Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsförderungsforschung aufbauende Untersuchung ist meines Wissens bislang noch nicht vorgelegt worden. Im anwendungswissenschaftlichen Teil des Buches wird begründet, weshalb es sowohl aus analytischen wie aus praktischen Gründen nützlich, ja notwendig ist, Tod und Sterben nicht nur zum Untersuchungsgegenstand der Krankheits- bzw. Versorgungs-, sondern vor allem auch der Gesundheitswissenschaften zu machen (Kap. 7). Weil diese als Anwendungswissenschaften in der Regel nichts thematisieren, ohne daraus Konsequenzen in Form von neuen Leitlinien und alternative Formen des individuellen und gesellschaftlichen Umgangs mit Krankheit und Gesundheit zu ziehen, soll in dem daran anschließenden Kapitel das zentralen Anwendungsgebiet der Gesundheitswissenschaften, die Gesundheitsförderung (Kap. 8) betrachtet und die Frage untersucht werden, in wie weit sich mit ihrer Hilfe die Bemühungen um die Wiederaneignung von Tod und Sterben als konstitutive Bestandteile einer selbstbestimmten Lebensplanung verwirklichen lassen. Anschließend (Kap. 9) werden die Grundzüge eines modularen und zielgruppenaffinen Interventionsprogramms entwickelt, welches praktische Hinweise liefert, wie dieser Wiederaneignungsprozess auf kommunikative, möglichst unaufgeregte, sachangemessene und nachhaltige Weise organisiert werden kann. Abschließend (Kap. 10) wird argumentiert, dass ein gesundes Sterben ohne ein gesundes Leben und dieses ohne eine gesunde Gesellschaft nicht zu haben ist. Auch wird dort der Frage nachgegangen, ob und welche individuellen Gewinne und gesellschaftlichen Vorteile mit der Einführung einer Kultur verbunden wären, die man unter Bezugnahme auf die zuvor herausgearbeiteten Erkenntnisse und in Absetzung von den etablierten, vordringlich krankheitsorientierten, fremdbestimmten und tendenziell inhumanen Umgangsformen als eine alternative Kultur „gesunden“ Sterbens bezeichnen könnte. Das vorliegende Buch wendet sich nicht nur an angehende und bereits praktizierende Gesundheitswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Gesundheitsförderungsexpertinnen und -experten. Es sollen sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die nach Erklärungen dafür suchen, warum Wissenschaft und Praxis so große Schwierigkeiten damit haben, sich mit Fragen von Tod und Sterben in einer Weise zu beschäftigen, die ihrer wachsenden sozial- und versorgungspolitischen Bedeutung in einer von verhaltensbedingten Massenkrankheiten und Überalterung bestimmten Gesellschaft entspricht. Ihnen will es Wege weisen, wie die Themen in die Aufklärungsarbeit mit Anvertrauten unterschiedlichen Alters nutzbringend integriert werden können. Ferner kann dieses Buch von den Vertretern anderer So- zialwissenschaften mit Gewinn gelesen werden, die es als Anregung oder Herausforderung empfinden, Tod und Sterben von einer nicht nur semantischen, sondern auch phänomenologisch ungewohnten Seite, dem Leben und der Gesundheit her, thematisiert zu finden. Vor allem der zweite anwendungswissenschaftliche Teil des vorliegenden Buches wird vermutlich auch alle in der Elementar-, Schul-, Aus-, Fort- und Weiterbildungspädagogik Tätigen interessieren, die einen Sinn darin sehen, den ihnen anvertrauten Personengruppen bei ihrer Beschäftigung mit den durch Enteignung und Ausbeutung gekennzeichneten Formen des aktuellen Umgangs mit Tod und Sterben behilflich zu sein und sie bei der Durchsetzung ihrer Wiederaneignungsbedürfnisse zu unterstützen. |
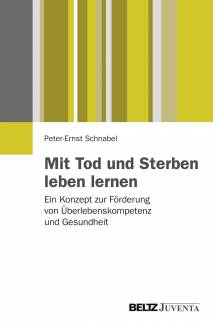
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen