|
|
|
Umschlagtext
Nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2021
Wie kann sich eine Diktatur mit dem Erbe von Unrecht und Staatsverbrechen auseinandersetzen, die unter ihrer Herrschaft begangen wurden? Mit dieser Frage sah sich die Kommunistische Partei Chinas nach dem Tod Mao Zedongs im Jahr 1976 konfrontiert. Gestützt auf eine Vielzahl bislang unbekannter Dokumente entwirft der Freiburger Sinologe Daniel Leese ein breit angelegtes Panorama der chinesischen Politik und Gesellschaft in der kritischen Umbruchphase zwischen 1976 und 1987. Die Massenkampagnen des «Großen Vorsitzenden» Mao Zedong hatten horrende Opferzahlen gefordert und die Volksrepublik China an den Rand eines Bürgerkriegs geführt. Unter seinen Nachfolgern begann die Kommunistische Partei ein großangelegtes Experiment historischer Krisenbewältigung. Millionen politisch Verfolgte wurden rehabilitiert, Entschädigungszahlungen geleistet und Täter vor Gericht gestellt, allen voran die «Viererbande» um Maos Frau Jiang Qing. Das Ziel bestand darin, einen Schlussstrich unter die Geschichte zu ziehen und alle Energien auf die wirtschaftliche Reformpolitik zu lenken. Aber die Schatten der Vergangenheit ließen sich nicht so einfach bannen. Gestützt auf eine Vielzahl bislang unbekannter Quellen – von vormals geheimen Reden der Parteiführung bis zu Petitionsschreiben einfacher Bürger – zeichnet Daniel Leese ein hochdifferenziertes Bild der Dekade nach Mao Zedongs Tod. Die Auswirkungen dieses Ringens um historische Gerechtigkeit sind in der chinesischen Politik und Gesellschaft bis heute spürbar. Daniel Leese lehrt Sinologie mit dem Schwerpunkt "Geschichte und Politik des Modernen China" an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Rezension
An Deutschland läßt sich in doppelter Hinsicht zeigen, wie schwierig es schon für eine Demokratie ist, sich der eigenen diktatorischen Vergangenheit konstruktiv zu stellen: Die Erinnerung und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und die Erinnerung und Auseinandersetzung mit der DDR verdeutlichen das. Ist es einer Diktatur aber - denn auch das heutige moderne China ist eine Diktatur - überhaupt möglich, sich der eigenen diktatorischen Vergangenheit (unter Mao Zedong) zu stellen? Wie geht China mit seiner Vergangenheit um, mit "Maos langem Schatten"? (Buchtitel). Dazu untersucht der Freiburger Sinologe Daniel Leese die Quellen nach dem Tod Mao Zedongs 1976 in dem folgenden Jahrzehnt der kritischen Umbruchphase zwischen 1976 und 1987. Wie konnte es der Kommunistischen Partei gelingen, einerseits die Vergangenheit kritisch aufzuarbeiten und andererseits an der Macht zu bleiben? Nach Maos Tod vollzog sich in der Volksrepublik China ein epochaler Wandel. Mao hatte in seinen letzten Lebensjahren souverän geherrscht. Sein Wort war Gesetz und seine charismatische Autorität bis zuletzt ungebrochen. Unterschiedliche Gruppen rangen danach um Macht und Einfluss. In einem von Verdächtigungen und Anschuldigungen geprägten politischen Klima entschloss sich Hua Guofeng mit Unterstützung des Militärs, die potentiellen Konkurrenten um Maos Frau Jiang Qing auszuschalten. Die radikalen Gefolgsleute Maos wurden verhaftet und ihnen Verbrechen gegen Partei und Staat vorgeworfen. Erklärungsansätze für den Spagat zwischen Machterhaltung und Vergangenheitsaufarbeitung haben bislang vor allem auf die Wirtschaftsreformen und die durch den wachsenden Wohlstand der Bevölkerung begründete "Output-Legitimität" als neue Herrschaftsgrundlage verwiesen, der zum Wirtschaftswunder der folgenden vier Jahrzehnte geführt habe. Dennoch kam in den Jahren nach Mao Zedongs Tod der Vergangenheitspolitik und dem Thema historischer Gerechtigkeit eine maßgebliche Bedeutung bei der Herrschaftskonsolidierung zu. Hieraus folgte ein rund zehnjähriger Prozess der ideologischen, administrativen und gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Erbe der maoistischen Herrschaftsperiode. Zwischen 1976 und 1987 revidierten Parteiorgane und Gerichte Millionen von politischen Bewertungen und juristischen Urteilen. Opfer von Massenkampagnen wurden rehabilitiert und Hunderttausende Täter überprüft, von denen aber bewusst nur ein Teil durch Justiz oder parteiinterne Disziplinarverfahren bestraft wurde, um das übergeordnete Ziel von Einheit und Stabilität nicht zu gefährden.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Pressestimmen: "Daniel Leese hat aus Akten und Dokumenten eine Fülle aufschlussreicher Fakten, Zahlen und sprechender Anekdoten herausdestilliert, an denen sich die tastende Neuorientierung nach Mao so plastisch wie selten zuvor sehen lässt.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mark Siemons "Er zeigt die Tiefenstrukturen der chinesischen Gesellschaft und ihren Umgang mit Verbrechen des Staates. Daniel Leese schöpft aus jahrelanger Dokumentenrecherche.“ Neue Zürcher Zeitung, Helwig Schmidt-Glintzer "Daniel Leese ist mit „Maos langer Schatten“ eines der eindrücklichsten Bücher über die chinesische Gesellschaft nach dem Tod Maos gelungen.“ die tageszeitung, Detlev Claussen "Eine Studie, die in vielerlei Hinsicht beeindruckt (…) Mit eingängiger Sprache und klaren Thesen spricht ‚Maos langer Schatten‘ eine breite Leserschaft und die akademische Geschichtswissenschaft gleichermaßen an (…) Die Nominierung für den Deutschen Sachbuchpreis 2021 ist mehr als verdient." H-Soz-Kult, Martin Wagner "Beschäftigt (…) sich auch mit der Funktion, die Geschichte im politischen System der Volksrepublik hat." Deutschlandfunk, Anja Reinhardt "Herausragendes Buch zu Aufarbeitung und Verdrängung der Geschichte in einer kommunistischen Diktatur.“ Die Presse, Burkhard Bischof "Eine materialreiche Informationsschrift erster Klasse (…) aufschlussreich und notwendig für das Verständnis eines Landes, das sich vermutlich zum mächtigsten der Welt entwickeln wird." Lesart "‘Maos langer Schatten‘ gestattet es, Denkmauern zu überwinden und hinterfragt sehr lesenswert einen spannenden Abschnitt chinesischer Geschichte." Sachsen Lesen Inhaltsverzeichnis
Prolog: Zwischen Revolution und Reform 13
Politischer Kurswechsel 19 Historisches Unrecht und Übergangsjustiz 25 Aufbau und Quellen 32 1 Revolution und historische Gerechtigkeit 37 Schatten der Vergangenheit 38 Verteilungsgerechtigkeit und Landreform 43 Gefühlspolitik oder Gehirnwäsche? 52 Die Dialektik des Terrors 58 Der Umgang mit den städtischen Eliten 67 Historische Gerechtigkeit und außenpolitische Staatsräson 76 2 Recht und Politik 88 Recht und Revolution in der Sowjetunion 92 Justiz im Kaiserreich und in der Republik China 99 Revolutionäre Justizarbeiter 106 Kampagnenjustiz und Hinrichtungsquoten 111 Ein kommunistischer Doppelstaat? 118 Folgsame Werkzeuge der Partei 125 3 Klassenjustiz und Staatsverbrechen 131 Die Kulturrevolution 133 Justiz und Rechtsprechungspraxis 138 Massengewalt in der Kulturrevolution 146 Massentötungen im Südwesten 154 Institutionalisierter Terror 159 Unklare Fronten 167 Täter- und Opferkategorien im Wandel 173 4 Das politische Vermächtnis Mao Zedongs 181 Gespaltene Gesellschaft, zerrüttete Politik 184 Konsolidierung als politisches Programm 190 Trauer auf dem Tiananmen-Platz 194 Der Sturz der Viererbande 203 Organisatorische Neuausrichtung 210 Historische Gerechtigkeit als Massenkampagne 215 Wahrheit, Praxis und Machtpolitik 225 5 Ordnung aus dem Chaos schaffen 238 Dimensionen und Verfahren 239 Rehabilitierung als Gnadenakt oder revolutionäre Ermächtigung 247 Kaderpolitik und Aktengebirge 255 Wiederbelebung der Einheitsfront 265 Der Umgang mit historischen Klassenfeinden 272 Deportationen und Zwangsumsiedlungen 282 Das schwierige Erbe der Nationalitätenpolitik 291 6 Die Revision ungerechter, falscher und fehlerhafter Fälle 304 Politische Bilanz im Sicherheitsapparat 306 Modellfälle in der Justiz 312 Was ist Konterrevolution? 319 Kulturrevolutionäre Tatbestände 325 Rechtsbewusstsein und die Demokratiemauer-Bewegung 334 Die Th eoriekonferenz des Jahres 1979 343 Die Justiz und das Erbe der Kulturrevolution 354 Die Grenzen sozialistischer Gesetzlichkeit 364 7 Shanhou: Autoritäre Krisenbewältigung 370 Petitionen und Herrschaftslegitimation 376 Restitutionsforderungen und die Frage sozialistischer Eigentumsrechte 382 Gehälter, Pensionen und die Kritik des bürgerlichen Rechts 392 Soziale Fürsorge im Dienst politischer Stabilität 401 8 Fehler und Verbrechen 411 Prozessvorbereitungen 414 Die Kulturrevolution vor Gericht 421 Eine neue Perspektive auf die Vergangenheit 428 Die Herstellung eines Elitenkonsenses 434 Geschichtspolitik im Dienst der Machtpolitik 441 Die Suche nach Tätern jenseits der Parteizentrale 448 Die «drei Typen Menschen» 458 Am Scheideweg 470 Epilog: Die Illusion eines historischen Schlussstrichs 482 Die «Lösung» eines historischen Problems 485 Ein Echo aus der Tiefe der Zeit 491 Ein doppelter Schatten 497 Anhang Kurzbiographien wichtiger Akteure 507 Übersicht wichtiger Ereignisse, 1976–1989 513 Danksagung 516 Anmerkungen 518 Literaturverzeichnis 568 Bildnachweis 590 Register 591 |
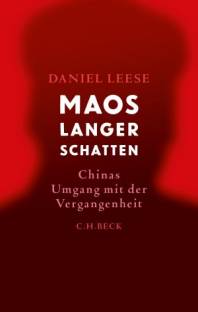
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen