|
|
|
Rezension
"Logistische Prozesse" ist ein Grundlagenbuch für Lehrende und Auszubildende in der Lagerwirtschaft. Es ist klar strukturiert, inhaltlich und gestalterisch sehr gut gegliedert. Die farblich herausgestellten Zusammenfassungen helfen dem Lernenden, den Stoff zu memorieren und in kurzer Zeit zu wiederholen.
Vielfältige Aufgaben helfen, sich den Stoff anzueignen. Viele Grafiken und Bilder erleichtern es, den Stoff zu verstehen. Bezüge zu benachbarten Fächern, z.B. Fachrechnen werden klar herausgearbeitet. Auch die theoretischen Grundlagen werden in dem Lehrbuch ausführlich und genau dargestellt. Ich habe dieses Buch (untypisch) im Rahmen eines Logistik-Informatik-Projekts mit Gymnasiasten eingesetzt, um die praktische Seite der Lagerwirtschaft und Logistik zu beleuchten. Dabei hat sich gezeigt, dass das Buch geeignet ist, die Materie auch Schülern, die zu diesen Dingen gar keinen Bezug haben näherzubringen. VPfueller, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die Reihe ist für die Ausbildungsberufe Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist gemäß neuem Lehrplan konzipiert. Berufsbezogene Einstiegssituationen und Handlungsaufträge sind schülergerecht aufgearbeitet. Die Methoden- und Sozialkompetenz wird durch vielfältige Fragetechniken und Bearbeitungsformen gefördert. Anschauliche Sachdarstellungen, Tipps und Verweise auf Paralleltitel sorgen für eine effektive Lernweise. Zusammenfassungen am Ende der Kapitel erleichtern die Lernzielsicherung. Das Lehrbuch "Logistische Prozesse" ist mit Demoversion des Beladeprogramms PUZZLE ausgestattet, und beinhaltet zusätzliche Arbeitsaufträge. * wurde umfassend aktualisiert und erweitert * inkl. Demoversion des Beladeprogramms PUZZLE mit zugehörigen Arbeitsaufträgen als BuchPlusWeb * Lösungen sind separat auf CD-ROM erhältlich (Bestell-Nr. 03609A) Inhaltsverzeichnis
Lernfeld 1 Güter annehmen und kontrollieren 15
1 Warenannahme 15 1.1 Wege der Warenanlieferung 16 1.2 Kontrolle in Anwesenheit des Überbringers 16 1.3 Untersuchungs- und Anzeigepflichten 18 1.4 Wareneingangsschein 19 1.5 Codiertechniken 21 1.6 Warenprüfung 23 1.7 Mehrweg-Transportverpackungen 24 2 Unfallgefahr 30 2.1 Vorschriftarten zum Arbeitsschutz 30 2.2 Unfallverhütungsvorschriften 30 2.3 Verhalten bei Unfällen 34 Lernfeld 2 Güter lagern 38 1 Lager planen 38 1.1 Aufgaben des Lagers 38 1.2 Lagerarten 40 1.2.1 Unterscheidung nach den Güterarten 40 1.2.2 Unterscheidung nach den Betriebsarten 41 1.2.2.1 Industriebetrieb 41 1.2.2.2 Großhandel 42 1.2.2.3 Einzelhandel 42 1.2.3 Unterscheidung nach dem Lagerstandort 43 1.2.3.1 Vorgaben bei der Standortwahl 43 1.2.3.2 Zentrale Lager oder dezentrale Lager bei der Beschaffung 43 1.2.3.3 Zentrale Lager oder dezentrale Lager beim Absatz 44 1.2.3.4 Handlager 45 1.2.4 Unterscheidung nach der Bauweise 45 1.2.4.1 Freilager 45 1.2.4.2 Bunker-/Silo-Tanklager 45 1.2.4.3 Geschlossene Lager 46 1.2.4.4 Flachlager 46 1.2.4.5 Etagenlager 47 1.2.4.6 Hochregallager 47 1.2.4.7 Traglufthallenlager 47 1.2.4.8 Speziallager 47 1.2.5 Unterscheidung nach dem Eigentümer 48 1.2.5.1 Eigenlagerung - Fremdlagerung 48 1.2.5.2 Gesetzliche Grundlagen 49 1.2.5.3 Kostenvergleich Eigenlagerung - Fremdlagerung 51 2 Lagertechnik 56 2.1 Bodenlagerung ohne Lagergerät 57 2.2 Bodenlagerung mit Lagergerät 57 2.3 Blocklagerung oder Reihenlagerung 58 2.4 Sicherheitsvorschriften bei der Bodenlagerung 59 3 Lager einrichten 63 3.1 Regale als Lagereinrichtungen 63 3.1.1 Fachbodenregale 64 3.1.2 Palettenregale 65 3.1.3 Einfahrregale 66 3.1.4 Durchlaufregale 66 3.1.5 Kragarmregale 68 3.1.6 Wabenregale/Kassettenregale 68 3.1.7 Verschieberegale 69 3.1.8 Umlaufregale 70 3.1.9 Turmregale 71 3.1.10 Einschubregale 72 3.1.11 Kanalregale (Tunnellager) 73 3.1.12 Automatisches Behälterregal 74 3.1.13 Hochregallager 75 3.1.14 Lagerung auf Stetigförderern 77 3.2 Lageraufbau nach dem Materialfluss 80 4 Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Lagerung 82 4.1 Sauberkeit 82 4.2 Geräumigkeit 83 4.3 Übersichtlichkeit 83 5 Arbeiten bei der Einlagerung 86 5.1 Vorverpackung und Portionierung 86 5.2 Komplettierung 87 5.3 Preisauszeichnung 87 5.4 Buchung der Einlagerung 88 5.5 Güterart und Lagerplatz 88 5.6 Einlagerungsgrundsätze 90 5.7 Starre Einlagerung 90 5.8 Flexible Einlagerung 91 6 Gefahren im Lager 95 6.1 Gefahrenarten und ihre Folgen 95 6.2 Gesetze und Verordnungen zum Arbeitsschutz und Umweltschutz 96 6.2.1 Arbeitsschutzgesetz 96 6.2.2 Betriebssicherheitsverordnung 99 6.2.3 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz) 99 6.2.4 Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 100 6.2.5 Arbeitsstättenverordnung 102 6.2.6 Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz) 104 6.2.7 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung) 105 6.2.8 GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) 110 6.2.9 Flammpunktgrenzen für brennbare Flüssigkeiten 113 6.2.10 Wasserhaushaltsgesetz 114 6.2.11 RAL-Druckschriften 115 6.2.12 Berufsgenossenschaftliche Regeln 115 6.2.13 Sicherheit beim Lagern und Stapeln nach den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 117 6 Inhaltsverzeichnis 6.3 Brandgefahr 118 6.4 Diebstahlgefahr 124 7 Produktivitätskennzahlen eines Lagers 129 Lernfeld 3 Güter bearbeiten 132 1 Arbeitsmittel im Lager 132 2 Güterpflege 136 2.1 Qualitative Schäden bei der Lagerung 136 2.2 Pflegemaßnahmen 137 3 Inventur 139 3.1 Qualitative und quantitative Kontrollen 139 3.2 Begriffserklärung 140 3.3 Stichtagsinventur 140 3.4 Permanente Inventur 141 3.5 Verlegte Inventur 142 3.6 Stichprobeninventur 143 4 Wirtschaftlichkeit im Lager 145 4.1 Lagerkosten 145 4.2 Lagerkennziffern 146 4.2.1 Bestandsarten 146 4.2.2 Lagerumschlag (Umschlagshäufigkeit, Umschlagsgeschwindigkeit) 147 4.2.3 Durchschnittliche Lagerdauer 149 4.2.4 Lagerzinsen 149 4.2.5 Lagerreichweite 150 Lernfeld 4 Güter im Betrieb transportieren 153 1 Förderhilfsmittel und Fördermittel 153 1.1 Innerbetrieblicher Materialfluss 153 1.1.1 Materialflussarten 153 1.1.2 Gestaltung des Materialflusses 154 1.1.3 Ziele des Materialflusses 155 1.2 Förderhilfsmittel 155 1.3 Fördermittel 157 1.3.1 Stetigförderer 157 1.3.1.1 Flurfreie Stetigförderer 158 1.3.1.2 Flurgebundene Stetigförderer 159 1.3.2 Unstetigförderer 160 1.3.2.1 Hebezeuge 161 1.3.2.2 Flurförderzeuge 162 1.3.2.3 Regalbediengeräte 169 2 Gefahren beim Transport 175 2.1 Organisation des Arbeitsschutzes 175 2.1.1 Innerbetriebliche Organisation des Arbeitsschutzes 175 2.1.2 Überbetriebliche Organisation des Arbeitsschutzes 178 2.2 Vorschriften zum Arbeitsschutz beim Transport 179 2.2.1 Unfallverhütungsvorschriften für den Transport 179 2.2.2 Gesundheitsschutz beim Heben und Tragen 179 2.2.2.1 Grundregeln 179 2.2.2.2 Zumutbare Lasten 181 2.2.3 Unfallverhütung beim Einsatz von Flurförderzeugen 181 2.2.3.1 Unfallursachen 181 2.2.3.2 Arbeitssichernde Maßnahmen beim Umgang mit Flurförderzeugen 182 2.2.4 Unfallverhütung beim Einsatz von Kranen 185 Lernfeld 5 Güter kommissionieren 190 1 Systematik der Kommissionierung 190 1.1 Gründe für Güterausgänge 190 1.2 Grundlagen der Kommissionierung 191 1.2.1 Informationssystem 191 1.2.2 Materialflusssystem 194 1.2.2.1 Bereitstellung 194 1.2.2.2 Fortbewegung 196 1.2.2.3 Entnahme 196 1.2.2.4 Abgabe 198 1.2.3 Organisationssystem 198 1.3 Kommissioniermethoden 199 1.3.1 Auftragsorientierte, serielle Kommissionierung 200 1.3.2 Auftragsorientierte, parallele Kommissionierung 201 1.3.3 Serienorientierte, parallele Kommissionierung 202 1.4 Beleglose Kommissionierung 203 2 Kommissionierzeiten und -leistung 209 2.1 Kommissionierzeiten 209 2.2 Kennzahlen zur Ermittlung der Kommissionierleistung 212 2.3 Beurteilung der Kommissionierleistung 214 2.4 Praktische Beispiele für Kommissionierlösungen 215 2.4.1 Kommissionierfahrzeuge 215 2.4.2 Lösungsmöglichkeiten bei unterschiedlicher Regaltechnik 215 Lernfeld 6 Güter verpacken 219 1 Allgemeines über Verpackungen 219 1.1 Grundbegriffe im Verpackungsbereich 219 1.2 Bedeutung der Verpackung 221 1.3 Funktionen (Aufgaben) der Verpackung 221 1.3.1 Schutzfunktion 222 1.3.2 Lagerfunktion 223 1.3.3 Lade- und Transportfunktion 223 1.3.4 Verkaufsfunktion 224 1.3.5 Informationsfunktion 225 1.4 Beanspruchungen der Verpackung 226 1.4.1 Mechanische Beanspruchung 226 1.4.2 Klimatische Beanspruchung 229 1.4.3 Beanspruchung durch Lebewesen 230 1.4.4 Beanspruchung durch Diebstahlgefahr 230 1.5 Vorsichtsmarkierungen auf Verpackungen 231 1.5.1 Bestandteile einer vollständigen Markierung 231 1.5.2 Handhabungsanweisungen in Textform 231 1.5.3 Bildzeichen 232 2 Packmittel 237 2.1 Übersicht über die Packmittel 237 2.1.1 Grundsätzliche Arten 237 2.1.2 Packmittel nach Art des verwendeten Materials 237 2.2 Packmittel aus Holz 238 2.2.1 Holzkiste (allgemein) 238 2.2.2 Geschlossene Holzkisten 238 2.2.3 Steige, Harass 239 2.2.4 Zusammenlegbare Holzkiste 239 2.2.5 Holz-Aufsetzrahmen 240 2.2.6 Verschlag 240 2.2.7 Kantholzkonstruktion 240 2.2.8 Holzpackmittel für den außereuropäischen Export 241 2.3 Packmittel aus Karton/Pappe 241 2.3.1 Abgrenzung der Begriffe 241 2.3.2 Wellpappe 242 2.3.3 Schachtel 243 2.3.4 Unterfahrbare Wellpappe-Boxen/Wellpappe-Kisten 244 2.3.5 Fixierverpackung 245 2.3.6 Vorteile der Packmittel aus Karton/Pappe 245 2.4 Packmittel aus Metall oder Kunststoff 246 2.4.1 Stapelbare Behälter 246 2.4.2 Eurobehälter, Euroboxen 247 2.4.3 Falt- und klappbare Behälter 247 2.4.4 Nestbare (schachtelbare) Behälter 248 2.4.5 Vorteile der Packmittel aus Kunststoff/Metall 248 2.4.6 Collico 248 2.4.7 Besondere Verpackungen aus Kunststoff 249 2.5 Paletten 250 2.5.1 Allgemeines 250 2.5.2 Flachpalette 250 2.5.3 Gitterboxpalette (Gitterbox) 254 2.5.4 Sonstige Paletten mit Aufbauten 256 2.5.5 Tray (Tablar, Schale) 256 2.5.6 Vorteile der Palette 257 2.6 Frachtcontainer (Großbehälter) 258 2.6.1 Containerarten (Übersicht) 258 2.6.2 Containermaß 258 2.6.3 Übersee- und Binnencontainer 259 2.6.4 Containertypen nach Bauweise 261 2.7 Sonstige Packmittel 262 2.7.1 Containersack (Big Bag) 262 2.7.2 Rollbehälter/Rollboxen 263 2.7.3 Weitere Packmittel 263 3 Packhilfsmittel 266 3.1 Allgemeines und Übersicht 266 3.2 Schutzmittel und Füllmittel 267 3.2.1 Schutzmittel gegen mechanische Beanspruchungen 267 3.2.2 Schutzmittel gegen Feuchtigkeit/Nässe 270 3.2.3 Schutzmittel gegen Diebstahl und unbefugtes Öffnen 272 3.3 Verschließmittel 273 3.4 Kennzeichnungsmittel 274 3.4.1 Etiketten 274 3.4.2 Indikatoren 275 3.4.3 Begleitpapiertaschen 276 4 Verpackungen für gefährliche Güter 279 4.1 Grundlagen 279 4.1.1 Gefahrgut und Gefahrstoff 279 4.1.2 Allgemeine Bestimmungen zur Kennzeichnung und Verpackung 279 4.2 Einteilung der Gefahrgüter (nach Gefahrgutbeförderungsgesetz) 280 4.2.1 Klassifizierung 280 4.2.2 Kennzeichnung von gefährlichen Gütern (Gefahrgutzettel) 281 4.3 Packmittel für Gefahrgut 282 4.3.1 Verpackungsgruppen 282 4.3.2 Zulassung von Packmitteln 282 4.3.3 Packmittelarten 283 4.4 Pflichten beim Verpacken und Kennzeichnen von Gefahrgütern 284 5 Tätigkeiten beim Verpacken 286 5.1 Grundprinzip des Verpackungsvorgangs 286 5.2 Technische Hilfsmittel 286 5.2.1 Packtisch 286 5.2.2 Geräte 287 5.2.3 Maschinen 288 5.3 Tätigkeiten beim Verpacken 289 5.3.1 Ablauf 289 5.3.2 Sperrgut und Schwergut 289 6 Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Verpackungen 291 6.1 Rechtliche Grundlagen 291 6.2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 292 6.2.1 Zielsetzungen des Gesetzes 292 6.2.2 Abfallverwertung und -beseitigung 292 6.3 Verpackungsverordnung (VerpackV) 293 6.3.1 Zielsetzungen und Anwendungsbereich 293 6.3.2 Verpackungsbegriffe der VerpackV 293 6.3.3 Rücknahmepflichten 294 6.4 Entsorgung von Verpackungen 295 6.4.1 Duales System Deutschland (DSD) 295 6.4.2 Grüner Punkt 296 6.4.3 DSD # Ausbreitung und Wettbewerb 296 6.4.4 Ökonomie und Ökologie bei der Entsorgung von Verpackungen 296 7 Kosten der Verpackung 299 7.1 Gesetzliche und vertragliche Regelungen 299 7.1.1 Gesetzliche Regelung der Verpackungskosten 299 7.1.2 Vertragliche Regelungen über Verpackungskosten 300 7.2 Verpackungskosten 300 7.2.1 Kostenarten 300 7.2.2 Relative Höhe der Verpackungskosten 301 Lernfeld 7 Touren planen 303 1 Unternehmen als nationale und internationale Handelspartner 303 2 Bedeutende Wirtschaftszentren in Deutschland, in Europa und in der Welt 305 2.1 Bedeutende Wirtschaftszentren in Deutschland 305 2.2 Wirtschaft in Europa (Auswahl) 309 2.3 Wirtschaftszentren weltweit (Auswahl) 310 3 Verkehrswege innerhalb der Wirtschaftszentren 312 3.1 Verkehrswege innerhalb Europas 312 3.2 Verkehrswege außerhalb Europas (Auswahl) 313 4 Kriterien für die Wahl der Verkehrsmittel 316 5 Tourenplanung 320 5.1 Notwendigkeit einer Tourenplanung 321 5.2 Manuelle Tourenplanung 322 5.3 Tourenplanung und Tourenabwicklung per EDV 322 Lernfeld 8 Güter verladen 325 1 Verladung von Gütern 325 1.1 Verladeeinrichtungen 325 1.2 Rechtliche Grundlagen zur Verladung und zur Ladungssicherung 327 1.3 Physikalische Grundlagen der Ladungssicherung 328 1.3.1 Gewichtskraft FG 329 1.3.2 Massenkraft FM 329 1.3.3 Reibungskraft 331 1.3.4 Sicherungskraft FS 332 1.4 Arten der Ladungssicherung 334 1.4.1 Kraftschlüssige Ladungssicherung 335 1.4.2 Formschlüssige Ladungssicherung 337 1.4.2.1 Lückenlose Verstauung 337 1.4.2.2 Direktzurren 339 1.4.2.3 Kombinierte Ladungssicherung 340 1.4.3 Kippgefahr 341 1.4.4 Richtige Lastverteilung 342 1.5 Mittel zur Ladungssicherung 343 1.5.1 Zurrpunkte an den Fahrzeugen 344 1.5.2 Zurrmittel 344 1.5.2.1 Zurrgurte 344 1.5.2.2 Zurrketten 345 1.5.2.3 Zurrdrahtseile 345 1.5.3 Sonstige Hilfsmittel 346 1.6 Ablauf der Beladung von Verkehrsträgern 347 1.6.1 Erstellen eines Stauplans 347 1.6.2 Anforderungen an das Ladegut 348 1.6.3 Container-Check 349 1.6.4 Grundregeln beim Stauen der Ladung 349 1.6.5 Ladungssicherung beim Container 350 2 Verladung von Gefahrgut 356 2.1 Gesetzliche Regelungen 356 2.1.1 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 356 2.1.2 Gefahrgutbeauftragtenverordnung 356 2.1.3 Verordnungen zur Gefahrgutbeförderung 358 2.2 Ablauf eines Gefahrguttransportes 359 2.2.1 Feststellung des Gefahrgutes und des Verkehrsträgers 359 2.2.2 Aufgaben des Verpackers 359 2.2.3 Erstellen der Begleitpapiere 359 2.2.4 Zusammenladeverbote 360 2.2.5 Schriftliche Weisungen 362 2.2.6 Kommunikation Absender # Fahrer 364 2.2.7 Kennzeichnung der Fahrzeuge und Container 364 2.2.8 Freistellungen 365 2.2.8.1 Kleinmengen-Regelung 367 2.2.8.2 Beförderung in begrenzten Mengen nach Kapitel 1.1.3.6.3 ADR 368 Lernfeld 9 Güter versenden 371 1 Der Güterverkehr in der Wirtschaft 371 1.1 Grundbegriffe der Verkehrswirtschaft 371 1.2 Arten des Versands 374 1.3 Mehrwertdienstleistungen und Kontraktlogistik 375 2 Rechtliche Grundlagen des Versands 378 2.1 Frachtrecht des Handelsgesetzbuches # Frachtgeschäft 378 2.1.1 Das Frachtgeschäft nach HGB im Überblick 380 2.2 Beförderung von Umzugsgut # Umzugsvertrag §451 386 2.3 Speditionsrecht des Handelsgesetzbuches # Speditionsgeschäft 388 3 Verkehrsträger im Güterverkehr 393 3.1 Güterkraftverkehr 393 3.1.1 Straßenverkehrsnetze in Deutschland 394 3.1.2 Vorteile und Nachteile des Güterkraftverkehrs 394 3.1.3 Lkw-Maut 394 3.1.4 Fahrzeugarten 395 3.1.5 Inhalt des Güterkraftverkehrsgesetzes 397 3.1.5.1 Werkverkehr 398 3.1.5.2 Erlaubnispflicht für den gewerblichen Güterkraftverkehr im Inland 398 3.1.5.3 Grenzüberschreitender gewerblicher Güterkraftverkehr 399 3.1.6 Begleitpapiere im Güterkraftverkehr 401 3.1.7 Güterschaden-Haftpflichtversicherung 402 3.1.8 Sozialvorschriften im Straßenverkehr 402 3.1.9 Informations- und Kommunikationstechnologien im Güterkraftverkehr 403 3.1.10 Bundesamt für Güterverkehr 405 3.2 Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) 409 3.2.1 Bedeutung der KEP-Dienste in der Wirtschaft 409 3.2.2 Service-Bereiche des KEP-Markts 409 3.2.3 Anbieter von KEP-Diensten 410 3.2.4 Vorteile der KEP-Dienste 411 3.2.5 Arbeitsweise eines Expressfrachtsystems 412 3.2.6 Logistikdienste bei E-Commerce 413 3.2.7 Belegloser Sendungseingang mittels Transponder 414 3.3 Deutsche Post DHL 416 3.3.1 Das Unternehmen Deutsche Post 416 3.3.2 Der Paket- und Expressdienst 417 3.3.3 Angebote für Geschäftskunden 423 3.3.4 Ausschluss von der Paketbeförderung 426 3.3.5 Briefsendungen 426 3.4 Schienengebundener Güterverkehr 428 3.4.1 Vorteile und Nachteile des Schienengüterverkehrs 428 3.4.2 DB Tansport und Logistik 429 3.4.3 Fuhrpark 430 3.4.4 Leistungsangebote im schienengebundenen Güterverkehr 432 3.4.4.1 Einzelwagenverkehr 432 3.4.4.2 Ganzzugverkehr 434 3.4.4.3 Kombinierter Verkehr (KV) 435 3.4.4.4 Trassenvermietung der Deutschen Bahn AG 436 3.4.5. Auftragsabwicklung bei der DB 438 3.4.6 Der Frachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG 439 3.4.6.1 Frachtdokumente 439 3.4.6.2 Beförderungspflicht 441 3.4.6.3 Rechte und Pflichten des Absenders aus dem CIM-Frachtvertrag 441 3.5 Schifffahrt 443 3.5.1 Binnenschifffahrt 444 3.5.2 Seeschifffahrt 449 3.6 Luftfrachtverkehr 458 3.6.1 IATA 458 3.6.2 Flughäfen 460 3.6.3 Beförderung 460 3.6.4 Luftfrachtbrief (Air Waybill) 461 3.6.5 Luftfrachttarif (Cargo Tariff) 462 3.6.6 Zusatzleistungen der Fluggesellschaften 463 3.6.7 Frachtberechnung 463 3.6.8 Beförderungsbeschränkungen 464 3.6.9 Nachträgliche Verfügung 465 3.6.10 Chartergeschäft 465 3.6.11 Haftung des Frachtführers 467 4 Internationaler Versand 468 4.1 Begriffe zum Zollgebiet 468 4.2 Zollarten 469 4.2.1 Wertzoll 469 4.2.2 Präferenzzoll 469 4.3 Zollabfertigung 469 4.3.1 Zollanmeldung (Einheitspapier) 470 4.3.2 Zollbeschau 472 4.3.3 Nämlichkeitssicherung 473 4.3.4 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 473 4.4 Ausfuhrbeschränkungen und Ausfuhrverbote 473 4.4.1 Genehmigungspflicht 473 4.4.2 Ausfuhrverbot 474 4.4.3 Erhebung der Außenhandelsstatistik 474 4.5 Dokumente im internationalen Versand 474 4.6 Carnet-TIR-Verfahren 476 Lernfeld 10 Logistische Prozesse optimieren 478 1 Logistik 478 1.1 Der Begriff Logistik 478 1.2 Aufgaben der Logistik 479 1.3 Logistische Einsatzbereiche im Unternehmen 482 1.4 Ziele der Logistik 482 1.5 Einbindung der Logistik in die Unternehmensorganisation 483 2 Optimierung logistischer Prozesse 487 2.1 Lean Management 488 2.2 Kaizen-Prinzip 489 2.3 Total Quality Management (TQM) 489 2.4 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 490 2.5 Warehouse Management (WMS) 491 2.6 Supply Chain Management (SCM) 492 2.7 Die ABC-Analyse 494 Lernfeld 11 Güter beschaffen 498 1 Bedarfsplanung 498 1.1 Was soll eingekauft werden? 499 1.1.1 Verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung 499 1.1.2 Programmgesteuerte Bedarfsermittlung 499 1.1.3 Eigenherstellung oder Fremdbezug 500 1.2 Wie viel soll eingekauft werden? 501 1.2.1 Ermittlung der Bestellmenge 501 1.2.2 Bestellmenge zu hoch 501 1.2.3 Bestellmenge zu niedrig 501 1.2.4 Optimale (bestmögliche) Bestellmenge 502 1.3 Wann soll eingekauft werden? 503 1.3.1 Das Bestellpunktverfahren (Meldebestand) 503 1.3.2 Das Bestellrhythmusverfahren 505 1.3.3 Das Kanban-System 505 1.3.4 Das „Just-in-time“-Verfahren 506 2 Wareneinkauf 510 2.1 Wo soll eingekauft werden? 510 2.1.1E DV-gesteuerte Warenwirtschafts- und Informationssysteme 510 2.1.2 Bezugsquellendatei 511 2.1.3 Bezugsquellenermittlung 511 2.2 Anfrage 511 2.3 Angebot 511 2.3.1 Wesen und Inhalte des Angebots 511 2.3.2 Angebotsvergleich 514 2.4 Bestellung 516 2.4.1 Rechtliche Wirkung der Bestellung 516 2.4.2 Form der Bestellung 516 2.4.3 E-Producement 516 2.5 Auftragsbestätigung (Bestellungsannahme) 517 Bildquellenverzeichnis 520 Literaturverzeichnis 523 |
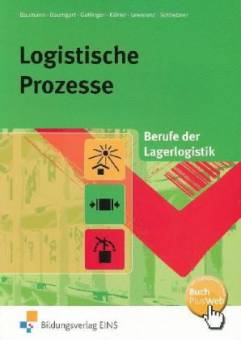
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen