|
|
|
Umschlagtext
Rasche, gründliche und manchmal überraschende Auskünfte zu den Festen und Bräuchen des Jahres. Wer weiß schon, warum der Osterhase bekannter geworden ist als das Osterlamm? Woher kommt eigentlich der Nikolaus, und ist er auch der Weihnachtsmann? Warum muss man am 1. April Haumichblau, Augenmaß oder Gewichte für eine Wasserwaage besorgen? Rund 3.000 Stichwörter aus dem deutschen Sprachgebiet bieten von »Arbor Jesse« bis »Zwölf Zwiebelschalen« umfassende Informationen mit vielen Tipps und Hintergründen zum vielfaltigen Brauchtum im Jahreskreis.
MANFRED BECKER-HUBERTI, Jahrgang 1945, Dr. theol., Studium der Theologie, Germanistik und Publizistik; 1974-1984 Lehrtätigkeit an Schulen und Hochschulen, seit 1991 Leiter des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Pressesprecher der Erzdiözese Köln. Bei Herder erschien sein Buch: »Feiern - Feste -Jahreszeiten. Lebendige Bräuche im ganzen Jahr. Geschichte und Geschichten, Bilder und Legenden« (1998) Inhaltsverzeichnis
Vorwort:
Lebendige Bräuche im Jahreskreis - geerdeter Himmel und verhimmlichte Erde Wer dicht neben einem Kirchturm steht, sich an ihn lehnt, der erkennt Details in einem kleinen Ausschnitt in aller Deutlichkeit. Der Gesamtblick, der Überblick aber bleibt in der Regel verwehrt. Werden gleichen Kirchturm aus der Ferne erspäht, hat große Mühe, ihn von anderen Türmen und Gebäuden zu unterscheiden. Benennen und beschreiben können wird er ihn wohl eher nur in Ausnahmefallen. Nähe und Distanz geben unterschiedliche Perspektiven. Die richtige Nähe und die richtige Distanz zum richtigen Zeitpunkt - sie garantieren eine Gesamtschau, die zu einem Verständnis führt, wenn die zum Sinnverstehen nötigen Zusammenhänge bekannt sind. Wem das »Me-mento mori« der Kapuziner kein Begriffist, der hält die Leichen in den Kapuzinergrüften eher für eine antiquierte kirchliche Gruselshow. Wem Heilige fremd und Patrone suspekt erscheinen, wird mit Namenstag, Taufnamen und Patenschaft wenig anfangen können. Als Pressesprecher eines großen Bistums lebe ich in der Kirche, bin Teil von ihr. Täglich höre und lese ich die Meinungen derer, die aus großer, manchmal unüberbrückbar erscheinender Distanz Fragen an diese Kirche haben. Mein Auftrag ist es, ihnen beim Verstehen zu helfen: auf der Sachebene und der Meta-Ebene, durch Information und Herstellen einer Beziehung. Täglich durchwandere ich vielmals die Strecke zwischen Nähe und Distanz und weiß deshalb um das weit verbreitete Nichtwissen von Details, Zusammenhängen und Gesamtschauen. Die berufliche Erfahrung und mein langjähriges Interesse an religiösem Brauchtum haben mich veranlasst, die Fragen und Antworten zu sammeln, zu ergänzen und zu systematisieren, um sie interessierten Menschen zugänglich zu machen, die die Suche nach Antworten auf ihre Fragen noch nicht aufgegeben haben. Religiöse Bräuche verwurzeln den Glauben im Alltag und feiern ihn. Wie Liturgie durch Riten und Rituale dem Glauben in der Kirche (als heiligem, gottgeweihten Ort, lat.: fanum) Gestalt verleiht, so geschieht Ähnliches außerhalb der Kirche (lat.: profanum) durch das Brauchtum. Die enge Verbindung zwischen fanum und profanum lässt sich noch bei einigen Bräuchen nachweisen: Martinsfeuer, Martinslampe und Martinszug haben ebenso liturgische Vorbilder wie der sprichwörtliche Zachäus der Kirmes (im Evangelium des Kirchweihsonntags) oder der Narr der »fünften Jahreszeit« und seine Schellen (im Evangelium des Fastnachtssonntags). Warum soll jemand Karneval feiern, dem die Fastenzeit und Ostern nichts bedeuten? Welchen tieferen Sinn findet jemand im Schenken zu Weihnachten, der nicht begriffen hat, dass es nicht um materiellen Erwerb geht, sondern um die Vergegenwärtigung des himmlischen Jerusalem? Warum soll man mit einer selbst gebastelten Fackel hinter einem Sankt Martin auf dem Pferde herziehen und anschließend heischen (gripschen, schnörzen, betteln ...), wenn man Teilen nicht als christliche Grundhaltung verstanden hat? Natürlich kann man das alles auch tun, ohne verstanden zu haben, was man tut, ohne zu akzeptieren, welche Ideen dahinterstehen. Der Reiz des Nachvollzugs ist aber schnell verloren, wenn der Sinn nicht mehr verstanden wird. Die Welt braucht Bräuche. Bräuche bilden und stärken eine Gemeinschaft, vereinen zu gemeinsamen Tun. Religiöse Bräuche tragen Sinn in den Alltag, machen Glauben bräuchlich. Jahrzehntelang schienen sie verschollen, eingegraben in einer Festung, zu der es keinen Zugang gab, weil Aufklärung und wechselnde Ideologien bis zum kritischen 68er-Bewusstsein wie ein breiter Festungsgraben das Symboldenken isolierten. Inzwischen regen sich wieder Neugier und Interesse. Eine neue Generation ist herangewachsen, die mit ihren Fragen bei den »Hinterbliebenen« der 68er-Generation sich nicht immer gut bedient fühlt. Das Grafitto aus den yoern »Es muss mehr als alles geben« darf in einer saturierten Gesellschaft wieder ausgesprochen werden. »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein« haben die Alten schon gewusst. Bräuche sind wieder »in«. Manch einer sucht nach den Quellen bräuchlichen Tuns, will wis- sen, was er da eigentlich tut und warum es so geschieht, wie es geschieht. Warum verschenken wir »Weckmänner«? Woher kommt eigentlich der Osterhase? Woher die nicht seltenen Aversionen gegen den Weihnachtsmann? Dieses Buch bietet sich als Brückenschlag an zwischen Fragen und Antworten, die sich in einer schier unüberschaubaren Fülle von Literatur, vielfach älteren und vergriffenen Büchern und Aufsätzen, aber auch in neuerer Fachliteratur finden. Der Autor hat nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, was ihm wissenswert erscheint, was immer wieder gefragt wird. Wer noch tiefer einsteigen möchte in die Welt des Brauchtums, findet aus gewählte Literaturhinweise am Ende des Buches. Der Leser ist eingeladen zu verstehen, wo durch Bräuche und Feste der Himmel geerdet und die Erde verhimmlicht werden. Ich möchte allen danken, die durch Fragen und Antworten, Forschungen und Veröffentlichungen, Hinweise und Hilfen zu diesem Buch beigetragen haben. Spezieller Dank gebührt Herrn Ludger Hohn-Morisch, der als Verlagslektor auch dieses Buch sachkundig und hilfreich begleitet hat. Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Frau Käthe, die - nicht immer ohne stille Seufzer -wieder einmal die Entstehung eines Buches erlebt hat und dabei ertragen musste, dass ihr Mann seine karge Freizeit zu großen Teilen im Dialog mit einem Computer statt mit ihr verbrachte. Dank auch meinen Kindern Susanne und Christian, die durch kritische Rückfragen, manche inhaltliche Verbesserung durchsetzten. Epiphanie und Fest der Heiligen Drei Könige im Jahr 2000 Manfred Becker-Huberti |
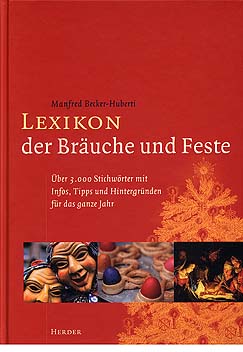
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen