|
|
|
Rezension
Der Rubenbauer-Hofmann ist jedem Lateiner ein Begriff ... In 12. Aufl. vorliegend, auf der Grundlage von Rubenbauer-Hofmann für das Universitätsstudium bearbeitet von Rolf Heine, ist es ein
geschätztes und erfolgreiches Werk für den akademischen Unterricht im Universitätsstudium der Altphilologie und als Handbuch für den Lehrer am Gymnasium. Rubenbauer und Hofmann haben mit ihrer Grammatik der Lateinischen Sprache das Standard-Werk für den Lateinunterricht an Universitäten geschrieben. - Diese Grammatik ist klar in Abschnitte der Wortlehre und der weiterführenden Syntax sowie einen umfangreichen Anhang gegliedert. Auch die weitere Binnengliederung ist nachvollziehbar und sinnvoll. Der Wortlehre-Apparat enthält zahlreiche gute, übersichtlich gestaltete Tabellen, die sich hervorragend zum Lernen eignen. Jedes grammatische Phänomen wird mit zahlreichen Beispielen aus der klassichen Literatur erläutert. Gerade deshalb aber ist der Rubenbauer-Hofmann als Schul-Grammatik zu kompliziert, weil die gewählten Beispieltexte nicht selten eine Überforderung darstellen. Als Standard-Werk für das Studium der klassichen Philologie ist es aber auch wegen seiner übersichtlichen Struktur und Handlichkeit zu empfehlen und in der Lehrerhand ist es unabdingbar Die Grammatik enthält einen ausgezeichneten Index in drei Teilen: Bezeichnung von grammatischen Phänomenen, lateinische Worte mit ihren Konstruktionen und ein Stammformen-Register. So kann alles schnell und sicher aufgefunden werden. Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Auf der Grundlage von Rubenbauer-Hofmann für das Universitätsstudium bearbeitet von Rolf Heine. Der Rubenbauer-Hofmann ist jedem Altphilologen ein Begriff als geschätztes Werk für den akademischen Unterricht und als Handbuch für den Lehrer am Gymnasium. Rolf Heine hat die Grammatik neu bearbeitet. Beteiligte Verlage: J. Lindauer Verlag (Schaefer), München, und Oldenbourg Schulbuchverlag, München Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Neubearbeitung X
Vorwort zur 10. Auflage XII Einleitung: Zur Geschichte der lateinischen Sprache 1 Vorbemerkungen A. Die lateinische Schrift (§§ 1-3) . 4 B. Aussprache und Betonung (§§ 4 - 5) 6 LAUTLEHRE Einteilung der Laute (§ 6) 8 I. Vokale (§§7-11) 9 A. Der Ablaut (§ 7) 9 B. Veränderungen des ererbten Vokalstandes im Lat. (Grch.) u. Dt. (§ 8) 10 C. Besonderheiten des lat. Vokalwandels (§§ 9-11) 11 II. Konsonanten (§§ 12-14) 13 A. Entsprechungen zwischen Lat. (Grch.) u. Dt. (§ 12) 13 B. Lateinischer Konsonantenwandel (§§ 13 - 14) 14 Schlußbemerkung (§ 15) 15 WORTBILDUNGSLEHRE Vorbemerkungen (§ 16) 17 I. Wortbildung durch Ableitung (§§ 17-18) 18 A. Form der Ableitung (§ 17) 18 B. Bedeutungsgruppen (§ 18) 19 II. Wortbildung durch Zusammensetzung (§19) 21 FORMENLEHRE Die Wortarten (§20) 23 Erster Teil: Das Nomen I. Substantiv und Adjektiv (§§ 21 -49) 23 A. Genus, Kasus und Numerus (§§ 21-23) 23 B. Die Deklinationen (§§ 24-45) 28 1. Vorbemerkungen (§§ 24 - 25) 28 2. Die ä-(l.) Deklination (§§ 6-27) 30 3. Die o-(2.) Deklination (§§ 8-30) 31 4. Adjektive der o-und a-Deklination (§§ 31 - 32) 33 5. Die e-(5.) Deklination (§§ 33-34) 34 6. Die u- (4.) Deklination (§§ 35-36) 35 7. Die 3. Deklination (§§ 37-44) 36 a) Substantive (§§ 37-42) 36 b) Adjektive (§§43-44) 42 8. Griechische Deklination (§ 45) 45 C. Komparation (§§ 46-49) 45 Anhang: Adverbia(§§ 50-52) 49 II. Pronomina (§§ 53-60) 52 A. Personalpronomina (§ 54) 53 B. Possessivpronomina (§ 55) 53 C. Demonstrativpronomina (§ 56) 54 D. Relativpronomina (§ 57) 55 E. Interrogativpronomina (§ 58) 56 F. Indefinitpronomina (§ 59) 56 G. Korrelativpronomina (§ 60) 58 Anhang: Pronominaladjektive und-adverbia(§§ 61 - 62) 58 III. Numeralia(§§63-68) 60 Zweiter Teil: Das Verbum I. Das verbum finitum und infinitum (§§ 69 - 70) 64 II. Die Formenbildung des Verbums (§§ 71 - 78) 65 III. Die vier lat. Konjugationen (§§ 79-95) 72 A. Die l-(1.) Konjugation (§§ 79-81) 72 B. Die e-(2.) Konjugation (§§ 82-84) 76 C. Die l-(4.) Konjugation (§§ 85-87) 85 D. Die 3. Konjugation (§§ 88-95) 89 1. Verbaäctiva(§§ 88-93) 89 a) Konsonantische und u-Stämme(§§ 88 -90) 89 b) Verba auf -io (§§ 91-93) 101 2. Verbadepönentia(§§ 94-95) 105 3. Semidepönentia (§ 95) 107 IV. Verbaanömala(§§ 96-102) 107 V. Verba difectiva (§ 103) 113 VI. Verbaimpersönälia(§ 104) 114 Dritter Teil: Partikeln 114 SATZLEHRE Erster Teil: Lehre von den Satzgliedern Erster Abschnitt: Bestandteile des einfachen Satzes I. Subjekt und Prädikat (§§ 105-107) 115 II. Kongruenz (§ 108) 118 Zweiter Abschnitt: Ergänzungen des Satzes L Ergänzung von (nominalen) Satzgliedern durch Attribute (§§ 109 - 111) 122 II Satzergänzungen durch Kasus (§§ 112 - 156) 126 A. Akkusativ (§§ 112-122) 126 1. Akkusativ als Objektskasus (§§ 112-121) 126 a) einfacher Objektsakkusativ (§§ 112-118) 127 b) doppelter Objektsakkusativ (§§ 119-121) 133 2. Akkusativ als Zielkasus (§ 122) 137 B. Dativ (§§ 123- 129) 138 1. Dativ bei Verben (§§ 123-128) 138 2. Dativ bei Adjektiven (§ 129) 144 C. Genetiv (§§ 130-140) 145 1. Genetiv bei Substantiven (§§ 130-134) 145 2. Genetiv bei Adjektiven (§ 135) 152 3. Genetiv bei Verben (§§ 136-140) 154 D. Ablativ (§§ 141-156) 159 1. Ablativ der Trennung (§§ 141 - 144) 159 2. Ablativ als Vertreter des Instrumentalis (§§ 145- 153) 164 a) Ablativ der Gemeinschaft (§§ 145-146) 164 b) Ablativ des Mittels und Werkzeugs (§§ 147-153) 166 3. Ablativ des Ortes und der Zeit (§§ 154-156) 172 III. Satzergänzungen mit Hilfe von Präpositionen (§§ 157 - 161) 175 IV. Satzergänzungen durch Adverbien (§ 162) 186 V. Satzergänzungen durch Nominalformen des Verbums (§§ 163 - 181) 187 A. Infinitiv (§§ 164-172) 187 1. Bloßer Infinitiv (§§ 165-166) 188 2. Acl (§§ 167- 171) 191 3. Ncl (§ 172) 199 B. Supina(§ 173) 200 C. Gerundium und Gerundivum(§§ 174- 176) 202 D. Partizip (§§ 177-181) 207 1. Zeitformen des Partizips (§ 178) 208 2. Der Gebrauch des Partizips (§§ 179-180) 209 a) Attributives und prädikatives Partizip (§ 179) 210 b) Das adverbiale Part, als P.c. und im Abi. abs. (§ 180) 213 3. Zur Übersetzung lat. Partizipien (§ 181) 216 Anhang: Syntaktisch-stilistische Eigentümlichkeiten lat. Nomina (§§ 182 - 204) 218 I. Substantive (§§ 182-186) 218 II. Adjektive (§§ 187-190) 222 III. Pronomina (§§ 191-204) 226 Zweiter Teil: Lehre vom einfachen und zusammengesetzten Satz Erster Abschnitt: Der einfache Satz I. Genus, Tempus und Modus des Verbums (§§ 205 - 218) 237 A. Genera des Verbums (§§ 205-206) 237 B. Tempora, Aktionsarten und Aspekte (§§ 207-213) 239 C. Modi (§§ 214-218) 244 1. Indikativ (§ 214) 245 2. Konjunktiv (§§ 215-217) 246 3. Imperativ (§ 218) 251 II. Arten des einfachen Satzes (§§ 219-222) 252 A. Aussagesätze (§§ 219-220) 252 B. Ausrufesätze (§ 220) 254 C. Aufforderungssätze (§ 220) 254 D. Fragesätze (§§ 221-222) 254 Zweiter Abschnitt: Der zusammengesetzte Satz I. Die Satzreihe (§§ 223-225) 257 A. Unverbundene Satzreihen (und Satzteile) (§ 223) 257 B. Verbundene Satzreihen (und Satzteile) (§§ 224-225) 258 II. Das Satzgefüge (§§ 226-264) 262 A. Besonderheiten im Gebrauch der Modi und Tempora im abhängigen Satz (§§ 227-231) 264 1. Modi in Nebensätzen (§ 227) 264 2. Tempora in Nebensätzen (§§ 228-231) 265 a) Zeitgebung in indikativischen Nebensätzen (§ 228) 266 b) Zeitgebung in konjunktivischen Nebensätzen (§§ 229 - 231) 267 B. Arten der Unterordnung (§§ 232-263) 272 1. Indirekte Fragesätze (§§ 232-233) 272 2. Finalsätze (§§ 234-236) 275 3. Konsekutivsätze (§§ 237-238) 281 4. Konjunktionalsätze mit quln (§ 239) 283 5. Relativsätze (§§ 240-245) 285 6. Komparativsätze (§§ 246-248) 294 7. Kausalsätze (§§ 249-252) 298 8. Temporalsätze (§§ 253-258) 302 9. Konditionalsätze (§§ 259-262) 311 10. Konzessivsätze (§ 263) 317 C. Oratio obliqua (§ 264) 319 Anhänge I. Die wichtigsten Tropen und Figuren (§ 265) 322 II. Wortstellung und Satzbau (§§ 266-268) 325 III. Kurze Verslehre (§§ 269-274) 329 A. Prosodie (§§ 269-270) 329 B. Metrik (§§ 271-274) 331 IV. Maße, Gewichte und Münzen (§ 275) 336 V. Der römische Kalender (§ 276) 338 Register I. Sachverzeichnis 340 II. Wortverzeichnis 347 III. Verzeichnis der mit ihren Stammformen angeführten Verba 361 IV. Fundstellenverzeichnis 367 |
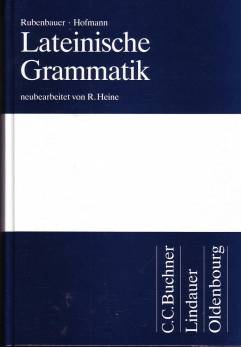
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen