|
|
|
Umschlagtext
Wer glaubt, dass die physikalische Chemie schwer zu verstehen ist, hat vielleicht nur noch nicht mit dem richtigen Lehrbuch gelernt. Komplizierte Sachverhalte einfach und anschaulich darzustellen, ist eine der herausragenden Qualitäten jedes Lehrbuchs von Peter Atkins - so auch von diesem!
Der komplette Prüfungsstoff auf Vordiplom- bzw. Bachelor-Niveau ist enthalten, die unverzichtbaren Formeln sind dabei leserfreundlich vom Haupttext abgesetzt. Zahlreiche Beispiele, Übungsaufgaben und Tests fördern das aktive Lernen und ermöglichen zu jedem Zeitpunkt eine exzellente Lernkontrolle. Darüber hinaus bieten Ergänzungen des Lernstoffs Bezüge zum täglichen Leben. So kann man die physikalisch-chemischen Konzepte anhand konkreter Anwendungen sehr leich nachvollziehen. Das ideale Buch für das Chemie-Vordiplom, für Lehramtsstudenten, Physiker, Biologen, Pharmazeuten und alle anderen Studenten mit Chemie als Nebenfach. Rezension
Dieses Buch lässt sich gut lesen, ist verständlich geschrieben und macht Zusammenhänge deutlich. Es werden nur die wichtigsten Formeln vorgestellt (also nicht hergeleitet) und anhand dieser Proportionalitäten und Abhängigkeiten verdeutlicht. Es wird also die oft abschreckende Mathematik auf ein Minimum reduziert.
Auch helfen einem die vielen Übungen nachzuvollziehen, ob man das gelesene nun wirklich verstanden hat. Dieses Buch ist für Lehramtsstudierende sowie andere "Nebenfächler" wirklich empfehlenswert, da es einen im Gegensatz zum "großen" Atkins nicht mit seinem Umfang erschlägt und den Inhalt auf das Wesentliche konzentriert. Jacqueline Weinheimer, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur dritten deutschen Auflage 0 Einführung 0.1 Die Aggregatzustände 0.2 Der physikalische Zustand 0.3 Der Druck 0.4 Die Temperatur 0.5 Die Stoffmenge Aufgaben 1 Die Eigenschaften der Gase Zustandsgleichungen 1.1 Die Zustandsgieichung des idealen Gases Exkurs 1.1 Die Gasgesetze und das Wetter 1.2 Anwendungen der Zustandsgleichung des idealen Gases 1.3 Mischungen von Gasen: Der Partialdruck Die kinetische Gastheorie 1.4 Der Druck eines Gases 1.5 Die mittlere Geschwindigkeit der Gasmoleküle 1.6 Die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung 1.7 Diffusion und Effusion 1.8 Intermolekulare Stöße Exkurs 1.2 Die Sonne als Ball aus idealem Gas Reale Gase 1.9 Intermolekulare Wechselwirkungen 1.10 Die kritische Temperatur 1.11 Der Kompressionsfaktor 1.12 Die Virialgleichung 1.13 Die van-der-Waals-Gleichung 1.14 Die Verflüssigung von Gasen Aufgaben 2 Thermodynamik: der Erste Hauptsatz Die Erhaltung der Energie 2.1 System und Umgebung 2.2 Arbeit und Wärme 2.3 Die Messung von Arbeit 2.4 Die Messung von Wärme Innere Energie und Enthalpie 2.5 Die Innere Energie 2.6 Die Enthalpie 2.7 Die Temperaturabhängigkeit der Enthalpie Aufgaben 3 Thermochemie Physikalische Umwandlungen 3.1 Die Enthalpie von Phasenübergängen 3.2 Atomare und molekulare Prozesse Chemische Reaktionen 3.3 Enthalpieänderungen bei Standardbedingungen Exkurs 3.1 Nahrung und Energiereserven 3.4 Die Kombination von Reaktionsenthalpien 3.5 Standardbildungsenthalpien 3.6 Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsenthalpie Aufgaben 4 Thermodynamik: der Zweite Hauptsatz Die Entropie 4.1 Die Richtung spontaner Prozesse 4.2 Die Entropie und der Zweite Hauptsatz 4.3 Entropieänderungen für einige typische Prozesse 4.4 Entropieänderungen in der Umgebung 4.5 Absolute Entropien und der Dritte Hauptsatz der Thermodynamik 4.6 Die Standardreaktionsentropie 4.7 Die Spontaneität chemischer Reaktionen Die Freie Enthalpie Exkurs 4.1 Der hydrophobe Effekt 4.8 Die Beschränkung auf das System 4.9 Eigenschaften der Freien Enthalpie Aufgaben 5 Phasengleichgewichte reiner Substanzen Die Thermodynamik von Phasenübergängen 5.1 Die Stabilitätsbedingung 5.2 Die Druckabhängigkeit der Freien Enthalpie 5.3 Die Temperaturabhängigkeit der Freien Enthalpie Phasendiagramme 5.4 Phasengrenzlinien 5.5 Der Verlauf von Phasengrenzlinien 5.6 Charakteristische Punkte im Phasendiagramm 5.7 Die Phasenregel 5.8 Phasendiagramme ausgewählter Substanzen Aufgaben 6 Die Eigenschaften von Mischungen Die thermodynamische Beschreibung von Mischungen 6.1 Konzentrationsmaße 6.2 Partielle molare Größen 6.3 Spontane Mischungsprozesse 6.4 Ideale Lösungen 6.5 Ideal verdünnte Lösungen Exkurs 6.1 Die Löslichkeit von Gasen und die Atmung 6.6 Reale Lösungen: Aktivitäten Kolligative Eigenschaften 6.7 Siedepunktserhöhung und Gefrierpunktserniedrigung 6.8 Osmose Exkurs 6.2 Dialyse und der Aufbau von Proteinen Phasendiagramme von Mischungen 6.9 Mischungen flüchtiger Flüssigkeiten 6.10 Flüssig/Flüssig-Phasendiagramme 6.11 Flüssig/Fest-Phasendiagramme 6.12 Ultrareinheit und kontrollierte Verunreinigung Aufgaben 7 Die Grundlagen des chemischen Gleichgewichts Thermodynamische Grundlagen 7.1 Die Freie Reaktionsenthalpie 7.2 Die Abhängigkeit der Freien Reaktionsenthalpie von der Zusammensetzung 7.3 Reaktionen im Gleichgewichtszustand 7.4 Die Freie Standardreaktionsenthalpie 7.5 Gekoppelte Reaktionen Exkurs 7.1 Anaerober und aerober Stoffwechsel 7.6 Die Zusammensetzung im Gleichgewicht Exkurs 7.2 Myoglobin und Hämoglobin Der Einfluss äußerer Bedingungen auf das Gleichgewicht 7.7 Die Gegenwart eines Katalysators 7.8 Der Einfluss der Temperatur 7.9 Der Einfluss des Drucks Aufgaben 8 Das Chemische Gleichgewicht Säure-Base-Gleichgewichte 8.1 Die Bransted-Lowry-Theorie 8.2 Protonierung und Deprotonierung 8.3 Mehrwertige Säuren 8.4 Amphotere Systeme Wässrige Salzlösungen 8.5 Säure-Base-Titrationen 8.6 Puffer 8.7 Indikatoren Lösungsgleichgewichte 8.8 Das Löslichkeitsprodukt 8.9 Der Einfluss gemeinsamer Ionen auf die Löslichkeit Aufgaben 9 Elektrochemie Die Wanderung von Ionen 9.1 Die Leitfähigkeit 9.2 Die Ionenbeweglichkeit Elektrochemische Zellen 9.3 Halbreaktionen und Elektroden 9.4 Reaktionen an Elektroden 9.5 Zelltypen Exkurs 9.1 Aktionspotenziale 9.6 Die Zellreaktion 9.7 Das Zellpotenzial 9.8 Zellen im Gleichgewicht Exkurs 9.2 Die chemiosmotische Theorie 9.9 Standardpotenziale 9.10 Die pH-Abhängigkeit des Potenzials 9.11 Die Bestimmung des pH-Werts Anwendungen von Standardpotenzialen Exkurs 9.3 Cytochrom-Kaskaden 9.12 Die elektrochemische Reihe 9.13 Die Bestimmung von thermodynamischen Funktionen Aufgaben 10 Chemische Kinetik Empirische chemische Kinetik 10.1 Experimentelle Methoden 10.2 Anwendung der Methoden Exkurs 10.1 Ultraschnelle Reaktionen: Femtosekundenchemie Reaktionsgeschwindigkeiten 10.3 Die Definition der Reaktionsgeschwindigkeit 10.4 Geschwindigkeitsgesetze und Geschwindigkeitskonstanten 10.5 Die Reaktionsordnung 10.6 Die Bestimmung des Geschwindigkeitsgesetzes 10.7 Integrierte Geschwindigkeitsgesetze 10.8 Halbwertszeiten Die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit 10.9 Die Arrhenius-Parameter 10.10 Die Stoßtheorie 10.11 Die Theorie des aktivierten Komplexes 10.12 Katalyse Aufgaben 11 Die Interpretation von Ceschwindigkeitsgesetzen Reaktionsschemata 11.1 Das Erreichen des Gleichgewichtszustands 11.2 Folgereaktionen Reaktionsmechanismen 11.3 Elementarreaktionen 11.4 Die Aufstellung von Geschwindigkeitsgesetzen 11.5 Die Näherung des stationären Zustands 11.6 Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt 11.7 Reaktionen auf Oberflächen 11.8 Unimolekulare Reaktionen Enzymreaktionen Exkurs 11.1 Katalytische Aktivität und katalytische Antikörper 11.9 Die Wirkung von Enzymen 11.10 Enzyminhibierung Kettenreaktionen 11.11 Das Prinzip der Kettenreaktion 11.12 Geschwindigkeitsgesetze von Kettenreaktionen 11.13 Explosionen Photochemische Prozesse 11.14 Die Quantenausbeute Exkurs 11.2 Photobiologie 11.15 Geschwindigkeitsgesetze photochemischer Reaktionen Aufgaben 12 Quantentheorie Das Versagen der klassischen Physik 12.1 Die Strahlung des Schwarzen Körpers 12.2 Wärmekapazitäten 12.3 Der photoelektrische Effekt 12.4 Beugung von Elektronen 12.5 Atomare und molekulare Spektren Die Dynamik mikroskopischer Systeme 12.6 Die Schrödinger-Gleichung 12.7 Die Bornsche Interpretation 12.8 Die Unschärferelation Anwendungen der Quantenmechanik 12.9 Translation: Teilchen im Kasten 12.10 Rotation: Teilchen auf einer Kreisbahn 12.11 Schwingung: der harmonische Oszillator Exkurs 12.1 Rastertunnelmikroskop Aufgaben 13 Der Aufbau der Atome Wasserstoffahnliche Atome 13.1 Die Spektren wasserstoffähnlicher Atome 13.2 Der Aufbau wasserstoffähnlicher Atome 13.3 Quantenzahlen 13.4 Wellenfunktionen: s-Orbitale 13.5 Wellenfunktionen: p- und d-Orbitale 13.6 Der Elektronenspin 13.7 Spektrale Übergänge und Auswahlregeln Der Auflau von Mehrelektronenatomen 13.8 Die Orbitalnäherung 13.9 Das Pauli-Prinzip 13.10 Durchdringung und Abschirmung 13.11 Das Aufbauprinzip 13.12 Die Besetzung der d-Orbitale 13.13 Die Konfiguration von Kationen und Anionen Die Periodizität der atomaren Eigenschaften 13.14 Der Atomradius Exkurs 13.1 Atomradius und Atmung 13.15 Ionisierungsenergie und Elektronenaffinität Die Spektren von Mehrelektronenatomen 13.16 Termsymbole 13.17 Die Spin-Bahn-Kopplung Aufgaben 14 Die chemische Bindung Einführende Konzepte 14.1 Bindungstypen 14.2 Potenzialkurven Die Valence-Bond-Theorie 14.3 Zweiatomige Moleküle 14.4 Mehratomige Moleküle 14.5 Promotion und Hybridisierung 14.6 Resonanz Molekülorbitale 14.7 Linearkombinationen von Atomorbitalen 14.8 Bindende Orbitale 14.9 Antibindende Orbitale 14.10 Der Aufbau zweiatomiger Moleküle 14.11 Wasserstoff- und Heliummolekül 14.12 Zweiatomige Moleküle der zweiten Periode 14.13 Symmetrie und Überlappung 14.14 Die elektronische Struktur homonuklearer zweiatomiger Moleküle 14.15 Die Parität 14.16 Heteronukleare zweiatomige Moleküle 14.17 Polare kovalente Bindungen 14.18 Der Aufbau mehratomiger Moleküle Exkurs 14.1 Computerchemie Aufgaben 15 Metallische und ionische Festkörper Die chemische Bindung in Festkörpern 15.1 Die Bändertheorie 15.2 Die Besetzung der Bänder 15.3 Das ionische Bindungsmodell 15.4 Die Gitterenthalpie 15.5 Coulomb-Beiträge zu Gitterenthalpien Kristallstrukturen 15.6 Die Elementarzelle 15.7 Die Identifizierung von Kristallebenen 15.8 Strukturbestimmung 15.9 Das Braggsche Gesetz 15.10 Experimentelle Techniken Typische Kristallstrukturen 15.11 Die kristalline Struktur der Metalle 15.12 lonenkristalle Aufgaben 16 Molekulare Systeme Der Ursprung der Kohäsion 16.1 Wechselwirkungen zwischen Partialladungen 16.2 Elektrische Dipolmomente 16.3 Die Wechselwirkung zwischen Dipolen 16.4 Induzierte Dipolmomente 16.5 Dispersionswechselwirkungen 16.6 Wasserstoffbrückenbindungen 16.7 Die Gesamtwechselwirkung Biopolymere 16.8 Polypeptidstrukturen Exkurs 16.1 Die Vorhersage von Proteinstrukturen 16.9 Denaturierung Flüssigkeiten 16.10 Die relative Anordnung von Molekülen 16.11 Molekulare Bewegung in Flüssigkeiten Mesophasen und disperse Systeme 16.12 Flüssigkristalle 16.13 Unterteilung disperser Systeme Exkurs 16.2 Zellmembranen 16.14 Oberfläche, Struktur und Stabilität 16.15 Die elektrische Doppelschicht Aufgaben 17 Rotationen und Schwingungen von Molekülen Allgemeine Aspekte der Spektroskopie 17.1 Experimentelle Methoden 17.2 Intensitäten und Linienbreiten Rotationsspektroskopie 17.3 Energieniveaus der Rotation von Molekülen 17.4 Rotationsübergänge: Mikrowellenspektroskopie 17.5 Raman-Rotationsspektren Schwingungsspektroskopie 17.6 Schwingungen von Molekülen 17.7 Schwingungsübergänge 17.8 Raman-Schwingungsspektren zweiatomiger Moleküle 17.9 Schwingungen mehratomiger Moleküle 17.10 Raman-Schwingungsspektren mehratomiger Moleküle Aufgaben 18 Elektronenübergänge Spektren im sichtbaren und ultravioletten 18.1 Das Franck-Condon-Prinzip 18.2 Die Messung von Intensitäten 18.3 Zirkulardichroismus 18.4 Spezielle Arten von Elektronenübergängen Die Desaktivierung angeregter Zustände Exkurs 18.1 Die Photochemie des Sehvorgangs 18.5 Fluoreszenz 18.6 Fluoreszenzlöschung 18.7 Phosphoreszenz 18.8 Laser Photoelektronenspektroskopie Aufgaben 19 Magnetische Resonanz Das Prinzip der magnetischen Resonanz 19.1 Kerne in Magnetfeldern 19.2 Technische Aspekte Die Auswertung von NMR-Spektren 19.3 Die chemische Verschiebung 19.4 Die Feinstruktur Exkurs 19.1 Magnetische Bildgebungsverfahren 19.5 Spinrelaxation 19.6 Der Kern-Overhauser-Effekt Aufgaben 20 Statistische Thermodynamik Die Zustandssumme 20.1 Die Boltzmann-Verteilung 20.2 Bedeutung der Zustandssumme 20.3 Beispiele von Zustandssummen Thermodynamische Eigenschaften 20.4 Innere Energie und Wärmekapazität 20.5 Entropie und Freie Enthalpie 20.6 Das Gleichgewicht auf statistischer Grundlage Exkurs 20.1 Der Helix-Knäuel-Übergang in Polypeptiden Aufgaben Zusatzinformation 1: Mathematische Methoden 1.1 Algebraische Gleichungen und Graphen 1.2 Logarithmus- und Exponentialfunktionen 1.3 Ableiten und Integrieren Zusatzinformation 2: Größen und Einheiten Zusatzinformation 3: Energie und Kraft Zusatzinformation 4: Die kinetische Gastheorie Zusatzinformation 5: Die Abhängigkeit der Freien Enthalpie von Druck und Temperatur Zusatzinformation 6: Begriffe der Elektrostatik Zusatzinformation 7: Elektromagnetische Strahlung und Photonen Zusatzinformation 8: Oxidationszahlen Zusatzinformation 9: Die Lewis-Theorie der kovalenten Bindung Zusatzinformation 10: Das VSEPR-Modell Anhang 1 Anhang 2 Anhang 3: Die Aminosäuren Häufig verwendete Beziehungen Mathematische Beziehungen Ausgewählte griechische Buchstaben Präfixe Wichtige Zahlenwerte und Naturkonstanten Periodensystem Lösungen zu den Aufgaben Lösungen zu den Exkursen Index |
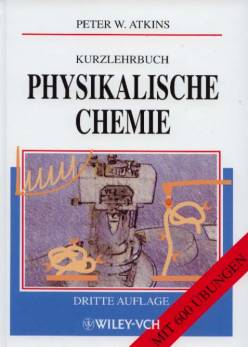
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen