|
|
|
Umschlagtext
James Sheehan ist Professor für Geschichte an der Stanford Universität. Er hat zahlreiche Werke zur deutschen und europäischen Geschichte verfasst, darunter 'Der deutsche Liebralismus von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg' (1983) und 'Geschichte der deutschen Kunstmuseen' (2002). Seit 2005 ist er Präsident der American Historical Association..
Europa war lange ein Kontinent der Gewalt. Doch nach der erschütternden Erfahrung von zwei Weltkriegen und dem Holocaust ist es friedlich geworden und zivil. James Sheehan, einer der herausragenden amerikanischen Historiker, schildert diesen dramatischen Weg Europas vom Krieg zum Frieden und zeigt, dass die Erfahrungen der Europäer in eine Paradoxie münden: Friedensmacht in einer friedlosen Welt nur dann sein zu können, wenn es bereit ist, sich - notfalls auch militärisch - zu engagieren. "Nur ein sehr guter Historiker kann so brillant die Mühsal des alten Europa beschreiben, das 1945 seinen Tiefpunkt erreichte und sich dann in ein Europa verwandelte, das für den Frieden eintritt und für einen prosperierenden zivielen Staat. Ein Triumph des humanen historischen Portraits, ein Schatz für Bürger und Studenten gleichermaßen." Fritz Stern Rezension
Sheehans Buch schildert in klarer Darstellung und in großen Zügen die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa vom ersten Weltkrieg bis zu den Kämpfen zwischen den Nachfolge-Staaten des ehemaligen Jugoslawien. Eindringlich legt er dar, wie im 19. Jahrhundert durch politische wie technische Entwicklungen die Voraussetzungen für die Massenkriege des 20. Jahrhunderts entstanden: Wehrpflicht, große stehende Heere, das wachsende Ansehen des Militärs, Nationalismus und Expansionsstreben, Maschinenwaffen, Flugzeuge. Seine überblickshafte Beschreibung der Kriege in Europa und ihrer Ursachen liefert allerdings keine Detail-Informationen oder Einsichten, die nicht schon bekannt wären. Ihm ist es auch nicht um weiter führende historische Forschung zu tun, sondern um die These, die Erfahrung des Krieges habe in Europa eine friedensorientierte zivile Gesellschaft hervorgebracht, die nicht mehr kriegswillig, aber auch nicht mehr kriegsfähig sei. Sie wird im Kapitel 'Warum Europa keine Supermacht werden wird' begründet und ausgeführt: "Der Niedergang des Willens und der Fähigkeit zur Gewaltanwendung, die einmal so zentral für die Staatlichkeit waren, hat eine neue Art von europäischem Staat geschaffen, der fest in neuen Formen der öffentlichen und privaten Identität verankert ist." (266)
Die Folgen dieser Entwicklung zeigten sich bereits in den Balkankriegen: Europa wollte und konnte nicht umfassend eingreifen, um Frieden herzustellen. Letztlich waren es die Amerikaner, die handelten. Europa ist reich und befriedet, aber von einer Welt voller Probleme umgeben, denen es sich stellen muss. Die entscheidende Frage für seine Politik ist deshalb, wie es diesen Zustand sichern und verteidigen will. Nach Sheehan wird das nicht ohne die USA möglich sein: "Es ist also wahrscheinlich, dass Europa weiterhin von irgendeiner Form der atlantischen Partnerschaft abhängig sein wird, mit allen dazugehörigen Spannungen und Konflikten." (272) Hauptgewinn der Lektüre Sheehans sind der Blick auf die Defizite Europas und sein Dilemma, das er seinen Politikern und Bürgern vor Augen stellt. Defizite liegen vor allem in seiner noch nicht klar definierten Verfasstheit und seiner Außenpolitik. Zweifellos genießen alle Staaten die wirtschaftlichen Vorteile der europäischen Union und den Friedensraum, den sie darstellt. Andererseits gibt es noch keine gemeinsamen Konzepte, wie dieser Raum zu schützen und zu erhalten ist, und zwar nicht nur gegen militärische Bedrohung, sondern vor allem auch im Horizont der Globalisierungsthematik. Ein Schwäche des Buches ist sein tendienziell nur beschreibender und wenig analytischer Zugriff. So wird nicht recht sichtbar, in wieweit die lange Friedenszeit nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wirklich auf Einsicht und politische Bemühung der Europäer zurückzuführen ist, oder ob sie nicht doch einfach einen historischen Glücksfall darstellt. Genau das wird sich natürlich daran zeigen, ob und in welcher Form, mit welchen Zielsetzungen und unter welchen Vorgaben die Europäer ihre 'Insel' in Zukunft verteidigen werden. Haben sie tatsächlich die von Sheehan nahe gelegte Lehre aus ihren Kriegen gezogen, müssten sie eine konsequente Friedenspolitik nicht nur für Europa, sondern über Europa hinaus entwickeln. Matthias Wörther, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Freudestrahlend zogen in ganz Europa am 1. August 1914 Menschenmassen auf die öffentlichen Plätze, um ihrem Jubel Ausdruck zu geben: Endlich Krieg! 90 Jahre später gab es die größte Massendemonstration in der europäischen Geschichte: Gegen den Irakkrieg von George W. Bush und Tony Blair. Dieser Wandel Europas von einem Kontinent der Kriege zu einer pazifistischen Zivilgesellschaft ist das Thema des Buches von James Sheehan. Der amerikanische Historiker zeigt uns einen dramatischen Bewußtseinswandel, an dessen Ende sich nach der verstörenden Erfahrung von zwei Weltkriegen das aufgeklärte Ideal einer Friedensmacht durchgesetzt hat – aber eben auch die trügerische Illusion, in einer friedlosen Welt ohne militärische Krisenbewältigung moralisch handeln zu können. Denn Europas Weg vom Krieg zum Frieden, auch das macht Sheehan deutlich, ist ein Sonderweg. Weder die USA noch China oder die islamische Welt haben vergleichbare Erfahrungen gemacht. Will Europa die Lehren aus seiner Geschichte weitergeben, dann muß es sich weltpolitisch engagieren, notfalls auch militärisch. Denn am Umgang mit dieser Paradoxie, Friedensmacht in einer friedlosen Welt zu sein, wird sich seine Rolle im 21. Jahrhundert entscheiden. Inhaltsverzeichnis
Danksagung 11
Prolog Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert 13 Teil I Im Frieden leben, den Krieg vorbereiten. 1900 –1914 23 1 «Ohne den Krieg gäbe es gar keinen Staat» 25 2 Pazifismus und Militarismus 47 3 Europäer in einer Welt voller Gewalt 69 Teil II Eine vom Krieg geschaffene Welt. 1914 –1945 95 4 Krieg und Revolution 97 5 Der zwanzigjährige Waff enstillstand 123 6 Der letzte europäische Krieg 153 Teil III Staaten ohne Krieg 183 7 Die Grundlagen der Nachkriegswelt 185 8 Der Aufstieg des zivilen Staates 213 9 Warum Europa keine Supermacht werden wird 241 Epilog Die Zukunft des zivilen Staates 267 Anmerkungen 275 Bibliographie 295 Register 311 |
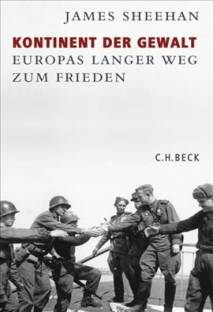
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen