|
|
|
Umschlagtext
Die aktualisierte und um 60 Beiträge erweiterte Neuauflage
des »Komponistenlexikons« verzeichnet die 350 wichtigsten Komponisten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der früheste behandelte Musiker ist der um 1200 an Notre Dame in Paris wirkende Perotin, die jüngsten sind Matthias Pintscher und Olga Neuwirth. Der Schwerpunkt der einzelnen Porträts liegt auf der werkbiographischen Darstellung, die das Schaffen nach seiner historischen Bettung und künstlerischen Qualität einordnet. Rezension
Gut verständlich, sinnvoll ausgewählt, aktuell und mit einem Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert - dieses Komponisten-Lexikon ermöglicht einen schnellen und informativen Überblick über die Klassik. Noten, Werkverzeichnisse und Literaturangaben ermöglichen vertiefende Weiterbeschäftigung.
G.B. für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das viel beachtete Metzler Komponisten Lexikon erscheint jetzt in einer Neuauflage! Es verzeichnet die 350 wichtigsten Komponisten vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Der früheste verzeichnete Musiker ist der um 1200 an Notre Dame in Paris wirkende Perotin, die jüngsten sind Matthias Pintscher und Olga Neuwirth. Das Lexikon vereinigt die Vorzüge einer essayistischen Porträtsammlung mit den Bedürfnissen einer Fachenzyklopädie und einer Musikgeschichte. Der Schwerpunkt der einzelnen Beiträge liegt auf der werkgeschichtlichen Darstellung, die das Schaffen nach seiner historischen Bedeutung und künstlerischen Qualität einordnet. Um viele Porträts erweitert und aktualisiert Von Perotin (um 1200) über Bach und Beethoven bis zu Pintscher und Neuwirth Autoreninformation: Horst Weber, Professor für Musikwissenschaft, Folkwang Hochschule Essen Pressestimmen: Auf rund 710 Seiten (ohne Bilder) zeichnen die diversen Autoren 350 werkgeschichtliche Porträts, wobei ein starker Schwerpunkt auf Komponisten des 20. Jahrhunderts liegt. Die im Allgemeinen gut lesbaren und auch für den Laien gut verständlichen Porträts werden ergänzt um Hinweise zu Noten-Ausgaben und Sekundär-Literatur. AUDIO kann dieses Lexikon Freunden der klassischen Musik, die eine schnelle, aber nicht oberflächliche Information suchen, nur empfehlen. AUDIO.de Horst Weber, Herausgeber des 1991 im Metzler-Verlag erstmals vorgelegten Komponisten-Lexikons, hat der 2. Auflage nicht nur eine neue Gestalt gegeben, sondern auch einen in vielem erweiterten und aktualisierten Inhalt. Codex flores Das "Komponisten-Lexikon" fasst meisterhaft die Geschichte der Musik für die allgemeinen Bedürfnisse zusammen und hat gleichzeitig den Charakter einer Fachenzyklopädie. Diese Publikation ist nicht nur ein unentbehrliches "Handwerkzeug" für den Musikliebhaber sondern auch eine hervorragende Unterstützung für den Einsteiger in die Welt der klassischen Musik. pgpresse.de Das neu aufgelegte einbändige Komponisten-Lexikon hat sich sofort eine Nische erobern können. Sein gelungenes Konzept beruht auf Begrenzung und Spezialisierung. Inhaltlich bietet das Komponistenlexikon zahlreiche Vorteile... Die Tonkunst online Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Hinweise zur Benutzung VI Verzeichnis der Abkürzungen und Siglen VII Komponisten von A—Z 1—712 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 713 Vorwort: Das Komponistenlexikon erscheint in neuer Gestalt und mit neuem Inhalt. Es ist schlanker, aber von gleichem Umfang. Die Welt der Musik und die Welt der Information haben sich in den vergangenen zwölf Jahren seit Erscheinen der ersten Auflage dramatisch verändert. Eine neue Generation von Komponisten ist nachgewachsen, Osteuropa nimmt intensiver als zuvor am europäischen Konzert teil und das Repertoire, das live und medial Verbreitung findet, ist breiter, auch diffuser geworden. Auf diese Entwicklungen galt es zu reagieren. Für die zweite Auflage wurden 60 Artikel neu geschrieben, davon 40 als Neuaufnahmen; alle übrigen Artikel wurden von den Autoren oder der Redakion aktualisiert, die Literaturhinweise auf den Stand von 2003 gebracht. Artikel und Literatur sind eine Auswahl. Ihre Kriterien sind dieselben geblieben wie in der ersten Auflage; Kontingente für Epochen, Stile und Nationen bilden das Gerüst, das notwendig subjektive Entscheidungen stützt. Ein deutlicher Akzent auf der Musik des 20. Jahrhunderts ist bewahrt. Das Konzept, über das Komponieren der Komponisten zu informieren, erscheint im Zeitalter des Internet, das Daten im Überfluß zur Verfügung stellt, notwendiger denn je. Und die Begrenzung des Mediums Buch begründet seine Qualität. Denn die Notwendigkeit der Auswahl stiftet Orientierung. Der Dank des Herausgebers gilt zuallererst seinen Autoren, vor allem denjenigen, die neue Beiträge für die zweite Auflage geschrieben haben, sodann dem Verlag, in dessen Händen Datenerfassung, Layout und Satzerstellung lag. Der Herausgeber dankt herzlich den Mitarbeitern, die an der Datenerfassung, Korrektur und Aktualisierung maßgeblichen Anteil hatten, Adrian Kühl (Heidelberg), Gordon Kampe und Jana Zwetzschke (beide Essen). Sein besonderer Dank gilt Uwe Schweikert, der mit diesem Lexikon sein letztes Musikbuch als Lektor betreut hat und dem alle, die Bücher über Musik zu schätzen wissen, viel verdanken. Gerade für ihn wünsche ich mir, daß dieses Buch in der Flut medialer Informationen vielen Orientierung sein möge. Essen, 26. September 2003 Horst Weber Leseprobe: Bernstein, Leonard Geb. 25. 8. 1918 in Lawrence (Massachusetts); gest. 14. 10. 1990 in New York Musik war für den Amerikaner B. stets ein unmittelbares Abbild menschlichen Lebens in allen nur denkbaren Facetten. Diese Auffassung hat er nicht nur in seinen pädagogischen Schriften (The Joy of Music, 1954), Vorlesungen (The Un-answered Question, 1976) und vor allem seiner Art zu dirigieren dokumentiert. Auch sein umfangreiches kompositorisches Werk in unterschiedlichen Gattungen legt davon Zeugnis ab. Musik ohne ein über sie selbst hinausweisendes Anliegen war für B. undenkbar. Seine Werke haben zahlreiche außermusikalischen Bezüge. Als Autor des Musiktheaters suchte er seine Sujets in amerikanischer Wirklichkeit, z. B. die Probleme großstädtischer Jugendbanden (West Side Story, New York 1957) oder das Psychogramm einer gescheiterten Kleinfamilie (A Quiet Place, Mailand 1984). Die Musik seiner Bühnenwerke konzipierte er als unmittelbare Klangrede, die selbst Elemente unterschiedlichster musikalischer Welten einbezog: Volksmusik, Tanzmusik, Jazz, aber auch Topoi sinfonischer Musik bis hin zur Verwendung von Zwölftontechniken (A Quiet Place, 1. Akt). All das ordnete er dramaturgischen Funktionen unter. Der Trennung der Musik in >U< und >E< setzte B. die Unterscheidung >gut< und >schlecht< entgegen. Sein Traum vom genuin amerikanischen Musiktheater, das über das Musical hinausgehend die Operntradition fortsetzen sollte, scheiterte indes an den Strukturen eines Musikbetriebs, der ohne Subventionen auskommen muß. B.s kompositorischer Eklektizismus setzt sich von Gattungstraditionen ab. Er setzt auf große musikalische Gesten, die sich an der Sinfonik der Jahrhundertwende, teilweise auch am Neoklassizismus der zwanziger Jahre orientieren. Das schließt auch Aspekte von Programmusik ein. Bereits in seiner Ersten Sinfonie »Jeremiah« (1942) sucht er ein großes Bekenntnis, indem er inmitten des Zweiten Weltkriegs Verse aus den Lamentationen des Propheten Jeremias vertont, und zwar in hebräischer Sprache. Der Gesangspart im dritten Satz ist in seiner komplexen Melismatik (teils über Orgelpunkten) jüdischem Synagogengesang nachempfunden. Wechselnde, ungerade Metren sowie teils motorisch geschlagene Akkorde bei einer reichen Instrumentation erinnern an Stravinsky. Die Harmonik verfolgt ein Konzept, innerhalb dessen unterschiedliche Akkorde durch Rückung verbunden werden. Es ist nicht die entwickelnde Variation im Kleinen oder ein im musikalisch-technischen Sinn sinfonischer Plan, der das Werk bestimmt, sondern eine genau kalkulierte Folge musikalischer Gesten, die eine Atmosphäre von Bedrohung ausdrücken. Die Uraufführung war ein bedeutender Erfolg für B. Er legte später noch weitere Bekenntnisse zum Judentum ab, u.a. in Kaddish (1963) und in den Chichester Psalms (1965) für Chor und Orchester, seinem - abgesehen von den Bühnenwerken - meistgespielten Werk. Die bereits früher erprobten Verfahren wendet B. auch hier an: eine verschleierte, letztlich tonale Harmonik, einen Orchestersatz, der sich am Sprachduktus orientiert. Freilich hat B. nie den Anschluß an die Avantgarde gesucht, sondern sich von serieller oder elektronischer Musik distanziert. Zwischen B.s Biographie und seinen Kompositionen existiert eine Parallele. Wie er sein Renommee als Dirigent oft einsetzte, um durch spektakuläre Konzerte auf Probleme der Menschheit aufmerksam zu machen, so suchte er in seinem Werk durch musikalische Symbole eine ideelle Parteinahme. Darin liegt auch der Grund für seine Ablehnung der Avantgarde, die seiner Auffassung nach als Musik für Spezialisten den eigentlichen Sinn von Musik verfehle, indem sie sich gegenüber dem Leben allzusehr verselbständige. Sein ästhetisches Konzept ist letztlich nicht aufgegangen, trotz aller Erfolge. Denn weder unter den Spezialisten noch im normalen Konzertbetrieb konnten sich seine Kompositionen behaupten. Mit einer Ausnahme: Die West Side Story bleibt sein Meisterwerk, denn in keiner anderen Komposition hat B. seine Bemühungen um eine amerikanische Musik, die einerseits Kunst ist, andererseits Popularität erzielt, derart präzise in Musik umgesetzt. Er hat die Konventionen der Gattung Musical eingehalten und sie dennoch überschritten, indem er sowohl durch die Handlung als auch durch die Musik eine Ernsthaftigkeit, eine Realitätsnähe auf die Bühne brachte, die den meisten Musicals fremd ist. Noten: Schirmer (N.Y.). Dokumente: The Joy of Music, N.Y. 1954; dt. als Freude an der Musik, Stg. 1961. Young People's Concert, N.Y. 1962; dt. als Konzert für junge Leute, Tübingen 1969. The Infinite Variety of Music, N.Y. 1966; dt. als Von der unendlichen Vielfalt der Musik, ebd. 1968. The Unanswered Question, N.Y. 1976; dt. als Musik, die offene Frage, Wien 1975. Findings, N.Y 1982; dt. Erkenntnisse. Beobachtungen aus 50 Jahren, Hbg. 1983. Bibliographie: LAIRD, P.R.: L.B. A Guide to Research, N.Y. 2001. Literatur: PEYSER, J.: L. B. N.Y. 1987; dt. Hbg. 1988. CONE, M.: LB., N.Y. 1970. L. B., hrsg. von R. DUSELLA und H. Loos, Bonn 1989 [mit WV]. BURTON, H.: LB., N.Y. 1994; dt. Mn. 1994. JAENSCH, A.: L.B.s Musiktheater. Auf dem Weg zu einer amerikanischen Oper, Kassel 2003. Ulrich Kurth |
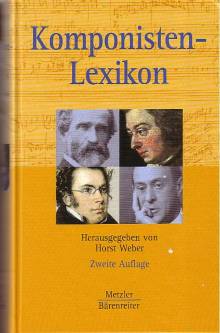
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen