|
|
|
Umschlagtext
Während der Vorbereitungen zu dem in diesem Buch wiedergegebenen Symposium „Kindheit heute – Realität und Wunschdenken“ kam es in Deutschland zu zwei Ereignissen, die die Öffentlichkeit und die Medien sehr bewegten: PISA – das blamable Abschneiden unserer 15-jährigen Schüler und Schülerinnen im internationalen Vergleich und ERFURT – der entsetzliche 16-fache Mord und Selbstmord eines fast ebenso jungen Schülers an seinen Lehrern.
Wie konnte es dazu kommen? fragt sich alle Welt. Was läuft in unseren Schulen, unseren Elternhäusern, unseren Lebensbedingungen und Medien falsch, dass solche negativen Geschehnisse unsere Jugendlichen befallen können? Als das Symposium am 27.-29.06.02 in Hamburg stattfand, hatten sich Experten aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, dem Rechtswesen und der Politik zusammengefunden, um diese Fragen und alle mit Kindheit und Jugend in unserer Zeit zusammenhängenden Probleme intensiv zu diskutieren und richtungsweisende Antworten zu geben, die wir hiermit der Öffentlichkeit zum Gebrauch und hoffentlich guten Nutzen überreichen möchten. Rezension
Der Band dokumentiert 19 Fachbeiträge des 3. Europäischen Symposiums über Kindesentwicklung vom 27. - 29.06.2002 im Congress Centrum Hamburg aus der Perspektive von Politik, Medizin, Pädagogik, Psychologie, Soziologie und Rechtswesen. Die Kindheit hat sich in unserer Gesellschaft offensichtlich verändert. Diesen Veränderungen spüren die Beiträge nach und suchen Antworten auf die neuen Herausforderungen. Es geht um Kinder(un)freundlichkeit der Gesellschaft, Kinder-Bedürfnisse, Bindungen, Kinderrechte, Mobilität, Leistungsdruck, soziale Verarmung, ästhetische Bildung, schützende Faktoren, Benachteiligungen - und natürlich: um die PISA-Ergebnisse und deren Folgen. Insbesondere Lehrkräfte sollten um die veränderten Bedingungen von Kindheit heute wissen; dieser Band trägt dazu bei.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Autoren-Informationen In Hamburg geboren, aufgewachsen in Hamburg, Berlin, der Schweiz, Leipzig und Bielefeld. Dort Abitur, anschließend Medizinstudium in Hamburg, Facharztausbildung in Berlin, danach bis 1973 an der Universitätskinderklinik im UKE Hamburg tätig. Bereits von Berlin aus Kontakte zu dem Ehepaar BOBATH und Teilnahme an Kursen und Seminaren in London sowie an Kursen in der Schweiz (Bern). 1973 Eröffnung einer Praxis für die Behandlung mehrfach behinderter Kinder, ab 1985 Sozialpädiatrisches Zentrum, in dem Pädiatrie, Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und psychologie sowie Therapie für behinderte und entwicklungsverzögerte Kinder durchgeführt wird. 1974 gemeinsam mit Dr. Siebert, Hamburg, Aufbau des Werner-Otto-Instituts für Diagnostik und Therapie behinderter Kinder. 1979 enge Kontakte zu A. Jean Ayres in Torrance, Californien, USA und Ausbau der Sensorischen Integrationsbehandlung nach Jean Ayres. Übersetzung ihres Buches über die Sensorische Integration, das unter dem Titel „Bausteine der kindlichen Entwicklung“ 1984 erschienen ist und in der 3. Auflage vorliegt. Ihr eigenes Buch „Normale Entwicklung des Säuglings und ihre Abweichungen“ erschien 1979, wird jetzt in der 5. Auflage verkauft und ist in 7 Sprachen übersetzt worden. 1982 Aufbau des IKE-Instituts für Kindesentwicklung, eines Lehr- und Forschungsinstituts, in dem seither unter ihrer Leitung regelmäßig Bobathkurse und Kurse für die Sensorische Integrationsbehandlung sowie Dutzende von Seminaren und Kursen anderer Autoren stattfinden. 1983 und 1985 fanden die ersten beiden Europäischen Symposien im CCH statt. Das in dem vorliegenden Buch beschriebene 3. Symposium „Kindheit heute“ erfolgte im Juni 2002. Rezensionen/Kommentare (1.5.2005) “Alles in allem bietet das Buch lesenwerte Einblicke in die Entwicklungspsychologie und das Lernverhalten des Kindes. Es unterstreicht zu Recht die Bedeutung von verlässlichen Bezugspersonen in der Erziehung - auch wenn manche Referenten dem Leser bei der ‘Ganztagsschul-Euphorie’ die pädagogische Antwort schuldig bleiben, wie denn der Spagat zu schaffen sei zwischen dem natürlichen Recht des Kindes auf eine optimale Förderung einerseits und dem Wunsch, die dem Kind zustehende Zeit und Aufmerksamkeit dem Arbeitgeber geben zu wollen oder zu müssen, andererseits. Liebevolle Eltern können nie zu 100 Prozent durch ‘professionelles Betreuungspersonal’ ersetzt werden, lieblose Eltern vielleicht schon. Aber Auslotung bleibt schwierig.” Elisabeth Peerenboom, Katholische Bildung (1.3.2004) ""Zu den bedeutsamen Neuerscheinungen in Sachen generative Veränderungen gehört gewiss auch dieser Band. Politiker, Ärzte, Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Juristen und - vier Schüler beschreiben heutige Kindheit und artikulieren ihre Erwartungen an eine kindgemäße Erziehung bzw. Bildung. In der Regel sind Kongressberichte mühsame Lektüren, dieser jedoch ist eine spannende Auseinandersetzung mit der Realität und der Potentialität von Kindheit, von deutscher Kindheit."" PÄD Forum: unterrichten erziehen (1.3.2004) ""Morgens, auf dem Weg zur Arbeit, in der Straßenbahn: 10-jährige Mädchen, die aussehen wie Britney Spears, geschminkt und mit knappen Tops eher für die Disco als für den Unterricht zurecht gemacht. Zwei 'halbstarke' 13-Jährige beschimpfen sich lautstark, indem sie des einen Mutter als Nutte, des anderen Bruder als schwul titulieren. Was sind das für Kinder? Oder besser: Was ist das für eine Gesellschaft, die solche Verhaltensweisen hervorbringt und was tut sie ihren Kindern an? Die Autorinnen und Autoren dieses Buches beschreiben die Lebenswirklichkeit der Kinder in unserer Gesellschaft. Sie forschen nach den Ursachen, die zu den vielfältigen Missständen führen und zeigen Perspektiven auf für eine kindgerechtere Entwicklung unserer Lebensformen. Die Kapitel basieren auf Referaten, die im Juni 2002 in Hamburg beim '3. Europäischen Symposium über Kindesentwicklung' von Fachleuten aus Pädagogik, Soziologie, Psychologie, Medizin und Politik gehalten wurden. Es eröffnet sich ein weiter Horizont von Themen. U. a. geht es um Kinderrechte in Deutschland; um die Widerstandsfähigkeit von Kindern in einer sich wandelnden Welt und um neurobiologische Prozesse als Basis für Behandlung und Vorbeugung. Aspekte der Bildungspolitik werden diskutiert von Vertreterinnen der vier großen. Parteien. Und es geht konkret um unsere Bildungseinrichtungen von der Frühförderung über die Vorschuleinrichtungen bis zum Studium. In fast allen Artikeln tauchen die Begriffe PISA und ERFURT auf. Deutlich wird der Druck, unter dem alle an Erziehung und Bildungsvermittlung Beteiligten stehen. Und es geht auch um den Aktionismus der Politiker und die Schelte und die schnell gestrickten (Schein-) Lösungen, mit denen die Medien die Pädagogen konfrontieren. Lesenswert sind da zwei Kapitel, deren Autoren von neuen Schul- und Unterrichtskonzepten berichten. Der eine, Gerhard Kobe, stellt das Modell der kooperativen Schule Hamburg-Barmbek vor, die er als Rektor leitet (Soziale Verarmung im digitalen Zeitalter). Er fordert eine Schule, in der Kinder und Pädagogen ganztags zusammen lernen und leben, die den Kindern darüber hinaus einen verlässlichen sozialen Rahmen mit gemeinsamem Essen, Spiel und Engagement im Stadtteil bietet. Erfahrungen, die viele Kinder, nicht nur von berufstätigen Eltern, heute nicht mehr machen können. Sie erwartet nach dem mittäglichen Schulschluss oft nur ein Gang zum Schnellimbiss und einsame Stunden vor PC und TV. Dr. Jürgen Reichen, Pädagoge am Institut für Lehrerfortbildung in Hamburg, berichtet über ein Unterrichtsmodell in einer Grundschulklasse (Das Geheimnis der Bauecke). Er sieht die Gefahr, dass der Frontalunterricht auf die Schüler wie ein 17. und noch dazu langweiliges Fernsehprogramm wirkt. Er fordert neben (!) der PC-Ecke eine Bauecke im Klassenzimmer. Die Beobachtungen, die er in dem von ihm begleiteten Projekt mit einer ersten Klasse machen konnte, weisen darauf hin, dass der Umgang mit konkreten Materialien das Erlernen von Lesen und Rechnen unterstützt und die Kreativität wie auch das soziale Miteinander fordert und fördert. Die Kinder lernen auch, ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen. Diese Lernprozesse, die selbst gesteuert und das Spiel begleitend ablaufen, haben zwar wenig mit curricularer Fachdidaktik zu tun, sind aber alles andere als verlorene Arbeitszeit. Es ließe sich noch viel über dieses Buch schreiben. Was aber nicht versäumt werden darf ist, Dr. Inge Flehmig zu danken, dass sie uns als Herausgeberin und Initiatorin des Symposiums mit diesem Band einen großen Schatz an Erfahrungen, Sichtweisen und Lösungsperspektiven zum traurigen Thema 'Kindheit heute' zur Verfügung stellt. Welche Aufgabe ist uns, die wir in diesem Arbeitsfeld tätig sind, gestellt? Gerhard Kobe benennt es so: 'Im Zentrum aber steht die Erziehung zur Verantwortung, zur Verantwortung für sich selbst und zur Verantwortung für die Mitschüler und Mitmenschen.' "" Andreas Wand, Feldenkraisforum (1.6.2003) “Unter Mitwirkung kompetenter Fachkräfte aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, Rechtswesen und auch Politik gelang es auf dem 3. Europäischen Symposium zur Kindesentwicklung (27.-29.6.2002) in Hamburg, das Thema ‘Kindheit heute’ aus diversen Blickwinkeln zu beleuchten. Das vorliegende Buch ist der Berichtband dieser Kongressbeiträge. Das Buch will ‘Menschen, die am geistigen Fortschritt ebenso interessiert sind wie an einem menschenwürdigen Dasein für alle, Anregungen und Hilfen ... vermitteln beim Suchen und Umsetzen von Antworten auf die unendlich vielen Fragen, die uns das Dasein im Zusammenhang mit unseren Kindern und ihrer veränderten Kindheit in heutiger Zeit stellt’ (S. 8). Alle Referate – besonders jedoch diejenigen von Pädagogen – betonen die Notwendigkeit, sich einerseits stärker an der Individualität des einzelnen Kindes zu orientieren und andererseits jenen kleinen Individuen die Möglichkeit zu arrangieren, bisher versäumte sensorische, motorische, kognitive, sprachliche und sozial-emotionale Qualifikationen nachholen zu können. Solche Forderungen sind nicht neu. Bereits 1991 arbeitete Haarmann (Hrsg.) in seinem ‘Handbuch Grundschule, Band 1’ als Aufgabenkomplexe der Grundschule die Förderung sozial-integrativen wie auch individualisierten Lernens heraus. Was bereits bei den Autoren De Mause (‘Hört ihr die Kinder weinen ...’) 1977, Postman (‘Das Verschwinden der Kindheit’) 1983, von Hentig (Vorwort zu Aries ‘Geschichte der Kindheit’) 1984, Rolff & Zimmermann (‘Kindheit im Wandel’) 1985 und anderen bezüglich veränderten sozialen, räumlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen unserer postindustriellen Gesellschaft gesagt wurde, trifft heute ebenso zu: nicht die Kinder haben sich verändert, sondern die Bedingungen für Kindheit. Auch die Forderungen zur Bewältigung einer Kindheit heute haben auf dem 3. Europäischen Symposium zur Kindesentwicklung im Jahre 2002 noch immer gleich hohen Stellenwert. Besonders jedoch erscheint mir nach nunmehr einem Vierteljahrhundert, dass man (endlich) nicht nur im pädagogisch-psychologischen Bereich, sondern breit gefächert interdisziplinär nach Wegen sucht zur Entwicklungsförderung der Kinder in unserer Gesellschaft. Sich gemeinsam Gedanken machen lässt hoffen, dass bald gemeinsame Handlungen folgen werden. Zwischen De Mause und dem Symposium 2002 stehen die Ereignisse der Pisa-Studie und der Erfurter Amoklauf, welche einhellig von allen Kongressreferenten u.a. auch als kognitive und menschliche Schwächen unserer Schulen interpretiert werden. Beide Ereignisse ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Beiträge und werden als Argumentationsgrundlage für dringlichen Handlungsbedarf bemüht – jedoch gemäß der unterschiedlichen Professionalität der Referierenden für zuweilen äußerst divergente Maßnahmenkataloge (siehe unten: Kritik von Jürgen Reichen). Für den psychomotorischen Bereich scheinen mir u.a. folgende Beiträge von besonderer Relevanz mit Aussagen, wie hier zusammengefasst wiedergegeben: Jürgen Reichen (Pädagoge): ‘So wie ich die (Grund-) Schule täglich erlebe, so wie ich Pädagogik und Didaktik verstehe, ... und so wie ich die Pisa-Studie interpretiere, kann ich die Schlussfolgerungen, welche die Politik aus Pisa zu ziehen scheint, nicht verstehen und schon gar nicht teilen’ (S. 221). Sein ‘Geheimnis der Bauecke’ (S. 221-237) als offene Unterrichtsform führt zu besseren sozialen Kontakten unter den Kindern, langfristig zur Rückbildung von Aggressionen – weil Bauen nur gemeinsam erfolgsgekrönt, zu Handlungsplanung, Raumvorstellung und Spracherwerb. Emmy Werner (Research Professor, University of California): ‘Die Kinder, die in Deutschland und in den USA am verwundbarsten sind, gehören zu der wachsenden Zahl frühgeborener Babys, die durch die neonatale Intensivmedizin gerettet werden, oder sind Kinder von Eltern, die Alkohol oder Drogen missbrauchen, oder die ohne Väter ... erzogen werden oder mit einem Vater, der arbeitslos ist’ (S. 183). Ihrer Meinung nach liegen ‘Widerstandsfähigkeit und schützende Faktoren im Leben von Kindern, die unter [solchen] ungünstigen Bedingungen aufwachsen’ (S. 183-192), – belegt durch die 40-jährige Kawai-Langzeitstudie –, in der emotionalen Hilfe, die sie während ihrer Kindheit erhalten seitens einer Mutter mit Schulbildung und Kompetenz im Umgang mit ihrem Baby, seitens einer fürsorglichen Großmutter und Lehrern mit offenem Ohr für die Sorgen ihrer Schülerinnen und Schüler. Gerd Schäfer (Prof. Dr. Phil., Universität Köln): ’Wahrnehmen ist ein breit angelegter innerer Verarbeitungsprozess, an dem die Sinnesorgane, der Körper, Gefühle, Denken und Erinnerung beteiligt sind. ... Wahrnehmen ist wählendes, handelndes Strukturieren, Bewerten, Erinnern, sachliches Denken in einem’ (S. 171). Schäfer sieht als Grundlage und Ausgangspunkt einer ästhetischen Welterfahrung – ‘am Anfang waren wir alle Ästheten’ (S. 167-182) – die Bildung der sinnlichen Tätigkeit (Bildung der Leiberfahrung, Gefühle, Fernsinne) über viel-sinnliche Wahrnehmungen in der Alltagswirklichkeit. Charles Njiokiktjien (Nervenarzt und Kinderneurologe, Amsterdam): ‘Kreuzmodalität ist ein wichtiges Prinzip für die Entwicklung der Wahrnehmung, des Lernens und der motorischen Expression (S. 90). Eupraxie ... hat ... einen günstigen Einfluss auf die Sprachentwicklung, da die beiden Funktionen ... bei jüngeren Kindern miteinander verbunden sind’ (S. 92). Motorische Aktivität, insbesondere in psychomotorischer, mitteilender Handlung, nimmt die Sprache sowohl funktionell als auch morphologisch mit, weil ‘dabei sowohl zwischen den Hemisphären als auch innerhalb der Hemisphären nervliche Veränderungen auftreten: ... Neubildung von Synapsen’ (S. 93). Njiokiktjien sieht die ‘neurobiologische[n] Prozesse der normalen Sprachentwicklung als Basis für Vorbeugung und Behandlung’ (S. 87-98) und damit die Notwendigkeit fachlich enger Zusammenarbeit in der Logopädie, Ergotherapie und Motopädie beim Auftreten von Abweichungen in der frühen Sprachentwicklung: Ein Plädoyer für Motorik und Sprache in ihrer simultanen und einander wechselseitig beeinflussenden Entwicklung – ein neurobiologisches Erklärungsmodell. Allen Beiträgen gemeinsam sind grundlegende Forderungen an Elternhaus, Kindergarten und Grundschule für eine positiv verlaufende ‘Kindheit heute’ nach offenen Unterrichtsformen, Anerkennung der Kinder als Basis ihrer Bildung, Stärkung ihres Selbstwertgefühls und ihrer Selbstsicherheit, Wertevermittlung unter dem kindlichen Bewusstsein für seinen Selbstwert sowie Vermittlung von Eingebunden-sein/Zugehörigkeit. Lassen Sie es uns (endlich) angehen!“ Dr. Birgit Jackel, Praxis der Psychomotorik Inhaltsverzeichnis
Einführung
Dr. Inge Flehmig 7 Begrüssung Dr. Hans Nölting 9 1. Und jedes Kind ist, wie alle Kinder, wie kein anderes Kind 11 Dr. Inge Flehmig 2. Wie kinderfreundlich ist unsere Gesellschaft 23 Cornelia Pieper 3. Kindheit heute - Risiken, Probleme, Chancen 33 Prof. Dr. Lothar Krappmann 4. Frühe Bindungen und emotionale Sicherheit 47 Dr. phil., Dipl. Psych. Karin Grossmann 5. Kinderrechte in Deutschland. Kinder - Eltern - Staat; Kinder und Gewalt; Welchen Schutz bietet unsere Rechtsordnung? Kinder haben Rechte aber keine Stimme. Wahlrecht von Geburt an? 65 Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit 6. Kinder heute: mobil, mehrsprachig, belastbar und börsenfest? 79 Helga Kühn-Mengel 7. Neurobiologische Prozesse der normalen Entwicklung als Basis für Vorbeugung und Behandlung 87 Dr. Charles Njiokiktjien 8. Kindheit heute: Lust oder Last? 99 Ingrid Fischbach 9. Widerstandsfähige Kinder in einer sich wandelnden Welt 113 Katharina Zimmer 10. Soziale Verarmung im digitalen Zeitalter (Welche Rollenveränderungen sind für die Schule erforderlich?) 131 Gerhard Kobe 11. Schülergruppe: Vier Schüler: Ihre Kindheit, ihre Wünsche 145 Natalie Köster, Vincent Förster, Ofir Gal, Fozia Bhatti 12. Veränderte Gesellschaft - veränderte Kindheit - und was wird daraus? 153 Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhart Lempp 13. Am Anfang waren wir alle Ästheten 167 Prof. Dr. Gerd E. Schäfer 14. Widerstandsfähigkeit und schützende Faktoren im Leben von Kindern, die unter ungünstigen Bedingungen aufwachsen 183 Prof. em. Dr. Emmy E. Werner 15. „Schätze heben" - Benachteiligungen ausgleichen. Bildung im Vorschulalter 193 Christa Goetsch 16. Der schiefe und der gerade Turm von Pisa - ein Lob des Fehlers und des Respekts 205 Reinhard Kahl 17. Das Geheimnis der Bauecke 221 Dr. Jürgen Reichen Autorenliste 238 Sach- und Personenverzeichnis 240 Über die Herausgeberin 248 |
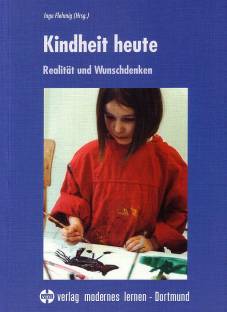
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen