|
|
|
Umschlagtext
Karl-Josef Kuschel, der Name, wenn es um den Dialog von Literatur und Theologie und den Aufweis geht, daß das Gespräch mit den Poeten des 20. Jahrhunderts unverzichtbar ist für ein heutiges Sprechen vom Menschen, von Gott und von Jesus, In seinem neuen Buch zieht der Autor zugleich Bilanz und beschreitet neue Wege. Er spricht von den Dichtern und läßt sie zu Wort kommen, die ihm - seit er theologisch zu denken begann - Herz und Hirn bewegten und oft genug Anstifter seines Glaubens waren. So macht er deutlich, wie notwendig es ist, dem Zufall der traditionellen religiösen Sprache entgegenzuwirken. Zwischen religiöser und ästhetischer Erfahrung gibt es produktive Spannungsverhältnisse: Religiöse Erfahrungen können Ausgangspunkt und Gegenstand künstlerischer Realisierung sein, und ästhetische Erfahrungen können die religiöse Dimension erfahren lassen, positiv provozieren oder radikal negieren. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Affirmation und Kritik, zwischen prophetischem Gestus und protesthafter Verweigerung konkret zu beschreiben, ist Anliegen des vorliegenden Buches. Es entfaltet Grundthemen einer interkulturellen Theologie; und es ist der Versuch eines Brückenschlags von der Welt der Poesie zur Welt der Theologie und umgekehrt. So leistet der Autor einen unverzichtbaren Beitrag zu einer künftigen kulturellen Kompetenz der Theologie.
Karl-Josef Kuschel, geboren 1948, Dr. theol., ist Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität und lehrt dort Theologie der Kultur und des Interregiösen Dialogs. Kuschel ist einem großen Leserkreis durch zahlreiche Publikationen bekannt. 1997 Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Lund (Schweden). Rezension
Karl-Josef Kuschel ist in der Tat DER Name, wenn es um den Dialog von Theologie und Literatur geht. Er hat sich immer wieder mit der Rezeption von theologischen Themen, insbesondere der Figur Jesu, in der modernen Literatur des 20. Jhdts. beschäftigt und dazu hilfreiche Quellenbände herausgegeben. Einer liegt hiermit vor. Gerade die literarische Verfremdung vermag auch für die Religionspädagogik hilfreiche didaktische Aspekte zu eröffnen; denn insbesondere der literarisch verfremdete Jesus ermöglicht die Auseinandersetzung. Und so läßt sich denn von der Rezeptionsästhetik der Gegenwartsliteratur her geradezu eine ganze Dogmatik fassen: Atheismus, Theodizee, das Böse, die Schuld, das Geschöpf … Kuschel regt uns immer wieder an, den Dialog mit der Bibel über die Litreratur aufzunehmen. - Der Band ist preislich reduziert und bietet ein überaus günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
PROLOG 1
1. Denk-Wege 1 2. Mephistos listige Warnung 5 3. Der Protest des »Fremden« gegen den Priester 7 4. Schreibenkönnen wie Flaubert 10 5. Transzendenz: Die Begegnung mit dem großen Kunstwerk 16 6. Karsamstag-Existenzen 25 7. Was ist interkulturelle Theologie? 29 8. Die Unheimlichkeit eines »Christuskopfs« 34 A. RÄTSEL MENSCH 39 I. Das Erschrecken über sich und die Welt 40 1. Das Gespräch mit dem Glasmann: Kurt Tucholsky . . 40 Der Blick in den Spiegel 40 Wer bist du, Glasmann? 43 Wider die Selbstzufriedenheit 46 2. Was ist der Sündenfall? Günter Kunert 48 Ohne Gnade überlassen 49 Wie liest ein »Ungläubiger« die Bibel? 52 Adam, Eva und die Erbsünde 53 Müde des eigenen Rätsels 57 3. Der Anfang aller Rätsel: Wolfgang Hildesheimer ... 59 Kein Sinn der Schöpfung 60 Warum das Rätsel grinst 63 Schlechtes Licht auf Gott 65 Gib ihnen die ewige Ruhe nicht 67 II. Die Erschöpftheit der Schöpfung 72 1. Erste Visionen vom Ende: Expressionisten 72 Der apokalyptische Urschrei 73 »Weltende« — mit schwarzem Humor 74 Untergang als kosmischer Fall 76 2. Apokalypsen heute und hier 78 Die Stunde des Zorns kehrt wieder 78 Nichts ist uns unmöglich 80 3. Nichts wird sein wie vorher: Christa Wolf 81 Von »Kassandra« bis »Störfall« 81 Technik und Angst 83 4. Der Alptraum vom Ende der Menschheit: Günter Grass 85 Die Aufklärung gescheitert? 85 Ratten beerben die Menschen 89 Wozu Literatur, wenn keine Zukunft? 91 Ringen um die Möglichkeit von Hoffnung 93 5. Lachen als Zynismusprophylaxe: Kurt Marti 96 Tschernobyl und danach 97 Begreifliche Gefühle der Selbstabdankung 99 Mit Unsinn gegen den Wahnsinn 100 Loben und Lachen als Geschwister 102 III. Die Unausweichlichkeit der Schuld 105 1. Vergebliche Suche nach Schuld: Max Frisch 105 Begegnungen mit Nachkriegs-Deutschland 106 Schuldig unterscheidet sich der Mensch vom Tier ... 108 2. Der Homo Faber — aufgeklärt, aber verblendet. .... 110 Ein Experiment in Sachen Schuld 111 Warum Homo Faber schuldig ist und es nicht merkt 113 Menschen bestimmen ihr Leben nicht selbst 115 3. Die Urschuldder Geschlechter 118 Freigesprochen und doch schuldig 118 Schuld ohne Sühne 120 Schuldig wird der Mensch zum Menschen. 121 IV. Erfahrungen mit dem Bösen 124 1. Die Patina der Zivilisation ist dünn 124 Buchenwald neben Weimar 125 Ein Oratorium wider das Vergessen: Peter Weiss . . . 126 Kirche mit dem Rücken zu Auschwitz 128 2. Das Böse macht Spaß: Rolf Hochhuths Teufel 129 Auschwitz oder die Frage nach Gott 129 Das Böse ist gewollt 132 Warum der Teufel lacht 133 Appell an das Mitleid 137 3. Die Hölle — erster Kreis: Alexander Solschenizyn . . . 139 Menschen in der Hölle — ahnungslos 139 Die entsetzliche Banalität des Bösen 142 Dem Bösen widerstehen 143 4. Trotzdem von Gnade reden? Thomas Mann 146 Wider das schlechthin Teuflische 146 Deutschtum, Dämonie und Musik 150 Teufelspakt: Tod der Liebe, Ausbruch der Kälte .... 152 Der Selbstdenker als Selbsthenker 156 Ein Wunder, das über den Glauben geht 161 Im Dunkel Gott am nächsten 164 V. Umrisse einer Poetik des Menschen 167 1. Die Facetten des Menschlichen 167 2. Mein Gott, die Menschen... 168 3. Wir leben und sterben alle im Rätsel 171 B. ABGRUND GOTT 173 I. Die Tabuisierung der Gotteskritik 175 1. Die Beschwichtigung des Zweifels: Gebetbücher 175 Mach mit mir, wie es dir gefällt? 176 Verdrängung der Klage - Ausblendung der Anklage 177 2. Warum Gott verschont wurde 179 Die Abwehr des Dualismus 180 Vorherwissen ja, Vorherbestimmung nein 181 Das Übel ist von Gott nur zugelassen 183 3. Der Protest gegen Gott als Atheismus 185 Nötige Rückfragen an Gott 186 Abschied von Leibniz 187 4. Aber Gott leidet doch auch 188 Leiden — Preis der Liebe 189 Das Stillstellen des Protestes 191 II. Wie reden vom Unbegreiflichen? 194 1. Ein Autor streicht das Wort Gott: Friedrich Dürrenmatt 194 Ein Zug rast in den Abgrund 195 Verfehlte Deutungen 197 Das Schreckliche als Möglichkeit 199 Warum »Gott« gestrichen werden mußte 203 2. Weder gläubig noch glaubenslos: Marie Luise Kaschnitz 207 Neue Gotteserfahrungen 208 Gott im Aufbruch und in der Zerstörung 214 Gottes Kälte und Gottes Verwirrung 219 Widerspruch in Tutzing 222 Religiöses Leben als Hadern mit Gott 224 III. Treibt Gott selbst den Unfug? 228 1. Protestierende Rückkehr zu Gott: Heinrich Heine. . . 228 Der Kranke: Lazarus und Hiob zugleich 230 Rebellische Gebete aus der Matratzengruft 234 Den Spaß Gottes ehrfürchtiger Kritik unterwerfen . . 238 2. Gott vor Gericht: Ehe Wiesel 242 Ein Tribunal gegen Gott 243 Der Teufel verteidigt Gott 246 Das Ende der klassischen Theodizee 248 IV. Warten auf Gottes Rechtfertigung 252 1. Rebellische Texte der Bibel 253 Dahin mein Vertrauen: Klagelieder 253 Warum mußte ich geboren werden? Hiob 255 Ich schreie zu Dir: der Protest eines Kranken 257 2. Warten auf Theodizee 260 Warum Klage und Anklage legitim sind 260 Hoffnung auf die Durchsetzung Gottes 262 3. Gott lieben — Gott zum Trotz 262 Die Geschichten rebellischer Rabbiner 263 Man muß sich nicht unterwerfen 266 Wo bleibt die Gegenleistung, Gott? 268 Was soll denn noch geschehen? Zvi Kolitz 271 Du hast alles getan, damit ich nicht glaube 275 V. Umrisse einer Theopoetik 280 1. Arbeit an der Sprache — im Bewußtsein des Scheitems 281 2. Das Unsagbare dem Sprachlosen abringen 283 3. Der Abgrundder Unbegreiflichkeit Gottes 286 4. Die theologische Legitimität einer Anklage Gottes . . . 290 5. Wider einen »lügnerischen Optimismus« 291 C. GESICHTER JESU 297 I. Der geschonte Rebell 298 1. Dialog mit dem »armen Vetter«: Heinrich Heine . . . 298 Das Jesusportrait als Selbstportrait 300 Golgotha ist überall 301 Jesus ja — Christus nein 302 2. Jesus und die Dichter heute 303 Unüberbrückbare Kluft zum Dogma 305 Der Nazarener wird vor Kritik geschont 305 II. Weihnachten: Die Utopie und ihr Verrat 307 1. Was früheren Jahrhunderten möglich war 307 Gellerts Kniefall vor dem Wunder 307 Eichendorffs Vision einer versöhnten Welt 308 Storms Knecht Ruprecht rechnet ab 310 2. Risse im Kulissenbild 313 Heile-unheile Welt bei Buddenbrooks: Thomas Mann 314 Kurt Tucholskys Weihnachtsmelancholie 315 Erich Kästners Satire 317 3. Das Weihnachtsspiel als Lebensdrama 320 Jüdische Kinder suchen Herberge: Ilse Aichinger . . . 320 Hat Stalingrad Bethlehem widerlegt? Peter Huchel . . 323 Menschwerdung durch ein Wort: Heinrich Böll .... 326 Die Gleichzeitigkeit der Stimmen 331 III. Ecce Homo: Gesichter Jesu im Spiegel großer Kulturen 333 1. Ein Kreuz bleibt leer: Anna Seghers 334 Ein Gegenbild von Deutschland 334 Ein Kommunist auf der Flucht 337 Eine Nacht im Dom 338 Ein Kreuz als Zeichen des Widerstands 341 Vom Roman über die Flucht zum Leben auf der Flucht 343 2. Die Gewalt ist besiegbar: William Faulkner 346 Christus kommt wieder — mitten im Krieg 347 Plumpe Parallelen? 351 Leidenschaft für das Untatsächliche 354 Wie Gewalt überwunden werden kann 356 3. Das Böse im Herzen bekämpfen: Nagib Machfus .... 359 Ein gefährlicher Autor 360 »Jesus« als Austreiber der Dämonen 362 Das Böse im Herzen besiegen 364 Die Hoffnung auf Befreiung ist unausrottbar 366 4. Hoffnung für ein Volk — Paraguay: Augusto Roa Bastos 369 Ein »Christus« als Widerstandszeichen des Volkes. . . 372 Ein Mann opfert sich für sein Volk 376 Ein Epos auf die Widerstandskraft der Menschen ... 380 Was heißt »Menschensohn«? 381 5. Alle Menschen Gottes Ebenbild: Cingiz Ajtmatov . . . 385 Ein Roman zwischen den Kulturen 386 Vergegenwärtigungen Jesu 389 Entzauberung der Macht im Namen der Religion ... 391 Jesus kommt in den Menschen zurück 394 Das Böse für alle Zeiten überwinden 398 IV. Auferstehung: Anfechtung bürgerlich gewordener Christen 402 1. Ostern als Triumph des Christentums 402 Osterlieder — freudig-naiv gesungen 402 Auferstehung als kosmisches Drama: Friedrich Gottlieb Klopstock 404 2. Allein mir fehlt der Glaube: Johann Wolfgang Goethe 407 Ein Mann sucht Wahrheit auf eigene Faust 407 Ironische Brechungen von Ostern 410 Erinnerungen an die Kindheit 412 3. Auferstehung mitten im Leben: Leo Tolstoj 415 Ein Mann sühnt seine Schuld 415 Totalkonfrontation mit der Kirche 417 Ein Dichter wird exkommuniziert 419 »Auferstehung« als geistige Wandlung 422 4. Was wäre, wenn ein Toter aufersteht? Friedrich Dürrenmatt 424 Ein grotesk-verrücktes Stück: »Meteor« 424 Die Aufhebung aller Positionen 429 Ein Mann steht auf und glaubt nicht daran 433 Wider die bürgerlich-christliche Entschärfung 436 Wider die »bloßen Ästheten« 438 Die Gleichzeitigkeit der Stimmen 439 V. Umrisse einer Christopoetik 443 1. Der Vertraut-Fremde 443 2. Eine christopoetische Spur: Max Frisch 444 3. Die Evangelisten als Christopoeten 449 4. Die Andersheit und Unfaßbarkeit Jesu 452 5. Ausdruck der Kultur — Widerstand gegen die Kultur 454 IN EIGENER SACHE 459 |
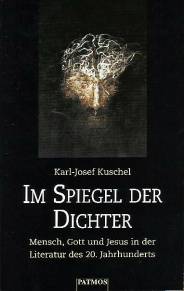
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen