|
|
|
Umschlagtext
Webers' Handbuch der Tonstudiotechnik für Schallaufnahme und -wiedergabe ist das Nachschlagewerk für alte, die sich mit Elektroakustik auf Studioniveau beschäftigen. Die vorliegende 9. Auflage enthält wichtige, zeitgemäße Anpassungen und Erweiterungen: Dies betrifft Themen, die bei Tonaufnahmen für Fernsehen und Film von Bedeutung sind, wie die Probleme der Lichtgestaltung bei Tonaufnahmen mit Bild und die Beschallung von Auditorien bei Veranstaltungen mit Publikum. Im Bereich der vielkanaligen stereofonischen Bearbeitung und Übertragung sind dies die verschiedenen Dolby-Surround-Systeme in Verbindung mit dem 3/2-Stereo-Standard bis hin zur Wellenfeldsynthese. Dazu gehört auch die Signalverteilung auf bis zu sieben Stereokanäle bei der Audiomischung internationaler Spielfilme.
Der Teil zur digitalen Signalspeicherung und Nachbearbeitung beschreibt die Verfahren zur Datenreduktion nach MPEG-1 bis MPEG-7 und MP3. Das Kapitel Compact-Disc-Systeme behandelt die sehr weitverbreitete CD-Technik von der klassischen CD-DA über die CD-ROM mit ihren diversen Varianten bis hin zur DVD, Super Audio CD (SACD), HD-DVD, Blu-ray Disc und HVD (Holographic Versatile Disc). Darüber hinaus findet der Leser die magneto-optischen Aufzeichnungssysteme MOD und MiniDisc. Die digitalen Lichttonverfahren DOLBY SR*D, SONYSDDS und DTS behandelt ein eigenes Kapitel. Hard-Disk-Systerrie und das "bandlose Studio" in Verbindung mit nicht linearen Editing-Systemen (NES), wie AVID, FAIRLIGHT, LIGHTWORKS, MONTAGE und PROTOOLS, werden mit Erfahrungen aus der Praxis angereichert und ausführlich behandelt. Aus dem Inhalt: - Physikalische Grundlagen - Das Schallempfinden - Grundlagen der Übertragungstechnik - Künstlerisch-technische Probleme der Schallaufnahme und Übertragung - Studio-Geräte und -Einrichtungen - Schallspeicherung - Studioräume und Tonregieanlagen - Qualitätsparameter der elektrischen Schallübertragung - Messtechnik Rezension
Wer Klänge aufzeichnen will - und seien es nur die Klänge seines Schulorchesters oder seines Schulchors - wird nicht umhin können, sich über das "Wie" und "Womit" Gedanken zu machen. In dem vorliegenden Buch, seit 40 Jahren ein Standartwerk in diesem Bereich, führt Johannes Webers in alle Aspekte der Schallaufzeichnung ein: Von den physikalischen Grundlagen über das menschliche Schallempfinden (ein Bereich, den man auch schön mit Schülern bearbeiten kann), den technischen Grundlagen der Signalübertragung ... bis hin zu künstlerischen Fragen der Schallaufzeichnung. Dabei sind sowohl die (ganz) neuen wie auch die alten Verfahren vertreten.(Kennen unsere Schüler noch Schallplatten?) So wird dieses Handbuch kaum eine Frage unbeantwortet zurücklassen. Das Buch ist sicher nicht leicht zu lesen, aber auch derjenige, der nicht vom Fach ist, aber etwas Gespür für technische und physikalische Zusammenhänge hat, wird wenn er sich die Mühe macht, manchen Absatz mehrmals zu lesen, dem Autor folgen können. Im schulischen Bereich wird man bei Aufnahmen wohl selten Studioqualität erreichen und nur wenige Schulen werden sich ein eigenes Tonstudio leisten können, aber die Hinweise in desem Band können auch dann, wenn man auf einfachere Weise Klänge aufzeichnet, hilfreich sein. (Zum Beispiel bei Wahl und Aufstellung von Mikrofonen).
Auch die Grundlagen der Akustik und des Hörens, die in diesem Buch dargestellt werden, können bei der Vorbereitung einer Aufnahme hilfreich sein. Verlagsinfo
Webers Handbuch der Tonstudiotechnik ist seit mehr als 25 Jahren ein unentbehrliches Nachschlagewerk für Fachleute und interessierte Laien, die sich mit Elektroakustik auf Studioniveau beschäftigen. Den Fachmann begleitet es wegweisend vom Studium bis weit in die berufliche Praxis hinein, den Hobbytechniker versetzt es in die Lage, sich das erforderliche Wissen anzueignen. Die vorliegende Neuauflage enthält wichtige zeitgemäße Anpassungen und Erweiterungen. Ein ausführliches Literatur- und Stichwortverzeichnis unterstreicht den hohen Nutzen als bewährtes und praktisches Nachschlagewerk. Aus dem Inhalt: - Physikalische Grundlagen - Das Schallempfinden - Grundlagen der Übertragungstechnik - Künstlerisch-technische Probleme der Schallaufnahme und Übertragung - Studio-Geräte und -Einrichtungen - Schallspeicherung - Studioräume und Tonregieanlagen - Qualitätsparameter der elektrischen Schallübertragung - Messtechnik Inhaltsverzeichnis
Einleitung 21
A Physikalische Grundbegriffe 23 I Schwingungen 23 1 Einfache Schwingungen 24 2 Überlagerung von Schwingungen 25 2.1 Überlagerung von Schwingungen gleicher Frequenz 25 2.2 Überlagerung von Schwingungen ungleicher Frequenz 27 3 Modulation von Schwingungen 31 3.1 Amplitudemnodulation 31 3.2 Frequenzmodulation 33 3.3 Phasenmodulation 37 4 Analyse von Schwingungen 37 4.1 Analyse periodischer Schwingungen 37 4.2 Analyse nichtperiodischer Schwingungen 41 II Entstehung von Verzerrungen und Verzerrungsmaße 42 1 Lineare Verzerrungen 42 1.1 Dämpfungsverzerrungen 42 1.2 Phasenverzerrungen 44 2 Nichtlineare Verzerrungen 44 2.1 Entstehung nichtlinearer Verzerrungen 44 2.2 Maße nichtlinearer Verzerrungen 49 2.2.1 Klirrkoeffizienten und Klirrfaktor 49 2.2.2 Differenztonfaktoren 49 2.2.3 Modulationsfaktoren 50 2.2.4 Identität der verschiedenen Verzerrungsmaße 50 2.2.5 Gründe für die Vielzahl der Verzerrungsmaße 52 3 Modulationsverzerrungen 54 3.1 Amplitudemnodulationsverzerrungen 54 3.2 Frequenzmodulationsverzerrungen 54 III. Akustische Grundbegriffe 55 1 Das Schallfeld 55 1.1 Kenngrößen einer fortschreitenden ebenen Schallwelle 56 1.2 Kugelwelle 59 1.3 Schallenergie 61 1.4 Gestörte Schallausbreitung 63 1.4.1 Reflexion 63 1.4.2 Stehende Wellen 66 1.4.3 Brechung 69 1.4.4 Schalldämpfung und Schalldämmung 71 Schalldämpfung 72 Schalldämmung 73 1.4.5 Beugung 76 2 Raumakustik 78 2.1 Geometrische Raumakustik 78 2.1.1 Diffusität in Räumen mit ebenen Begrenzungsflächen 79 2.1.2 Räume mit gekrümmten Begrenzungsflächen 81 2.1.3 Räume mit untergliederten Begrenzungsflächen 83 2.2 Statistische Raumakustik 84 B Das Schallempfinden 93 I Aufbau und Funktion des Gehörs 93 II Tonhöhe 95 1 Das Tonhöhenempfinden 95 1.1 Hörbarer Frequenzbereich 96 1.2 Das Tonhöhenempfinden als Funktion der Frequenz 96 1.3 Minimal wahmehmbare Tonhöhenunterschiede 98 1.4 Kennzeit der Tonhöhenwahmehmung 99 2. Frequenzumfang wichtiger Schallquellen 100 III. Lautstärke 102 1 Das Lautstärkeempfinden 102 1.1 Grenzendes Lautstärkeempfindens 102 1.2 Das Lautstärke- und Lautheitsempfinden als Funktion derphysikalischen Kenngröße 104 1.3 Lautstärkewirkung kurzzeitiger Schallereignisse 107 1.4 Der Verdeckungseffekt 108 1.5 Gesamtlautstärke mehrerer Schallereignisse 110 2 Lautstärkeumfang einiger Schallquellen 112 IV Klangfarbe 112 V Einschwingvorgänge 116 1 Physiologische Einschwingzeit des Ohres 116 2 Unterscheidungsvermögen bei verschiedenen Einschaltvorgängen 116 3 Verwischungsschwelle 117 4 Das Gesetz der ersten Wellenfront (Precedence-Effekt) 117 VI. Räumliches Hören 118 1 Richtungshören 119 1.1 Richtungswahmehmung durch Laufzeitunterschiede 119 1.2 Richtungswahmehmung durch Intensitätsunterschiede 120 1.3 Richtungswahrnehmung durch Klangfarbenunterschiede 123 1.4 Beiträge der Laufzeit-, Intensitäts- und Klangfarbenunterschiede zum Gesamtrichtungshören 123 2 Wahmehmbarkeit der Schallquellenentfernung 125 2.1 Entfernungswahrnehmung durch Hallerscheinungen 125 2.2 Entfernungswahrnehmung durch Klangfarbenunterschiede 125 2.3 Entfernungswahrnehmung durch Lautstärkeänderungen 125 3 Wahrnehmbarkeit der Schallquellenausdehnung 126 VII. Wahrnehmbarkeit von Verzerrungen 126 1 Lineare Verzerrungen 127 1.1 Dämpftingsverzerrungen 127 1.2 Laufzeitverzerrungen 128 2 Nichtlineare Verzerrungen 130 3 Modulationsverzerrungen 132 C Grundlagen der Übertragungstechnik 140 1 Die elektronische Schallübertragung 140 2 Modulation 143 3 Modulationsverfahren 144 4 Multiplex-Verfahren 146 4.1 Frequenz-Multiplex-System 147 4.2 Zeit-Multiplex-System 147 5 Rundfunkübertragung 150 6 Die digitale Übertragungsform 154 6.1 Analog-und Digitalübertragung im Vergleich 155 6.2 Die Digitalübertragung durch Puls-Code-Modulation (PCM) 156 6.2.1 Der Abtastvorgang 156 6.2.2 Die Quantisierung 157 6.2.3 Die Codierung 158 6.3 Konversionsschaltungen 161 6.3.1 Analog/Digital-Wandler 161 6.3.2 Digital/Analog-Wandler 163 D Künstlerisch-technischen Probleme der Schallaufnahme und Übertragung 165 I Optimale Akustik des Aufnahmeraumes 165 II Mikrofonanordnung 168 1 Mikrofonaufstellung 173 2 Tonaufnahmen mit Bild 176 2.1 Feststehende Mikrofone, die im Bild erscheinen dürfen 176 2.2 Feststehende Mikrofone, die nicht sichtbar sein sollen 176 2.3 Bewegliche Mikrofone, die sichtbar sein dürfen 177 2.4 Bewegliche Mikrofone, die nicht im Bild erscheinen dürfen 178 3 Probleme der Lichtgestaltung bei Tonaufnahmen mit Bild 180 III Aussteuerung 183 IV Stereofonische Übertragungswege 184 1 Räumliche Beziehungen bei der mehrkanaligen Übertragung 185 2 Zweikanahge raumbezügliche stereofonische Übertragung 189 2.1 Zweikanahge Wiedergabe 190 2.1.1 Lokalisierung durch Intensitätsunterschiede 190 2.1.2 Lokalisierung durch Laufzeitunterschiede 194 2.1.3 Kompensation verfälschender Einflüsse 197 2.2 Zweikanahge Aufnahme 200 2.2.1 Intensitätsunterschiede der Mikrofonpegel 200 2.2.2 Laufzeitunterschiede 204 2.2.3 Überlagerung der Intensitäts- und Laufzeitunterschiede 207 2.2.4 Mikrofonanordnungen 207 2.2.5 Störung der stereofonischen Aufnahme 214 2.2.6 Mikrofonanordnung bei der Intensitätsstereofonie 214 3 Vielkanalige stereofonische Übertragung 220 4 Ambiofonie 221 5 Quadrofonie 222 5.1 Das Vierkanal-System (4-4-4) 224 5.2 Die Matrix-Systeme (4-2-4) 224 5.3 Quasi-Quadrofonie (2-2-4) 227 6 Das Dolby Surround System 228 7 Der 3/2-Stereo-Standard 231 8 Kunstkopfstereofonie 232 9 Das Eidofonie-Verfahren 225 10 Die Wellenfeldsynthese (NffS) 239 E Studiogeräte und Studioeinrichtungen 246 I Schallwandler 246 1 Mikrofone 247 1.1 Kontaktmikrofone 247 1.2 Elektrostatische Mikrofone 247 1.2.1 Niederfrequenzschaltung 248 1.2.2 Das Elektret-Prinzip 250 1.2.3 Hochfrequenzschaltung 252 1.2.4 Richtcharakteristiken und Kapselausführungen 253 1.3 Interferenz-Mikrofone 261 1.4 Elektrodynamische Mikrofone 263 1.4.1 Bändchemnikrofon 263 1.4.2 Tauchspulmikrofon 264 1.5 Piezoelektrische Mikrofone 266 1.6 Mikrofone für Sonderzwecke 267 1.6.1 Koinzidenz-Mikrofone 267 1.6.2 Lavalier-Mikrofone 269 1.6.3 Grenzflächen-Mikrofone 270 1.6.4 Das Zoom-Mikrofon 272 1.6.5 Digitale Mikrophontechnik - Solution D 274 2 Lautsprecher 275 2.1 Elektrodynamische Lautsprecher 275 2.1.1 Aktive Lautsprecher-Kombinationen 279 2.1.2 Das Walsh-System 280 2.1.3 Lautsprecher mit Regelkreis 281 2.2 Elektrostatische Lautsprecher 284 2.3 Piezoelektrische Lautsprecher 285 2.4 HP-Lautsprecher 285 2.5 Der Plasma-Wandler 286 3 Strahlungsverhältnisse 288 II Verstärker 294 1 Kopplungsarten von Verstärkern 294 2 Studioverstärker 297 2.1 Mikrofonverstärker 298 2.2 Knotenpunktverstärker 300 2.3 Ausgangs- und Trennverstärker 300 2.4 Verteiler-Verstärker 303 3 Leistungsverstärker 303 III Einsteller und Regler 306 1 Pegelsteller 306 1.1 Aufbau der Pegelsteller 307 1.2 Schaltungsarten 307 1.2.1 T-und H-Schaltung 307 1.2.2 L-Schaltung 307 1.2.3 x-Schaltung 308 1.3 Aktive Pegelsteller 309 1.4 Elektronisch gesteuerte Pegelsteller 309 1.5 Panoramasteller 311 2 Regelverstärker 314 2.1 Statische u. dynamische Eigenschaften von Regelverstärkern 315 2.2 Regelverstärker mit variablen Eigenschaften 319 2.3 Der Transienten-Limiter 323 2.4 Kompander-Systeme 324 2.4.1 Die Dolby-Systeme 325 2.4.2 Der telcom-Kompander 329 3 Verzerrer und Entzerrer 331 3.1 Hoch-Tiefentzerrer 332 3.2 Hörspielverzerrer 332 3.3 Präsenzfilter 333 3.4 Tiefensperre 334 3.5 Höhensperre 335 3.6 Universalentzerrer 336 3.7 Programm-Entzerrer mit automatischer Steuerung 343 3.7.1 Der "De-Esser" oder Filter-Limiter 343 3.7.2 Das "Noise Gate" ein Programm gesteuertes Rauschfilter 345 3.7.3 Restauration historischer Aufnahmen 348 IV Kontrollinstrumente 349 1 Aussteuerungsmesser 349 1.1 Forderungen an einen Aussteuerungsmesser 350 1.1.1 Anzeigebereich 350 1.1.2 Frequenzgang 350 1.1.3 Dynamische Eigenschaften 350 1.2 Ein Standard-Aussteuerungsmesser 352 1.3 Aussteuerungsmesser mit opto-clektronischer Anzeige 353 1.4 Aussteuerungsmesser mit Pegelbildgerät 355 1.5 Aussteuerungskontrolle mit Frequenzanalyse 356 2 Korrelationsmesser 357 3 Aussteuerungsmesser für Surround-Sound 359 V. Die Erzeugung künstlicher Klangeffekte 360 1 Künstlicher Nachhall 360 1.1 Der Hallraum 360 1.2 Die Nachhallplatte 361 1.3 Die Nachhallfeder 362 1.4 Digitale Systeme für die elektronische Nachhallerzeugung 363 2 Die elektronische Erzeugung von Klängen 367 2.1 Das MIDI-System 368 2.2 Der Synthesizer 370 3 Der Vocoder 372 4 Das "Leslie-System" 373 5 Phasing und Flanging-Effekte 375 6 Der Harmonizer 378 F. Schallspeicherung 380 I Analoge Schallspeicherverfahren 380 1 Magnettonverfahren 381 1.1 Magnetische Grundbegriffe 381 1.1.1 Magnetische Grundgrößen 381 1.1.2 Magnetismus 383 1.1.3 Magnetisierungskurve 384 1.1.4 Entmagnetisierung 386 1.1.5 Remanenzkurve 387 1.2 Theorie der magnetischen Schallspeicherung 388 1.2.1 Löschvorgang 390 1.2.2 Aufzeichnungsvorgang 392 1.2.3 Zustand des Tonträgers nach der Aufnahme 405 1.2.4 Einflüsse fremder Felder auf Tonträger nach Aufwicklung 407 1.2.5 Abtastvorgang 411 1.3 Einrichtungen der Magnettontechnik 419 1.3.1 Tonträger 419 1.3.2 Magnetköpfe 432 1.3.3 Magnetton-Verstärker 435 1.4 Magnettonanlagen 440 1.4.1 Zweikanal-Anlagen 440 1.4.2 Mehrspurtechnik 442 1.5 Laufwerke 446 1.5.1 Praktische Ausführungen der Laufwerke 447 1.5.2 Magnetbandlaufwerk 447 1.5.3 Magnetfilmlaufwerk 451 1.6 Die Synchronisierung von Ton und Bild 454 1.6.1 Gleichlauf Systeme für perforierte Bänder 454 1.6.2 Pilottonverfahren 457 1.7 Der elektronische Schnitt 459 1.7.1 Die longitudmale Timecode-Aufzeichnung / LTC-Code 462 1.7.2 Der Vertical Interval Timecode / VITC-Code 464 1.7.3 Der Control Track Timecode / CTL-Code 464 1.7.4 Der Rewritable Consumer Timecode / RCTC-Code 464 1.7.5 Time-Code-Aufzeichnung bei Audiogeräten 464 1.8 Laufwerkssteuerungen 466 2 Lichttonverfahren 468 2.1 Fotometrische und fotochemische Grundbegriffe 468 2.1.1 Transparenz 468 2.1.2 Schwärzung und Schwärzungsmessung 468 2.1.3 Schwärzungskurve 469 2.2 Die fotografische Schallaufzeichnung .470 2.2.1 Prinzip und Schriftarten 470 2.2.2 Aufzeichnungsvorgang 472 2.2.3 Exposition und Bearbeitung des Tonträgers 476 2.2.4 Abtastvorgang 481 2.3 Einrichtungen für die Lichttonaufnahme 484 2.3.1 Stereofonische Lichttonaufzeichnung 487 2.3.2 Das"Dolby"-Lichttonverfahren 488 2.3.3 Die Laser-Beam-Lichttonaufzeichnung 491 2.4 Lichttonspuren auf Bildfilmen 495 2.5 Einrichtungen für die Lichttonwiedergabe 495 3 Nadeltonverfahren, die mechanische Schallspeicherung 499 3.1 Prinzip und Schriftarten 499 3.2 Aufzeichnungsvorgang 501 3.3 Vervielfältigung 509 3.4 Abtastvorgang 513 3.5 Plattenlaufzeit 520 3.6 Tonträger 521 3.7 Laufwerk 521 II Digitale Schallspeicherverfahren 524 1 Grundzüge der digitalen Schallaufzeichnung 525 1.1 Die Digitalisierung des Audio-Signals 529 1.2 Quantisierung 530 1.3 Codierung 530 1.4 Fehlerschutz / Error Correction Coding / ECC 534 1.5 Die Wiedergewinnung des analogen Audio-Signals 536 1.6 Digitale Schnittstellen 538 1.7 Datenreduktion 539 2 Magnetbandverfahren 544 2.1 Längsspuraufzeichnung 544 2.1.1 Das DASH-Format 544 2.1.2 Das S-DAT-System 549 2.2 Schrägspuraufzeichnung 552 2.2.1 Die Audio-Quasi-Videoaufzeichnung 554 2.2.2 Das R-DAT-Systern 557 2.3 Elektronischer Schnitt zur Nachbearbeitung von Digitalaufnahmen 562 2.3.1 Elektronischer Schnitt mit digitalen Magnetbandmaschinen 562 2.3.2 Das "Computer-Editing-System" von Soundstream 565 3 Die Compact-Disc-Systeme 568 3.1 CD-A / Die digitale Schallplatte "Compact-Disc" 568 3. 1.1 Das optische Prinzip 570 3.1.2 Signalaufbereitung und Codierung 573 3.1.3 Die Herstellung der Compact-Disc 577 3.1.4 Der Wiedergabevorgang 582 3.2 CD-ROM 589 3.3 CD-1 / CD-Interaktiv 591 3.4 CD-ROM-XA 591 3.5 PCI) / Photo-CD 592 3.6 CDTMV / Full Motion Video-CD, 593 3.7 CD-R / Compact Disc Recordable 595 3.8 CD-RW / Compact Disc Rewritable 597 3.9 DVD / Digital Versatile Disc 599 3. 10 SACD / Die Super Audio CD 603 3.11 HD-DVD und Blu-ray-Dise 605 3.12 HVI) - Holographic Versatile Disc 607 4 Magneto-optical-Disc - MOD 608 5 Magnetplattenspeicher 613 6 Digitale Lichttonaufzeichnung 615 6.1 Grundüberlegungen 615 6.2 Das Dolby SR*D Verfahren 618 6.3 Das SDDS System von Sony 619 6.4 Das DTS System 620 6.5 Das THX-System 621 G Studioräume und Tonregieanlagen 622 1 Studioräume 622 Schaltungen für die Tonregie 623 2.1 Ein Standard-Mischpult 626 2.2 Eine Regieeinrichtung für Musikaufnahmen 630 2.3 Eine Regieschaltung zur Darstellung von Nachhalleffekten 631 2.4 "ln-Line"-und"Routing"-Schaltungen 632 2.5 Die automatische Abmischung von Mehrspuraufnahmen 635 2.6 Die Nachsynchronisation von Film-und Videoproduktionen 637 2.6.1 Die Nachsynchronisation mit Filmschleifen 637 2.6.2 Die Nachsynchronisation mit videotechnischen Mitteln 640 2.7 Einrichtungen für die Mischung von Tonfilmen 643 2.8 Modul-Technik 650 2.9 Die zentrale Speisung von Mikrofonen 654 2.9.1 Tonaderspeisung (DIN 45595) 654 2.9.2 Phantomspeisung (DIN 45596) 655 2. 10 Drahtlose Mikrofontechnik 656 2.11 Beschallungsanlagen 657 3 Digitale Mischpult-Systeme 661 4 Hard-Disk-Systeme und das bandlose Studio 671 4.1 Die nichtlineare Bearbeitung von Programmen / NES-Systeme 674 4.2 Das DYAXIS-System 675 4.3 Das Synclavier 677 4.4 Systeme für die Ton- und Bildbearbeitung 680 4.5 ProTools 681 4.6 Der AVID-Media-Composer 685 5 Digitale und analoge Systeme in der Praxis 687 H Qualitätsparameter der elektrischen Schallübertragung 694 I Lineare Verzerrungen 694 II Nichtlineare Verzerrungen 695 III Dynamikeinschränkungen 696 1 Elektrische Grenzen der übertragbaren Dynamik 696 2 Akustische Grenzen der übertragbaren Dynamik 699 3 Praktische Begrenzung der übertragbaren Dynamik in den verschiedenen Übertragungswegen 700 J Messtechnik 702 1 Messung linearer Verzerrungen 702 1.1 Dämpfungsverzerrungen 702 1.1.1 Dämpfungsverzerrungen durch Pegelmessung 702 1.1.2 Dämpfungsverzerrungen durch Vergleichsmessung 703 1.2 Phasendifferenzmessung 704 1.2.1 Messung der Phasendifferenz mit Oszillografen 705 1.2.2 Phasendifferenzmessung nach Summen-Differenzmethode 706 2 Messung nichtlinearer Verzerrungen 707 2.1 Eintonverfahren 707 2.1.1 Messung des Klirrfaktors 707 2.1.2 Messung der Klirrkoeffizienten 708 2.2 Zweitonverfahren 708 2.2.1 Messung der Differenztonfaktoren 708 2.2.2 Messung der Modulationsfaktoren 710 3 Messung der Modulationsverzen-ungen 712 3.1 Amplitudenmodulationsverzen-ungen 712 3.2 Frequenzmodulationsverzerrungen 712 4 Messung des Geräuschspannungsabstandes 713 5 Akustische Messverfahren 713 5.1 Ein universeller Messgenerator 713 5.2 Lautsprecherinessungen 715 5.3 Messungen an Mikrofonen 716 5.4 Bestimmung der Nachhallzeit und des Schallabsorptionsgrades 717 5.5 Schalldämmungsmessungen 718 5.6 Frequenzanalyse 719 6 Messgeräte zur Überprüfung digitaler Übertragungsglieder 722 7 Automatische Mess-Systeme 724 Anhang 729 Die SI-Einheiten der wichtigsten Größen und ihre Umrechnung in andere Einheiten 730 Literaturverzeichnis 732 Sachverzeichnis 753 |
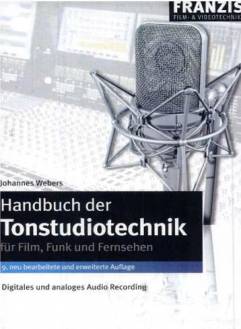
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen