|
|
|
Umschlagtext
Ein Studium der Philosophie bietet die Möglichkeit, sich mit einer Vielzahl von Positionen und Theorien auseinanderzusetzen. Dabei einen Überblick und ein Verständnis für die Zusammenhänge zu gewinnen, ist nicht einfach. Es reicht dafür nicht aus, die Geschichte der Philosophie nachzuerzählen. Besser ist ein problemgeschichtliches Vorgehen, das durch systematische Bewertungen einschließt.
Diese Einführung vermittelt die Zusammenhänge anhand einer exemplarischen Auswahl von Grundproblemen, die die Philosophie in ihrer ganzen thematischen Bandbreite vertritt. Rezension
Was sind die Grundprobleme der Philosophie? Sicherlich gehört dazu die Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielfalt in der Welt. Welche Antwort gaben darauf die Vorsokratiker? Ist Platon mit seiner Ideenlehre Begründer der abendländischen Metaphysik? Wodurch unterscheidet sich die Philosophie des Aristoteles von der des Platon? Was hat es auf sich mit dem Universalienstreit? Woran zeigt sich die Mathematisierung der Welt in der Frühen Neuzeit? Wie versuchte Kant in seiner Transzendentalphilosophie das Verhältnis von Einheit und Vielfalt zu lösen? Welche Positionen wurden im Deutschen Idealismus entwickelt und welche Kritik erfuhren diese? Überzeugen die Antworten des Neukantianismus, der Lebensphilosophie und des Monismus? Welche Rolle spielen Logik und Sprachanalyse im 20. Jahrhundert? Wie ist das Verhältnis von analytischer und kontinentaler Philosophie zu bestimmen? Ist Dichtung für die Philosophie von Relevanz?
Fundierte Antworten auf diese philosophiegeschichtlichen Fragen liefert Gottfried Gabriel (*1943) in seinem Buch „Grundprobleme der Philosophie in geschichtlicher Entwicklung“, erschienen bei Brill/Schöningh. Der ehemalige Professor für Logik und Wissenschaftstheorie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist u.a. bekannt durch seine Mitherausgeberschaft des „Historischen Wörterbuchs der Philosophie“, seine Herausgabe von Freges „Schriften zur Logik und Sprachphilosophie“(1971, 5. Aufl. 2020) sowie seine Bücher „Grundprobleme der Erkenntnistheorie“(1993, 3. Aufl. 2008) oder „Einführung in die Logik“(2007, 4. Aufl. 2013). So wird Freges Beitrag zur Philosophie in dem vorliegenden Buch auch angemessen gewürdigt. Dabei rekurriert Gabriel auf Erkenntnisse aus seiner 1975 publizierten Abhandlung „Fiktion und Wahrheit. Eine semantische Theorie der Literatur“, welche 2019 in zweiter Auflage, erweitert um den Anhang „Logik und Sprachphilosophie bei Frege“, wieder aufgelegt wurde. Die schon dort entwickelte Einsicht, dass Dichtung einen eigenen Erkenntniswert besitzt, nimmt Gabriel auch in seinem neuen Buch auf. In dem abschließenden Kapitel plädiert er für die „Anerkennung komplementärer Erkenntnisformen“ und einen „behutsamen Pluralismus“(S. 346) in der Philosophie. Folglich wird Philosophie von Gabriel „zwischen Logik und Literatur“(S. 347) lokalisiert. Der Philosophieprofessor ist sich bewusst, dass seine Ausführungen in seinem Band aus eurozentristischer Perspektive verfasst sind. Unerwähnt bleiben in diesem die Reflexionen von Philosophinnen zu den oben genannten Grundproblemen. Lehrkräfte des Faches Philosophie werden durch das Buch Gabriels motiviert, in ihrem Fachunterricht mit Schüler:innen über das Verhältnis von Einheit und Vielheit zu reflektieren. Fazit: Gottfried Gabriel liefert mit seinem Buch „Grundprobleme der Philosophie in geschichtlicher Entwicklung“ einen hervorragenden, kompakten Überblick über die Auseinandersetzung von Philosophen mit der zentralen metaphysischen Frage nach Einheit und Vielheit in der Welt. Das Werk eignet sich auch aufgrund seines problemorientierten Zugriffs gut als Einführung in die Philosophie und deren Geschichte. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Was sind Grundprobleme der Philosophie? Sicherlich die Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielfalt in der Welt. Welche Antwort gaben darauf die Vorsokratiker? Kann Platons Ideenlehre überzeugen? Wodurch unterscheidet sich die Philosophie des Aristoteles von der des Platon? Was hat es auf sich mit dem Universalienstreit? Woran zeigt sich die Mathematisierung der Welt in der Frühen Neuzeit? Wie versuchte Kant in seiner Transzendentalphilosophie das Verhältnis von Einheit und Vielfalt zu lösen? Welche Positionen wurden im Deutschen Idealismus entwickelt und welche Kritik erfuhren diese? Überzeugen die Antworten des Neukantianismus, der Lebensphilosophie und des Monismus? Welche Rolle spielen Logik und Sprachanalyse im 20. Jahrhundert? Wie ist das Verhältnis von analytischer und kontinentaler Philosophie zu bestimmen? Ist Dichtung für die Philosophie von Relevanz? Fundierte Antworten auf diese philosophiegeschichtlichen Fragen liefert Gottfried Gabriel (*1943) in seinem Buch „Grundprobleme der Philosophie in geschichtlicher Entwicklung“, erschienen bei Brill/Schöningh. Der ehemalige Professor für Logik und Wissenschaftstheorie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist u.a. bekannt durch seine Mitherausgeberschaft des „Historischen Wörterbuchs der Philosophie“, seine Herausgabe von Freges „Schriften zur Logik und Sprachphilosophie“(1971, 5. Aufl. 2020) sowie seine Bücher „Grundprobleme der Erkenntnistheorie“(1993, 3. Aufl. 2008) oder „Einführung in die Logik“(2007, 4. Aufl. 2013). So wird Freges Beitrag zur Philosophie in dem vorliegenden Buch auch angemessen gewürdigt. Dabei rekurriert Gabriel auf Erkenntnisse aus seiner 1975 publizierten Abhandlung „Fiktion und Wahrheit. Eine semantische Theorie der Literatur“, welche 2019 in zweiter Auflage, erweitert um den Anhang „Logik und Sprachphilosophie bei Frege“, wieder aufgelegt wurde. Die schon dort entwickelte Einsicht, dass Dichtung einen eigenen Erkenntniswert besitzt, nimmt Gabriel auch in seinem neuen Buch auf. In dem abschließenden Kapitel plädiert er für die „Anerkennung komplementärer Erkenntnisformen“ und einen „behutsamen Pluralismus“(S. 346) in der Philosophie. Folglich wird Philosophie von Gabriel „zwischen Logik und Literatur“(S. 347) lokalisiert. Der Philosophieprofessor ist sich bewusst, dass seine Ausführungen in seinem Band aus eurozentristischer Perspektive verfasst sind. Unerwähnt bleiben in diesem die Reflexionen von Philosophinnen zu den oben genannten Grundproblemen. Lehrkräfte des Faches Philosophie werden durch das Buch Gabriels motiviert, in ihrem Fachunterricht mit Schüler:innen über das Verhältnis von Einheit und Vielheit zu reflektieren. Fazit: Gottfried Gabriel liefert mit seinem Buch „Grundprobleme der Philosophie in geschichtlicher Entwicklung“ einen hervorragenden, kompakten Überblick über die Auseinandersetzung von Philosophen mit der zentralen metaphysischen Frage nach Einheit und Vielheit in der Welt. Das Werk eignet sich auch aufgrund seines problemorientierten Zugriffs gut als Einführung in die Philosophie und deren Geschichte. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Diese Einführung nimmt die Leser:innen mit auf eine Zeitreise durch die Philosophiegeschichte. Gottfried Gabriel belässt es nicht bei einer Nacherzählung, sondern analysiert ausgewählte Probleme der Theoretischen und Praktischen Philosophie in ihren historischen und systematischen Zusammenhängen: Fundiert und verständlich – der perfekte Wegbegleiter für das Studium der Philosophie. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
1 Einleitung: Zur problemgeschichtlichen Methode 13 2 Vom Mythos zum Logos: Die griechische Philosophie 20 2.1 Die Suche nach der Einheit in der Vielheit: Die ionischen Naturphilosophen 21 2.2 Alles ist Zahl: Pythagoras 23 2.3 Wandel oder Beharrung: Heraklit und Parmenides 24 2.4 Beharrung im Wandel: Die Atomisten 29 2.5 Geistiges Sein statt Sinnlichkeit: Sokrates und Platon 31 2.5.1 Die Ideenlehre 32 2.5.2 Erkenntnis als Wiedererinnerung und die Methode der Mäeutik 36 2.5.3 Das Höhlengleichnis 40 2.5.4 Die Dichterkritik 42 2.6 Aristoteles als der Philosoph 45 2.6.1 Aristoteles gegen Platon in der theoretischen Philosophie 45 2.6.2 Aristoteles gegen Platon in der praktischen Philosophie 49 2.7 Der Kyniker Diogenes 52 2.8 Die Sophisten: Protagoras und Gorgias 53 2.9 Wissen, Weisheit und Glück: Philosophie als Lebenskunst 54 2.10 Die römische Rezeption der griechischen Philosophie 57 3 Von der Spätantike zur mittelalterlichen Scholastik 60 3.1 Glauben und Wissen: Anselm von Canterbury 61 3.2 Der Universalienstreit: Realismus, Nominalismus und Konzeptualismus 63 3.3 Die Philosophie als Magd der Theologie 66 3.4 Kirche, Staat und Individuum: Wilhelm von Ockham 67 3.5 Die Aufwertung des Individuums und des Individuellen: Duns Scotus 69 4 Die Philosophie der Neuzeit 72 4.1 Vom Mittelalter zur Renaissance 72 4.2 Das neue Menschenbild der Renaissance: Pico della Mirandola 76 4.3 Induktion statt Deduktion: Francis Bacon 78 4.4 Die Mathematisierung der Naturwissenschaft 83 4.5 Die neue Stellung des Subjekts 87 4.6 Das Erbe des Dualismus: Rene Descartes und die Folgen 89 4.7 Die Einbildungskraft und die Dichtung: Giambattista Vico und Descartes 92 4.8 Der Materialismus und seine Konsequenzen 96 4.9 Der Deismus 98 5 Die Epoche der Aufklärung 100 5.1 Aufklärung und Gegenaufklärung 100 5.2 Metaphysik und Metaphysikkritik 108 5.3 Rationalismus und Empirismus 110 5.4 Die Auseinandersetzung um die Lehre von den angeborenen Ideen 113 5.5 Apriorische Erkenntnis 116 5.6 Kant und das Problem des synthetischen Apriori 118 5.7 Das Kausalitätsproblem: David Hume und Kant 120 5.8 Kants „kopernikanische Wende" 125 5.9 Kants Unterscheidung zwischen „Ding an sich" und „Erscheinung" 129 5.10 Kants Ethik der Vernunft im Vergleich 132 5.11 Die Begründung der Ästhetik: Alexander Gottlieb Baumgarten und Kant 137 5.12 Die Hinwendung zum Menschen 146 5.13 Witz und Genie: Aufklärung, Klassik und Romantik 149 5.14 Malerei und Dichtung: Gotthold Ephraim Lessing 157 5.15 Philosophie der Sprache: John Locke, Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt 162 6 Deutscher Idealismus und Romantik 172 7 Kritiker des Deutschen Idealismus 182 7.1 Philosophen des Witzes und Philosophen des Scharfsinns: Jakob Friedrich Fries 182 7.2 Philosophie als Bearbeitung der Begriffe: Johann Friedrich Herbart 185 7.3 Die Welt als Wille und Vorstellung: Arthur Schopenhauer 189 7.4 Übereinstimmung zwischen Denken und Sein: Friedrich Adolf Trendelenburg 197 7.5 Existentielle Denker 202 7.5.1 Subjektivität und Unaussagbarkeit: Soren Kierkegaard 202 7.5.2 Radikaler Egoismus: Max Stirner 205 8 Naturwissenschaft, Philosophie und Religion 209 8.1 Induktive Metaphysik: Hermann Lotze, Gustav Theodor Fechner und Wilhelm Wundt 209 8.2 Naturwissenschaft statt Philosophie 213 8.3 Ludwig Feuerbach und die Religionskritik 214 8.4 Der Materialismus von Karl Marx und Friedrich Engels 219 8.4.1 Engels und „die große Grundfrage" der Philosophie 219 8.4.2 Dialektischer und Historischer Materialismus 223 9 Die Rolle und der Status der Logik 228 9.1 Der Psychologismusstreit 229 9.2 Von der traditionellen zur modernen Logik: Gottlob Frege 238 10 Zurück zu Kant: Der Neukantianismus 249 11 Die Lebensphilosophie 253 12 Der Monismus 262 12.1 Der Monistenbund: Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald 262 12.2 Haeckel und Pierre Teilhard de Chardin 266 12.3 Das Philosophische Wörterbuch des weltanschaulichen Monismus: Heinrich Schmidt 267 12.4 Der erkenntnistheoretische Monismus: Ernst Mach 269 13 Erkenntnistheorie undLogik im Marxismus- Leninismus 272 14 Die sprachphilosophische Wende 277 14.1 Sprachkritik als Erkenntniskritik: Friedrich Nietzsche 279 14.2 Sprachskepsis: Fritz Mauthner 282 14.3 Dekonstruktion und Metaphorologie: Jacques Derrida und Hans Blumenberg 286 14.4 Gottlob Frege als Sprachphilosoph 291 14.5 Logischer Atomismus: Bertrand Russell 295 14.6 An den Grenzen der Sprache: Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus 299 14.7 Wittgensteins Selbstkritik in den Philosophischen Untersuchungen 304 14.8 Die normalsprachliche analytische Philosophie 305 15 Fiktionen und Fiktionalismus 309 15.1 Alexius Meinongs Gegenstandstheorie 309 15.2 Frege und der Erkenntniswert der Dichtung 313 15.3 Hans Vaihinger und die Philosophie des Als Ob 315 15.4 Fakten oder Fiktionen? Nelson Goodman und Hayden White 320 16 Der Positivismusstreit 324 16.1 Kritischer Rationalismus: Karl Popper 324 16.2 Kritische Theorie: Theodor W. Adorno 328 17 Analytische und kontinentale Philosophie: Die Carnap-Heidegger-Kontroverse 331 17.1 Das Realitätsproblem als Scheinproblem 333 17.2 Carnaps Metaphysikvorwurf und Heideggers Entgegnung 336 18 Schlussbetrachtungen: Die Philosophie zwischen Logik und Literatur 345 Literaturverzeichnis 348 Register 364 |
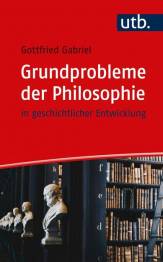
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen