|
|
|
Rezension
„Drei Frauen am Grab“(zwischen 984 und 994) im Sakramentar Bischof Abrahams von Freising, „Teppich von Bayeux“(vor 1082), „Kopfreliquar“(~1170) in der Kirche Cappenberg, „Tristan-Teppich“(~1300) in Kloster Wienhausen, „Trinitätsknoten“(~1310) aus dem Rotschild-Gebetbuch, „Kreuzigung“(~1457) von Rogier van der Weyden, „Die Versuchung des Müßiggängers oder: Der Traum des Doktors“(~1498) von Albrecht Dürer, „Kruzifixus“(~1504) von Tilman Riemenschneider, „White Flag“(1955) von Jasper Johns, „Filzanzug“(1970) von Joseph Beuys, „Armari“(1973) von Antoni Tàpies, „Sicherheitsverwahrung“(1978) von Sigmar Polke, „Pole Piece“(1996) von Louise Bourgeois und „THE Magic Carpet“(2012) von Pae White. Was verbindet diese Kunstwerke aus über 1000 Jahren miteinander? Alle diese Arbeiten haben Tücher – in unterschiedlichen kulturhistorischen Kontexten - zum Gegenstand.
Ikonologisch verglichen werden die oben aufgezählten Textilien und andere von Stefan Trinks (*1973) in seiner kunsthistorischen Habilitationsschrift, die 2024 bei Schirmer/Mosel unter dem Titel „Glaubensstoffe und Geschichtsgewebe. Belebte Tücher in der mittelalterlichen und modernen Kunst“ veröffentlicht wurde. Der Privatdozent am Institut für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin demonstriert mit seiner Studie, die mit 110 Farbabbildungen versehen ist, dass er ein ausgewiesener Experte christlicher Ikonographie ist. Tücher und Knoten auf Kunstwerken dien(t)en im Mittelalter und in der Moderne ab den 1960er Jahren als Symbole für bestimmte Geschichtsdarstellungen. Lehrkräfte der Fächer Bildende Kunst, Geschichte und Religion werden durch die vorliegende wissenschaftliche Monographie motiviert, sich in ihrem Unterricht mit christlicher Ikonographie problemorientiert auseinanderzusetzen. Fazit: Stefan Trinks schließt mit seiner Arbeit „Glaubensstoffe und Geschichtsgewebe“ eine wichtige Forschungslücke in der Kunstgeschichte; zugleich zeigt er anhand seiner Untersuchung auf, welche Bedeutung belebten Tüchern in der Kulturgeschichte für die Tradierung bestimmter Geschichtsauffassungen zukam. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Stefan Trinks (geb. 1973) widmet seine grundlegende Studie dem Thema des gewebten Textils als Träger und Symbol von und für Geschichtsdarstellungen. Beginnend mit der Buchmalerei des späten 10. Jahrhunderts zeichnet Trinks zunächst die ikonographische Entwicklung der Grabtuchdarstellungen in Auferstehungsszenen der Buchmalerei nach, bevor er über die Lendentücher mittelalterlicher Kruzifixe zu Gewand- und Textildarstellungen am Anfang der Renaissance wandert. Diese Expedition zu immer autonomeren Formen textiler Symbolik unterfüttert er mit mythologischen und etymologischen Zusammenhängen zwischen Stoff und Geschichtsschreibung und erweitert so zusätzlich deren ikonographische Deutungsmöglichkeiten. Im vermehrten Aufkommen der sogenannten Tüchleinmalerei im späten 15. Jahrhundert sieht er letztlich die konsequente Weiterführung dieser Thematik, und zwar in der Loslösung des Bildes von festen, immobilen Trägern hin zum nun selbst schwebenden Gewebe. Bis in die heutige Zeit kann Trinks die Relevanz seiner Beobachtungen, nicht zuletzt auch für das Bild der digitalen Vernetzung, überzeugend vermitteln. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
I. Das Schwebender Knoten 9 I. DIE FORMEN DER KNOTEN a Der eine Knoten im Grab 14 b Die zwei Knoten, Schlaufen und das Grab 17 c Die Knoten der Muttergottes 29 2. DAS STELLVERTRETEN DES ABSENTEN a Die Hausbesuche des Freigängers 55 b Der salomonische Knoten als Grabsiegel 61 c Die Knoten der Unendlichkeit 69 3. DIE KNOTEN DER TRINITÄT a Der Knoten des Gekreuzigten 77 b Das Grab als Trinitätsort 84 c Die Rothschild-Canticles als Trinitätsknotenschrift 87 II. Der Stoff der Geschichte L DAS VERWEBEN DER BILDGESCHICHTE a Die Form der Ikonographie 99 b Synkretismus als Chance 107 c Die Vertreibung als Kulturemanzipation 109 2. DER WEBSTUHL DER GESCHICHTE a Der Histor als Geschichtsmaschine 114 b Dante und die Historientuchreliefs 117 c Die Intermedialität des Geschichtsgewebes 120 3. DIE METAMORPHOSEN DER HÜLLEN a Arachne und die neue Eva 126 b Wickram und der Metamorphose-Christus 130 c Die historisierten Webtuchreliefs der neuen Evas 135 UL Tuch als Bild I. DIE BEFREIUNG DER TÜCHER a Tüchlein, Tüchlein an der Wand: Das autonome Bild auf Leinen 153 b Die Tücher des Nordens: Bouts und Massys 161 c Die Revolution im Süden: Mantegna 170 2. DAS NACHSCHWEBEN DER TÜCHER a Die Schwebebilder der Sechziger 183 b Die Skulpturalknoten von Täpies 186 c Die Stoffbilder des Sigmar Polke 192 3. BLICK ZURÜCK UND IN DIE ZUKUNFT: LEVITATIONEN a Das webende Kind der Arachne: Louise Bourgeois 200 b Die Erleichterung der Skulptur oder Digitalisierung und Virtualisierung materieller Knoten 207 LITERATUR 213 |
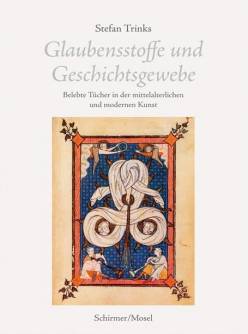
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen