|
|
|
Umschlagtext
"Geschichtsschreibung auf höchstem Niveau."
Volker Ullrich, Tages-Anzeiger In einem grandiosen Panorama erzählt Heinrich August Winkler zum ersten Mal überhaupt die Geschichte des Westens – und damit auch die Geschichte unserer eigenen Identität. Heinrich August Winkler, geb. 1938 in Königsberg, ist einer der bedeutendsten deutschen Historiker. Bis 2007 war er Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Bei C.H.Beck ist von ihm zuletzt erschienen: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945 (2011) und Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert (2012). Rezension
Wer die eigene Welt verstehen will, muss ihre (Entstehungs-)Geschichte verstehen. Das gilt auch für den Teil der Welt, in dem wir leben; denn unsere "westliche" Weltwahrnehmung ist nicht zwingend deckungsgleich mit Weltwahrnehmungen aus anderen Kulturkreisen, sei es nun aktuell (März 2014) die Krim-Krise oder das "Verschwinden" eines großen Passagier-Flugzeugs wie in Malaysia ... Das hier anzuzeigende voluminöse Werk mit (netto) 1200 S., das als preisgünstige Jubiläums-Edition anläßlich des 250. Geb. des C.H.Beck-Verlags aus München in dieser Form neu aufgelegt wird, bietet erstmals eine umfassende "Geschichte des Westens" (Titel) "von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert" (Untertitel) und damit eine kompakte Zusammenfasung all der vielfältigen geschichtlichen Entwicklungen (vgl. das umfangreiche Inhaltsverzeichnis!), die für unseren eigenen Kulturkreis von zentraler Bedeutung sind. (Gegenüber der Leinen-Ausgabe von 2009, ISBN 9783406592355, mit einem Preis von 39,95 € ist diese Ausgabe fast Preis-halbiert).
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung 13
Einleitung 17 1. Die Entstehung des Westens: Prägungen eines Weltteils Monotheismus als Kulturrevolution: Der östliche Ursprung des Westens 25 Das frühe Christentum: Ein religiöser Schmelztiegel 30 Ein Gott, ein Kaiser 35 Zwei Kaiser, ein Papst 40 Translatio imperii: Der Reichsmythos 46 Christianisierung und Kreuzzüge 47 Geistliche versus weltliche Gewalt: Die Papstrevolution und ihre Folgen 52 «Stadtluft macht frei»: Die Entstehung des Bürgertums 61 Feudalismus und beginnende Nationalstaatsbildung: Der Geist des Dualismus 64 Verhinderte Weltherrschaft: Krise und Niedergang des Reiches 72 Individualität versus Institution: Beginnende Selbstsäkularisierung des Christentums 75 Im Zeichen des Schismas: Der Verfall der kirchlichen Einheit 78 Europa im Umbruch (I): Binnen- und Außengrenzen des Okzidents 83 Europa im Umbruch (II): Renaissance und Humanismus 93 Judenverfolgung und Hexenverbrennungen: Die Widersprüche der spätmittelalterlichen Gesellschaft 104 2. Der alte und der neue Westen: Von Wittenberg nach Washington Luthertum und Calvinismus: Das neue Staatskirchentum 111 Dreißigjähriger Krieg und europäischer Friede 119 Nachdenken über den Staat: Vom Humanismus zu Hobbes 126 Von der puritanischen Revolution zur Glorious Revolution 142 Der Absolutismus und seine Grenzen 154 Hegemonie und Gleichgewicht nach 1648 157 Gewaltenteilung und allgemeiner Wille: Von Locke zu Rousseau 175 Kritik des Bestehenden: Die Aufklärung und ihre Grenzen 226 Aufgeklärter Absolutismus: Anspruch und Wirkung 235 Absolutismus in der Krise: Frankreichs Weg in die Revolution 244 Wirtschaftliche Umwälzung: Die Industrielle Revolution in England 254 Politische Umwälzung: Die Amerikanische Revolution 259 Europa am Vorabend der Französischen Revolution 310 3. Revolution und Expansion: 1789–1850 1789: Das Ende des Ancien régime und der Beginn der Französischen Revolution 315 Radikalisierung (I): Von der konstitutionellen Monarchie zur Republik 322 Gespaltenes Echo: Die Rezeption der Revolution in Deutschland und England 338 Radikalisierung (II): Die Revolution zwischen Krieg und Schreckensherrschaft 350 Prekäre Stabilisierung: Thermidor und Direktorium 367 Vom Ersten Konsul zum Kaiser: Napoleon Bonaparte 374 Das Grand Empire und das Ende des Alten Reiches 385 Lernen aus der Niederlage: Die preußischen Reformen 393 Fichte, Jahn, Arndt: Die Entstehung des deutschen Nationalismus 398 Großbritannien, die USA und die Kontinentalsperre 408 Napoleon im Niedergang: Von der spanischen «guerilla» zum Rußlandkrieg 412 Vom Tauroggen bis Elba: Napoleons erster Sturz 420 Die «Charte» und die «Hundert Tage»: Napoleons endgültiger Sturz 425 Konservative, Liberale, Sozialisten: Die nachrevolutionäre Ideenwelt 431 Rückkehr zum Gleichgewicht: Der Wiener Kongreß 443 Unterdrückung und Wandel: Die großen Mächte nach 1815 451 Revolutionen im Mittelmeerraum: Spanien, Portugal, Italien, Griechenland 469 Die Befreiung Lateinamerikas 484 Großmacht USA: Von Monroe bis Jackson 492 Tocqueville in Amerika: Das Zeitalter der Gleichheit 502 Die französische Julirevolution von 1830 508 Folgerevolutionen: Europa in den frühen 1830er Jahren 515 Reform statt Revolution: Großbritannien 1830–1847 530 Wandel in Preußen: Zollverein und Thronwechsel 539 Orient und Rhein: Die Doppelkrise von 1840 542 Hungry fourties: Die Entstehung des Marxismus 545 Europa am Vorabend der Revolution von 1848 552 Das Ende der Julimonarchie 560 Die Märzrevolutionen in Deutschland 570 Revolution und Konterrevolution im östlichen Mitteleuropa 580 Die Revolution in Italien 591 Ordnung vor Freiheit: Frankreichs Zweite Republik bis zum Frühjahr 1849 595 Weder Einheit noch Freiheit: Die deutsche Revolution von 1848/49 606 Die Niederwerfung der Revolutionen in Italien und Ungarn 628 Wandel ohne Revolution: Nord- und Nordwesteuropa 634 Verselbständigung der Exekutivgewalt: Frankreich auf dem Weg ins Zweite Kaiserreich 640 Von Erfurt nach Olmütz: Preußens gescheiterte Unionspolitik 647 Rückblick auf die Revolution (I): Deutschland 654 Rückblick auf die Revolution (II): Europa 660 Wandernde Grenzen: Die Westexpansion Amerikas im internationalen Vergleich 672 4. Nationalstaaten und Imperien: 1850–1914 Materialismus versus Idealismus: Die geistige Wende in der Mitte des 19. Jahrhunderts 687 West versus Ost: Der Krimkrieg und die Folgen 690 Der Westen in Asien: Indien, China, Japan 699 Von der Reaktionszeit zur «Neuen Ära»: Der Regimewechsel in Preußen 710 Ein Nationalstaat entsteht: Die Einigung Italiens 714 Kursänderungen: Die deutschen Großmächte 1859–1862 725 Reform und Expansion: Rußland unter Alexander II 733 Sezession: Der amerikanische Bürgerkrieg 740 Revolution von oben: Das Ende des deutschen Dualismus 757 Bonapartismus in der Krise: Frankreichs Zweites Kaiserreich 1866–1870 781 Anpassung durch Reform: England in den 1860er Jahren 789 Vom Norddeutschen Bund zur Reichsgründung: Deutschland 1867–1871 798 Nach der Niederlage: Die Anfänge der Dritten Republik in Frankreich 817 Kulturkampf: Staat und Kirche im Widerstreit 825 Ein gespaltener Nationalstaat: Italien nach der Einigung 829 Kampf den Reichsfeinden: Deutschland nach der Reichsgründung 833 Der Alpdruck der Koalitionen: Bismarcks Europa 852 Imperialismus (I): Von Disraeli zu Gladstone 860 Imperialismus (II): Die Aufteilung Afrikas 873 Befestigungsversuche: Deutschland in den 1880er Jahren 895 Die opportunistische Republik: Frankreich zwischen Reform und Krise 906 Rechtsruck und Anarchismus: Das Italien der Ära Crispi 913 Reaktion, Radikalismus, Revolution: Rußland 1881–1906 919 Pionierland der Moderne: Amerika vor und nach der Jahrhundertwende 939 Transnationale Moderne: Die Ungleichzeitigkeit des Fortschritts (I) 983 Zerreißproben: Die innere Entwicklung der Donaumonarchie 1017 Der Fluch des Epigonentums: Das wilhelminische Deutschland 1890–1909 1029 Abschied von der «splendid isolation»: Großbritannien 1886–1914 1049 Die radikale Republik: Frankreich zwischen Antisemitismus und Laizismus 1069 Demokratisierung und Expansion: Italien in der Ära Giolitti 1099 Von Barcelona bis Basel: Die Ungleichzeitigkeit des Fortschritts (II) 1111 Repression und Avantgarde: Rußland 1906–1914 1131 Krieg als Krisenlösung? Das wilhelminische Deutschland 1909–1914 1148 Sarajewo und die Folgen: Von der Julikrise zum Ersten Weltkrieg 1163 Der Westen zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Rückblick und Ausblick 1189 Anhang Abkürzungsverzeichnis 1203 Anmerkungen 1205 Personenregister 1287 Ortsregister 1323 Einleitung Nicht nur Bücher, auch Begriffe haben ihre Schicksale. Der Begriff «Westen», wenn er politisch oder kulturell gemeint ist, macht da keine Ausnahme: Er hat zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches bedeutet. Das klassische Griechenland bedurfte der Erfahrung der Perserkriege in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus, um eine Vorstellung vom kulturellen und politischen Gegensatz zwischen Griechen und «Barbaren», Abendland (dysmaí oder hespéra) und Morgenland (anatolé), Okzident und Orient zu entwickeln. Im christlichen Europa meinte Okzident oder Abendland den Bereich der Westkirche, das lateinische im Unterschied zum griechischen, das heißt byzantinischen Europa. Vom «Westen» als einer transatlantischen Einheit war vor 1890 kaum je die Rede. Erst die Erfahrung der kulturellen und politischen Gleichrangigkeit Europas und Nordamerikas ließ diesen Begriff um die Jahrhundertwende vor allem in der angelsächsischen Welt zum Schlagwort aufsteigen. Es mußte damals noch mit einem anderen, häufiger gebrauchten Begriff, dem der «weißen Rasse», konkurrieren, war aber zugleich enger und weiter als dieser: enger, weil der «Westen» den als rückständig empfundenen russischen und balkanischen Osten Europas ausschloß, weiter, weil die Zugehörigkeit zur «westlichen Zivilisation » nicht an rassische Merkmale gebunden wurde.1 Für die tonangebenden Intellektuellen eines westlichen Landes, Deutschlands, unter ihnen Thomas Mann in seinen «Betrachtungen eines Unpolitischen» von 1918, wurde der Begriff «Westen» im Ersten Weltkrieg zu einem negativ besetzten Kampfbegriff.2 Der Westen in Gestalt Frankreichs, Großbritanniens und, seit ihrem Kriegseintritt im Jahre 1917, der Vereinigten Staaten von Amerika, stand für das, was sie ablehnten, nämlich demokratische Mehrheitsherrschaft und eine vermeintlich rein materialistische Zivilisation. Deutschland hingegen vertrat aus der Sicht seiner geistigen Verteidiger die höheren Werte einer Kultur der Innerlichkeit – einer Kultur, die sich auf die Macht eines starken Staates stützen konnte. Die deutschen «Ideen von 1914» gegen die westlichen «Ideen von 1789»: In vielen Köpfen überlebte dieser Gegensatz die Niederlage von 1918. Erst nach der abermaligen Niederlage des Deutschen Reiches im Jahre 1945 vollzog sich im westlichen Teil Deutschlands jene Entwicklung, in der der Philosoph Jürgen Habermas 1986, auf dem Höhepunkt des «Historikerstreits» um die Einzigartigkeit des nationalsozialistischen Judenmordes, die größte intellektuelle Leistung der zweiten deutschen Nachkriegszeit sah: «die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens».3 Im Zeichen des Kalten Krieges wurde der «Westen» zur Kurzformel für das atlantische Bündnis: die Allianz der beiden großen Demokratien Nordamerikas, der USA und Kanadas, mit anfangs zehn, später vierzehn Staaten auf der anderen Seite des Atlantiks, darunter seit 1955 die Bundesrepublik Deutschland. Nicht alle Mitglieder der NATO waren zu jeder Zeit Demokratien. Portugal war bis 1974 eine rechtsautoritäre Diktatur; Griechenland und die Türkei wurden zeitweise unmittelbar oder mittelbar vom Militär regiert. Trotz solcher Abweichungen von der Regel sah sich der Atlantikpakt stets als Bündnis zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte gegenüber der Bedrohung durch die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Pakts – also nicht nur als Militärallianz, sondern als Wertegemeinschaft. Nach der Epochenwende von 1989/91 änderte sich die Bedeutung des Begriffs «Westen» erneut. Das Ende der kommunistischen Diktaturen machte den Blick frei für geographische und historische Tatsachen, die in der Zeit des Ost-West-Konflikts weithin in Vergessenheit geraten waren. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wäre kaum jemand auf den Gedanken gekommen, Polen, die Tschechoslowakei (beziehungsweise die in diesem Staat zusammengeschlossenen Gebiete) oder Ungarn «Osteuropa» zuzurechnen; «Mitteleuropa» oder, genauer, «Ostmitteleuropa » waren und sind die zutreffenden Bezeichnungen. Der Begriff «Osteuropa» war Rußland bis zum Ural,Weißrußland und der Ukraine vorbehalten. Historisch gehören das östliche Mitteleuropa, das Baltikum und der Westen der Ukraine zum «Okzident» oder «Abendland», also zu jenem Teil des Kontinents, der seinen gemeinsamen geistlichen Mittelpunkt bis zur Reformation in Rom gehabt hatte und der sich eben dadurch vom orthodox geprägten Ost- und Südosteuropa unter- 18 Einleitung schied. Es ist dieser historische Westen, der im Mittelpunkt unserer Betrachtung steht. «Europa ist nicht (allein) der Westen. Der Westen geht über Europa hinaus. Aber: Europa geht auch über den Westen hinaus»: Auf diese knappe Formel hat der Wiener Historiker Gerald Stourzh das Verhältnis zwischen Europa und dem Westen gebracht.4 Was den außereuropäischen Teil des Westens betrifft, so gehören unstrittig die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland, also die ganz oder überwiegend englischsprachigen Demokratien, und, seit seiner Gründung im Jahr 1948, der Staat Israel dazu. In Europa liegen die Dinge komplizierter. Die Frage, wie es dazu kam, daß nicht ganz Europa dem Westen zuzurechnen ist, führt zurück in die Zeit, die der historischen Spaltung in eine West- und eine Ostkirche vorausging. Diese Frage ist nicht bloß von historischem Interesse. Denn sie zielt auf kulturelle Prägungen, die Europa einmal verbunden haben und von denen noch vieles nachwirkt. Die stärkste dieser gemeinsamen Prägungen ist religiöser Natur: die christliche. Im Zuge der fortschreitenden Entkirchlichung und Entchristlichung Europas ist eine solche Feststellung alles andere als selbstverständlich. Erklärten Laizisten könnte sie sogar als ein Versuch erscheinen, die Säkularisierung in Frage zu stellen und ihr Einhalt zu gebieten. In Wirklichkeit ist es gerade der spezifische, ja weltgeschichtlich einzigartige Charakter des westlichen Säkularisierungsprozesses, der uns veranlassen sollte, den religiösen Bedingungen dieser Entwicklung nachzugehen. Vom christlichen Erbe Europas und des Westens läßt sich aber nicht sinnvoll reden, wenn wir nicht zuvor vom jüdischen Erbe des Christentums gesprochen haben. Zum jüdischen Erbe gehört zentral der Monotheismus. Dieser hat eine Vorgeschichte, die über das Judentum hinausweist: in das Ägypten des 14. Jahrhunderts vor Christus. Mit der Entstehung des Monotheismus müssen wir also einsetzen, wenn wir wissen wollen, wie derWesten zu dem wurde, was er heute ist. Von diesem Ausgangspunkt gilt es fortzuschreiten zu jener spezifisch christlichen Unterscheidung zwischen göttlicher und weltlicher Ordnung, in der die Säkularisierung der Welt und die Emanzipation des Menschen bereits angelegt sind. Der klassische Beleg dieser Unterscheidung ist das Wort von Jesus: «Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.»5 Von diesem Aufruf bis zur ansatzweisen Trennung von geistlicher Einleitung 19 und weltlicher Gewalt im Investiturstreit des späten 11. und frühen 12. Jahrhunderts verging über ein Jahrtausend. Die Unterscheidung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt erscheint im historischen Rückblick als Keimzelle der Gewaltenteilung überhaupt, als Freisetzung von Kräften, die sich erst durch diese Trennung voll entfalten und weiter ausdifferenzieren konnten. Der ersten Gewaltenteilung folgte, beginnend mit der englischen Magna Charta von 1215, eine zweite: die Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt, wobei die letztere in der Folgezeit von Adel, Geistlichkeit und städtischem Bürgertum ausgeübt wurde. Beide mittelalterlichen Gewaltenteilungen blieben auf den Raum der Westkirche beschränkt. Im Bereich der Ostkirche fehlte der Dualismus zwischen Papst und Kaiser beziehungsweise König; die geistliche Gewalt blieb der weltlichen untergeordnet; es gab keine Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt; es entwickelte sich, anders als im Westen, kein wechselseitiges Treueverhältnis zwischen Landesherr und Feudaladel, keine Stadtfreiheit und kein selbstbewußtes städtisches Bürgertum und infolgedessen auch keine Tradition individueller und korporativer Freiheit. Die Geschichte des Westens ist keine Geschichte des ununterbrochenen Fortschritts in Richtung auf mehr Freiheit. Die Reformation des 16. Jahrhunderts brachte einerseits einen gewaltigen Zugewinn an Freiheit, indem sie das Gewissen des Einzelnen zur höchsten moralischen Instanz erhob. Andererseits brachte sie in Gestalt des lutherischen und des anglikanischen Staatskirchentums erhöhten obrigkeitlichen Zwang, ja einen Rückfall hinter die bereits erreichte ansatzweise Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt und hinter die religiöse Toleranz, für die sich die Humanisten eingesetzt hatten. Im anglikanischen England rief die FreiheitsbeschränkungWiderstand hervor: den protestantischen Protest calvinistischer Nonkonformisten. Aus ihm entwickelte sich eine demokratische Bewegung, die auf der anderen Seite des Atlantiks, in den amerikanischen Kolonien der britischen Krone, so stark wurde, daß der neue Westen, Amerika, schließlich die Revolution gegen das Mutterland wagen konnte. Im alten Westen war England freilich immer noch das freieste unter den größeren Ländern Europas. Hier wurde die mittelalterliche Gewaltenteilung zwischen fürstlicher und ständischer Gewalt weiterentwickelt zur modernen Gewaltenteilung, der Trennung von gesetzgebender, vollziehender und rechtsprechender Gewalt – der Gewaltenteilung, die 1748 in 20 Einleitung Montesquieus «Geist der Gesetze» ihren klassischen Ausdruck fand. Zusammen mit den Ideen von den unveräußerlichen Menschenrechten, der Herrschaft des Rechts und der repräsentativen Demokratie gehört die Gewaltenteilung zum Kernbestand dessen, was wir als das normative Projekt des Westens oder die westliche Wertegemeinschaft bezeichnen können. Dieses Projekt war keine reine Neuschöpfung des Zeitalters der Aufklärung. Vielmehr hatte es, wie die Aufklärung selbst, Wurzeln, die tief in die Geschichte des Westens, bis ins Mittelalter und die Antike, zurückreichen. Das Projekt des Westens war auch kein rein europäisches Werk, sondern das Ergebnis transatlantischer Zusammenarbeit: Die ersten Menschenrechtserklärungen wurden, beginnend mit der Virginia Declaration of Rights vom 12. Juni 1776, auf britischem Kolonialboden in Nordamerika beschlossen und verkündet. Sie beeinflußten auf das stärkste die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die französische Nationalversammlung am 26. August 1789. Seit den beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der Amerikanischen Revolution von 1776 und der Französischen Revolution von 1789, war das Projekt des Westens im wesentlichen ausformuliert. Der Westen hatte einen Maßstab, an dem er sich messen konnte – und messen lassen mußte. Bis sich der gesamte Westen zu diesem Projekt bekannte, vergingen zwei Jahrhunderte. Die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bestand zu einem großen Teil aus Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung der Ideen von 1776 und 1789. Es gab viele Auflehnungen westlicher Länder gegen die Ideen der Amerikanischen und der Französischen Revolution, geboren aus dem Geist des Nationalismus, der in vieler Hinsicht selbst ein Phänomen der westlichen Moderne war, darunter die radikalste dieser Auflehnungen, die deutsche, die im Nationalsozialismus gipfelte. Und es gab die Länder Ostmitteleuropas, die erst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989/90 wieder die Möglichkeit erhielten, sich im westlichen Sinn zu entwickeln. Die Verwestlichung des Westens war mithin ein Prozeß, dessen hervorstechendes Kennzeichen die Ungleichzeitigkeit bildet. Nicht minder markant ist ein anderes Merkmal der Entwicklung des Westens seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert: der Widerspruch zwischen dem normativen Projekt und der politischen Praxis. Unter den Verfassern der ersten Menschrechtserklärungen und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 waren Sklavenbesit- Einleitung 21 zer. Hätten die Gegner der Sklaverei auf deren Abschaffung bestanden, wäre die erstrebte Loslösung der 13 Kolonien vom englischen Mutterland daran gescheitert. Das Gründungsversprechen aber war ein revolutionäres: Wenn die Unabhängigkeitserklärung allen Menschen bescheinigte, sie seien frei geboren und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden, dann wurde die Sklaverei erst recht zum Skandal und der Kampf um ihre Aufhebung und das Verbot des Sklavenhandels zur historischen und normativen Notwendigkeit. In diesem langwierigen Kampf zeigte sich, daß das Projekt am Ende stärker war als die Praxis: So zynisch der Westen sich gegenüber der nichtwestlichen Welt meist verhielt, so besaß er doch die Fähigkeit zur Selbstkritik, zur Korrektur seiner Praxis und zurWeiterentwicklung seines Projekts. Die afroamerikanischen Sklaven waren nicht die einzige Gruppe, der unveräußerliche Rechte vorenthalten wurden. Die Ureinwohner Nordamerikas und Australiens wurden an den Rand der physischen Ausrottung getrieben. Aber auch Teile der weißen Bevölkerung waren anhaltender Diskriminierung ausgesetzt. Es dauerte lange, bis die volle Gleichberechtigung der Frauen durchgesetzt war, und auch bei den Arbeitern waren staatsbürgerliche Rechte und ein menschenwürdiges Dasein erst das Ergebnis schwerer, oft gewaltsam ausgetragener Konflikte. Beide, die Frauen und die Arbeiter, konnten sich bei dem, was sie forderten, auf die Verheißungen von 1776 und 1789 berufen: Ideen, aus denen sich Waffen im Kampf gegen eine widerstrebende Wirklichkeit schmieden ließen. Die Entstehung des westlichen Projekts, die Ungleichzeitigkeit seiner Verwirklichung, die Widersprüche zwischen Projekt und Praxis: Mit diesen Stichworten sind die Leitlinien der vorliegenden Darstellung umrissen. Sie will keine «histoire totale», sondern eine Problemund Diskursgeschichte sein: ein Versuch, die Hauptprobleme der europäischen und der nordamerikanischen Geschichte sowie das Nachdenken über sie in ihrem atlantischen oder westlichen Zusammenhang zu erörtern. Von den nichtwestlichen Ländern bezieht die Darstellung Rußland am stärksten mit ein: Das Zarenreich und später die Sowjetunion wurden durch den Westen ebenso beeinflußt, wie sie ihrerseits den Westen beeinflußten. Je mehr westliche Mächte im Zeitalter des Imperialismus die übrige Welt ihrer formellen oder informellen Herrschaft unterwarfen, desto mehr müssen auch diese anderen Teile der 22 Einleitung Erde ins Blickfeld rücken. Eine «Globalgeschichte» erwächst daraus aber nicht, höchstens ein Beitrag zu einer solchen. Als Max Weber 1920 seine berühmte Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie verfaßte, arbeitete er bestimmte Kulturerscheinungen heraus, die er nur im Okzident vorfand und als typisch westlich charakterisierte: eine empirisch vorgehende Wissenschaft, die rationale harmonische Musik, den strengen Schematismus des okzidentalen Rechts, das Fachmenschentum, die schrankenlose Erwerbsgier des modernen Kapitalismus, die Trennung von Haushalt und Betrieb, die rationale Buchführung, das abendländische Bürgertum, die Organisation freier Arbeit und die Entstehung eines rationalen Sozialismus. Der gemeinsame Nenner war der spezifisch okzidentale Rationalismus, der sich in einer praktisch-rationalen, namentlich in einer wirtschaftlich rationalen Lebensführung niederschlug.6 Webers Analyse erfaßte bestimmte Facetten des Modernisierungsprozesses, den alle von Industrie und Bürokratie geprägten Gesellschaften desWestens durchlaufen hatten und zum Teil noch durchliefen. Von den normativen und politischen Errungenschaften des Westens aber war bei ihm bemerkenswerterweise nicht die Rede: weder von den Menschen- und Bürgerrechten noch von der Gewaltenteilung, der Volkssouveränität oder der repräsentativen Demokratie. Diese Kulturerscheinungen bildeten nach Webers Meinung offenbar keine typischen Merkmale des Okzidents – eine sehr deutsche und damals schon nicht mehr zeitgemäße Sichtweise. Heute gibt es erst recht gute Gründe, die Entwicklung der normativen Maßstäbe, einer selbstkritischen politischen Kultur und einer pluralistischen Zivilgesellschaft in den Mittelpunkt einer Geschichte des Westens zu rücken. Das geschieht in dieser Darstellung, während manche andere der von Weber aufgeführten Kulturerscheinungen in den Hintergrund treten. Die Entscheidung für eine Problem- und Diskursgeschichte erfordert eine Schwerpunktbildung, deren notwendiges Gegenstück mehr oder minder weitgehende Ausblendungen sind. Der vorliegende Band endet mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. ... |
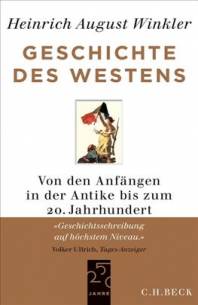
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen