|
|
|
Umschlagtext
„Ein großes Werk für unsere Zeit!“
Richard Kämmerlings, DIE WELT Dieses monumentale Werk bietet die erste Gesamtdarstellung der Völkerwanderungszeit – jener Epoche zwischen den Epochen – von der Mitte des 3. Bis zur Mitte des 8. Nachchristlichen Jahrhunderts. Es ist eine ebenso spannende wie umfassende Geschichte der spätantik-frühmittelalterlichen Welt und erhellt die Entwicklungen im späten Imperium Romanum ebenso wie in den nachrömischen Herrschaftsbildungen im Westen, im frühen Byzantinischen Reich sowie im frühen islamischen Kalifat bis zum Ende der Umayyadenzeit (750). Rezension
Welche Völker waren Teil der Völkerwanderung in Europa, Asien und Afrika? Lässt sich ein Ende dieser Migrationsbewegungen, die Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus einsetzen, auf das Ende der Umayyadenzeit 750 datieren? Welche Binnenperiodisierungen der Epoche der Völkerwanderung sind sinnvoll? Warum spricht man vom „Hunnensturm“? Worauf beruhte die Macht von Attila? Wann ist das Weströmische Reich untergegangen? Welches waren die poströmischen Reiche im Westen des Römischen Reiches? Wie war das Vandalenreich strukturiert? Welche Konflikte gab es zwischen dem Byzantinischen Reich und anderen Völkern? Trug die Liturgisierung in Byzanz zur Entstehung des Islam bei?
Fundierte Antworten auf diese Fragen zur Welt des Übergangs von der Spätantike zum Frühmittealter erfährt man durch die Lektüre des Buches „Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr.“, erschienen 2017 bei C.H. Beck in der Reihe „Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung“. Das mehr als 1500 Seiten umfassende monumentale Werk stammt von Mischa Meier (*1971), Professor für Alte Geschichte an der Eberhard Karls Universität Tübingen. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Historiker gilt als Experte für spätantike Geschichte; Bekanntheit erlangte er durch seine Forschungen zu Justinian. Für seine Gesamtdarstellung der Völkerwanderung, an der er zehn Jahre arbeitete und die 2021 bereits die siebte Auflage erreichte, erhielt Meier den höchsten deutschsprachigen Sachbuchpreis, den „WISSEN!-Sachbuchpreis der wbg“. Meiers Opus magnum zeichnet sich aus durch souveräne Auswertung der historischen Quellen unter Berücksichtigung einer immensen Forschungsliteratur, durch differenzierte historische Urteilsbildung, durch tiefsinnige Reflexionen über die Erschließung des komplexen Gegenstands sowie durch eine gut verständlich gewählte Sprache. Der Althistoriker nimmt Leser:innen mit auf eine faszinierende Reise durch die Transformationsprozesse von der Spätantike bis zum Frühmittelalter. Seine Forschungsergebnisse bieten genügend Belege dafür, die Epoche der Spätantike auszudehnen über das Ende des 5. Jahrhunderts hinaus. Gekonnt widerlegt er den historischen Mythos der Römer-Barbaren-Dichotomie. Meier kann überzeugend nachweisen, dass ein zentrales Charakteristikum der Epoche der Völkerwanderung exzessive Gewaltausbrüche waren, verübt vielfach durch Warlords. Mit seinem herausragenden Werk leistet Meier einen wichtigen Beitrag zur historischen Bildung über eine Zeit, die im schulischen Geschichtsunterricht oftmals ausgeblendet wird. Geschichtslehrkräfte werden durch den vorliegenden Band besonders motiviert, sich in ihrem Fachunterricht oder in einem fächerübergreifenden Projekt zur Geschichte der Migration mit der Völkerwanderung problemorientiert auseinanderzusetzen. Fazit: Mischa Meier ist mit seiner exzellenten „Geschichte der Völkerwanderung“ ein historisches Meisterwerk gelungen, dass allen an Migrationsgeschichte Interessierten nur zur Anschaffung empfohlen werden kann. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Geschichte der Völkerwanderung EUROPA, ASIEN UND AFRIKA VOM 3. BIS ZUM 8. JAHRHUNDERT N.CHR. Mischa Meier erhält WISSEN!-Sachbuchpreis der wbg Byzanz, 29. Juli 626 - vor den Toren der prächtigsten Stadt Europas und Asiens hat der Khagan der Awaren 80.000 Krieger zusammengezogen und verlangt ihre bedingungslose Übergabe. Für die Menschen in der Metropole steht fest, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist und die Mächte der Finsternis das apokalyptische Heer von Gog vor ihre Stadt geführt haben. Wie oft Menschen zwischen dem 3. und 8. Jahrhundert n. Chr. solch tödliche Furcht vor herandrängenden Heeren fremder Völker empfunden haben, zeigt Mischa Meier in seiner magistralen Darstellung der Völkerwanderungszeit. Sie beinhaltet die Geschichte des späten Imperium Romanum sowie die Geschichten der nachrömischen Herrschaftsbildungen im Westen, jene des frühen Byzantinischen Reiches, aber auch die des frühen islamischen Kalifats bis zum Ende der Umayyadenzeit (750). Reich an Informationen, stets verständlich und spannend zu lesen, führt sie den Leser von der europäischen und nordafrikanischen Atlantikküste bis zu den zentralasiatischen Knotenpunkten der Seidenstraße, nach Nordindien und zum Hindukusch, von Skandinavien und Britannien im Norden bis nach Arabien im Süden. Sie macht vertraut mit den dramatischen Ereignissen dieser Zeit und den damit einhergehenden tiefgreifenden Wandlungsprozessen. Ein wahres Opus magnum, das erstmals eine vollständige Geschichte der Epoche bietet. Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
I. ‹Völkerwanderung›: Forschungsobjekt und Darstellungsproblem 15 1.1 Barbaren vor Konstantinopel und Rom 15 1.1.1 Konstantinopel 626: Ein Wunder am Bosporus 15 1.1.2 Rom 410: Kein Wunder am Tiber 26 1.2 Was uns die Beispiele lehren, oder: Von den Schwierigkeiten, die ‹Völkerwanderung› zu erzählen 37 1.2.1 Die Hoheit über den Plot 37 1.2.2 Der Faktor Religion 39 1.2.3 Römer und Barbaren – wenn es denn so einfach wäre … 51 1.2.4 Römer und Barbaren – noch komplizierter … 61 1.2.5 Von der verführerischen Flexibilität des spätantiken Barbarenbegriffs: Drei Beispiele 74 1.2.6 Die Archäologie als Ausweg? 89 1.2.7 ‹Völker› und ‹Wanderung› – Ethnizität und Identität 99 1.2.8 ‹Osten› und ‹Westen› zwischen Spätantike und Mittelalter – Was dieses Buch will 116 II. Sturm an der Donau – Beginn der ‹Völkerwanderung› 125 2.1 Terwingen und Greutungen: Goten im 4. Jahrhundert 125 2.1.1 Konstantin I. macht Geschenke 125 2.1.2 Terwingen, Greutungen und das Problem der Cernjachow-Kultur – Rom und die Goten im 3. und 4. Jahrhundert 138 2.1.3 Wulfi la – Christen, Goten, Römer am Vorabend der Katastrophe 148 2.2 Der ‹Hunnensturm› 156 2.2.1 Rätselhafte Hunnen 156 2.2.2 Der Donauübergang der Goten und die römische Niederlage bei Adrianopel (378) 171 2.2.3 Konsolidierung unter Theodosius I. (379–395) 183 2.2.4 Irrwege zwischen den Reichsteilen: Alarich und die «werdenden Westgoten» (395–410) 191 III. Regni nostri maxima pars: Afrika – Verwundbare Südgrenze des Römischen Reiches 225 3.1 Am Rande der Wüste 225 3.2 Das Imperium entfernt sich 239 IV. Jenseits des Bosporus: Der Osten des Römischen Reiches 263 4.1 Der Aufstieg der Sasaniden, das strategische Dilemma Roms und die Araber 263 4.1.1 Ein Kaiser kommt der Welt abhanden 263 4.1.2 Bündnisse, Befestigungen, Allianzen mit den Söhnen der Wüste: Roms Antwort auf die sasanidische Bedrohung 276 4.2 Bedrohung und Konsolidierung 290 4.2.1 Herrscher und Hauptstadt: Das Kaisertum in Konstantinopel 290 4.2.2 Die Ausbildung eines ‹Hofes› in Konstantinopel 295 4.3 Erste Auseinandersetzungen mit den Hunnen im Osten 298 4.3.1 Der Hunnenkrieg des Jahres 395 298 4.3.2 Uldin und der erste römisch-hunnische Vertrag 302 V. Ringen um die Rheingrenze: Der Westen des Römischen Reiches 309 5.1 Zunehmende Unsicherheiten im 3. Jahrhundert 309 5.1.1 Ein verschütteter Feldzug tritt zutage 309 5.1.2 Falsch gestellte Frage: Woher kamen die Alemannen? 316 5.1.3 Die frühen Franken: Expansion statt Migration 325 5.2 Kampf um die Rheingrenze im 3. und 4. Jahrhundert 331 5.3 Insider und Outsider 361 5.4 Koexistenz und Konflikt 368 5.5 Zündeln am gallischen Scheiterhaufen 374 VI. Pax abiit terris: Ein Jahrhundert der Bürgerkriege 387 6.1 Des Kaisers neue Kleider 387 6.2 Der «letzte Römer» und die Hunnen 397 6.2.1 Die Hunnen zwischen Uldin und Ruga 397 6.2.2 Attila – Konfl ikt und Expansion 406 6.2.3 Attila – Das ‹Reich› 434 6.2.4 Attila – Kollaps 440 6.3 Agonie 471 6.3.1 Das weströmische Kaisertum im Todeskampf 471 6.3.2 Das oströmische Kaisertum unter Druck – Goten auf dem Balkan 479 6.3.3 Auf der Suche nach neuen Wegen 498 6.4 Das Projekt Italien 512 6.4.1 Odoaker und Theoderich 512 6.4.2 Das Ostgotenreich – (In-)Stabilität durch Konsens 515 VII. Manifester Kontrollverlust: Das Emergieren poströmischer regna im Westen des Römischen Reichs 545 7.1 Die Ansiedlung der Westgoten in Aquitanien 545 7.2 Das Rätsel der burgundischen Reichsbildungen 562 7.3 Auf dem Weg in das poströmische Gallien 573 7.3.1 Grenzen der Ereignisgeschichte 573 7.3.2 Konsolidierung und Expansion: Die Westgoten 580 7.3.3 Behauptung zwischen den Mächten: Die Burgunder 588 7.3.4 Neue Herren in Nordgallien: Die Franken 591 7.3.5 Verzicht auf Zentralisierung: Die Alemannen 605 7.3.6 Unbekannte Großmacht östlich des Rheins: Die Thüringer 607 7.3.7 Reichsgründung am Ende der Welt: Die Sueben 609 7.3.8 Niederlassungen, Machtbildungen, Reiche – Die politische Landkarte des (post-)römischen Westens um 500 611 7.3.9 Der ‹Tag von Tours› – Wege zur Konsolidierung neuer Herrschaften und regna 621 VIII. Quasi anima reipublicae – Afrika im 5. Jahrhundert 649 8.1 Geiserich und die Utopie eines regnum Vandalorum 649 8.1.1 Die Entstehung ‹der› Vandalen und die Eroberung Nordafrikas 649 8.1.2 Geiserichs Reich: Der Preis des Erfolgs 671 8.2 Geiserichs Nachfolger: Die Struktur des Vandalenreichs 685 8.2.1 Hunerich: Politik und Religion bei den Vandalen 685 8.2.2 Gunthamund: Wirtschaft im vandalenzeitlichen Nordafrika 698 8.2.3 Thrasamund: Das Problem einer vandalischen Identität 707 8.2.4 Hilderich: Risse und Brüche im vandalischen regnum 716 8.2.5 Gelimer: Das Ende 721 IX. Selbstbehauptung in Zeiten der Bedrohung: Der Osten des Imperium Romanum im 5. Jahrhundert 731 9.1 Perser und Hephthaliten 731 9.2 Römer und Perser: Ein folgenreicher Krieg (502–506) 743 9.3 Neue Verteidigungsstrategie im Osten 753 9.3.1 Bulgaren, Perser und Araber: Die Einigelung des Oströmischen Reiches um 500 753 9.3.2 Auf der Suche nach der eigenen Identität 766 9.4 Verwerfungen im Innern – die Eliten und die Religion 773 X. Die Partikularisierung des Westens im frühen Mittelalter 799 10.1 Osten und Westen um 500: «von fremd zu fremd» 799 10.2 Geschundenes Land: Italien in postgotischer Zeit 805 10.2.1 Das Ende des Ostgotenreichs 805 10.2.2 Langobarden in Italien 825 10.2.3 Erwachen in einer neuen Welt 846 10.3 Rasch erobert, nie gewonnen: Das postvandalische Nordafrika 852 10.4 Labile Herrschaft im zweiten Anlauf: Das westgotische Spanien 867 10.5 Instabile Stabilität: Das merowingische Frankenreich 895 10.5.1 Königtum ohne Monarchie 895 10.5.2 Von den Anfängen Bayerns 919 10.6 Im Hohlraum der Mythenbildung: Das poströmische Britannien 923 10.7 ‹Völkerwanderung› in Skandinavien? 949 XI. Ringen um Existenz und Einheit im Osten 953 11.1 Das 6. Jahrhundert: Vom Oströmischen zum Byzantinischen Reich 953 11.1.1 Kaiser und Katastrophe: Das Oströmische Reich im 6. Jahrhundert 953 11.1.2 Die frühen Slawen 974 11.1.3 Neue Akteure aus der Steppe: Die Awaren 994 11.2 Das 7. und 8. Jahrhundert: Doppelter Existenzkampf 1020 11.2.1 Byzanz und die Perser 1020 11.2.2 Folgen der Liturgisierung: Mohammed und die Entstehung des Islam 1035 11.2.3 Kaiser und Kalifen 1070 XII. Epilog: Die ‹Völkerwanderung› 1089 Anhang Abkürzungen 1107 Anmerkungen 1120 Quellen 1365 Literatur 1394 Bildnachweis 1496 Register der Namen, Gruppen, Verbände 1497 Geographisches Register 1518 Sachregister 1530 |
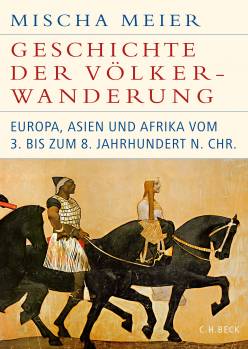
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen