|
|
|
Umschlagtext
Geschichte der Schweiz und der Schweizer
Pierre Ducrey: Vorzeit, Kelten und Römer (bis 401 n. Chr.) Guy P. Marchai: Die Ursprünge der Unabhängigkeit (401-1394) Nicolas Morard: Auf der Höhe der Macht (1394-1536) Martin Körner: Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515-1648) François de Capitani: Beharren und Umsturz (1648-1815) Georges Andrey: Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798-1848) Roland Ruffieux: Die Schweiz des Freisinns (1848-1914) Hans Ulrich Jost: Bedrohung und Enge (1914-1945) Peter Gilg und Peter Hablützel: Beschleunigter Wandel und neue Krisen (seit 1945) "Ein historisches Werk, das so wissenschaftlich wie nötig und so verständlich wie möglich geschrieben ist; ein Standardwerk für jeden Eidgenossen." Schweizer Illustrierte Dritte, unveränderte Auflage der Studienausgabe in einem Band Rezension
Die vorliegende dritte Auflage des Standartwerkes zur Geschichte der Schweiz ist als einbändige kartonierte Studienausgabe erschienen.
In neun Kapiteln werden von elf Autoren die Geschichte und Vorgeschichte der Schweiz von den ersten menschlichen Zeugnissen in der Steinzeit bis zu den Entwicklungen des Jahres 1986 umfassend dargestellt, wobei die neuste Geschichte am ausführlichsten behandelt wird. Die Darstellung geht dabei weit über eine traditionelle Ereignisgeschichte hinaus und berücksichtigt neben der Politik auch Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft und Alltag, Bereiche, die in den letzten Jahrzehnten in der Geschichtswissenschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Die Strukturierung und die Schwerpunkte der einzelnen Kapitel fallen dabei unterschiedlich aus und wurden von den einzelnen Autoren nach jeweils eigener Konzeptionalisierung gestaltet. Die Kapitel lassen sich dementsprechend unabhängig voneinander lesen. Die Ausführungen sind verständlich und flüssig geschrieben. Auf eine spezielle Fachterminologie sowie Fremdwörter die eher nicht zum allgemeinen Wortschatz gehören wird weitestgehend verzichtet. Im Anhang befindet sich eine Erklärung der Fachausdrücke, die für ein Verständnis der schweizerischen Geschichte zentrale Bedeutung besitzen. Das Buch ist somit für eine breite Leserschaft und nicht nur für das Fachpublikum geeignet. Zahlreiche Abbildungen, Graphiken und Tabellen illustrieren den Text und veranschaulichen die Ausführungen. Methodische Fragestellungen der Geschichtswissenschaft werden ebenfalls an zahlreichen Stellen aufgegriffen. Das einleitende Kapitel von Ulrich im Hof über die Historiographie der Schweiz oder die Ausführungen von Guy P. Marchal zur Rekonstruktion der möglichen Faktoren, die zur Entstehung der Geschichten von Wilhelm Tell beigetragen haben könnten (S. 175/176), seien nur als zwei von zahlreichen Beispielen genannt. Der Nutzen des Buches für den schweizerischen Leser bedarf keiner weiteren Erläuterung. Durch die enge Verknüpfung der schweizerischen Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch mit seinen nördlichen und östlichen Nachbarn, ist das Buch jedoch auch für den Leser in Deutschland und Österreich höchst aufschlussreich. Zahlreiche Themen der eigenen Nationalgeschichte lassen sich so aus einer anderen Perspektive betrachten. Gerade auch für das Mittelalter, in dem die Voraussetzungen für eine eigenständige Schweiz gelegt und die Unabhängigkeit vom Reich erzielt wurde, lassen sich zahlreiche Bezüge zu etwa den Ottonen, Staufern und Habsburgern finden. Andere Themen, wie z.B. Caesars Politik im alpinen Raum und gegenüber den Helvetiern sind vielen deutschen und österreichischen Lesern aus dem Geschichts- oder Lateinunterricht (Bellum Gallicum) bekannt, wenn auch unter anderen Fragestellungen. Für den deutschen und österreichischen Leser dürfte die Darstellung übernationaler Themen aus schweizerischer Perspektive, wie z.B. die Weltwirtschaftskrise und internationale wirtschaftliche Verflechtungen, wie sie in den letzten beiden Kapiteln behandelt werden, ebenfalls interessant sein. Für eine weitere vertiefende Arbeit ist jedem Kapitel eine kommentierte Bibliographie beigegeben. Eine umfangreiche Literaturrecherche wird somit erheblich erleichtert. Am Ende des Buches befinden sich nochmals allgemeine bibliographische Hinweise. Ein Orts- und Personenregister sowie ein Sachregister tragen wie das Inhaltsverzeichnis zur raschen Orientierung bei. Die Zeittafel im Anhang ist in die fünf Spalten Europa und die Welt, Politische Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht sowie in eine Spalte für Kultur, Wissenschaft und Religion unterteilt und ermöglicht einen zeitlichen Überblick. Fazit: Umfassende und interessante Darstellung der schweizerischen Geschichte, nicht nur für Schweizer. Björn Hillen, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» hat sich seit Jahren als das Standardwerk zur Schweizer Geschichte etabliert. Von der Prähistorie bis zur Nachkriegszeit bietet das Werk in klarer Sprache und mit zahlreichen Bildern und Grafiken einen fundierten Überblick. 10 ausgewiesene Schweizer Historiker haben ein Werk verfasst, das sich Tag für Tag an Schulen, Universitäten und im privaten Gebrauch bewährt. Als erste Gesamtdarstellung der Schweizer Geschichte räumt die «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» neben der politischen Geschichte auch der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte breiten Raum ein. Die Studienausgabe der «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» in einem Band erschien erstmals 1986. Sie umfasst den identischen Inhalt in Text und Bild wie die ursprüngliche Ausgabe in drei Bänden. Die nun vorliegende, unveränderte 3. Auflage erscheint in einer verbesserten Ausstattung. Aus der Einleitung Alle Geschichte ist Erzählung - Bericht und Deutung in einem. Zwar kommen in dieser Geschichte der Schweiz und der Schweizer verschiedene Autoren zu Worte: Zehn Historiker haben in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Kollegen eine Darstellung verfasst, zu der jeder von ihnen seine eigene Sicht beigesteuert hat. Doch liegt dem Werk eine gemeinsam erarbeitete Gesamtkonzeption zugrunde. Ein solches Gemeinschaftsunternehmen ist nicht einfach, vor allem dann nicht, wenn es in drei Sprachen den verschiedenen Kulturkreisen der Schweiz gerecht werden will. Trotz allen Bemühungen liessen sich gewisse Ungleichgewichte nicht vermeiden; Ton und Stil der einzelnen Kapitel wechseln ebenso wie die Standpunkte und Wertungen. Aber gerade diese Vielfalt entspricht dem Eigencharakter der schweizerischen Geschichte. Denn diese Geschichte kreist nicht um ein Herrscherhaus, um eine tragende Schichte, um eine Kirche - ja nicht einmal um einen Staat. Sie besteht aus den Entwicklungen von 23 Kantonen, von zahlreichen Regionen, von politischen, kulturellen und religiösen Gemeinschaften, die über die Grenzen hinweg Verbindungen pflegen, sich zusammenfinden, aber auch miteinander rivalisieren. Das Ergebnis dieser Geschichten, das den Blickwinkel bestimmt, ist die Entstehung eines modernen Bundesstaates. Deshalb sind von den neun Kapiteln dieses Buches vier den letzten zwei Jahrhunderten gewidmet. Geschichte ist immer eine Neuentdeckung der Vergangenheit. Die schweizerische Geschichtsschreibung hat viele wertvolle Arbeiten hervorgebracht, viele auch, die ihre Zeit mitgeprägt haben. Obschon sich mit dem Bundesstaat von 1848/74 für Generationen das liberale Geschichtsbild durchgesetzt hat, sind immer auch andere Interpretationen vertreten worden. Was an der hier gebotenen Schweizergeschichte neu sein dürfte, ist der Einbezug von Fragestellungen und Methoden, die erst in den letzten zwei Jahrzehnten von der Forschung aufgegriffen worden sind. Die moderne Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die historische Demographie und die Mentalitätsforschung haben Ergebnisse erarbeitet, die neuartige Perspektiven eröffnen. Wenn auch noch viel zu tun bleibt, viele Dokumente aufgespürt und ausgewertet werden müssen, so schien es doch an der Zeit, diese neuen Impulse aufzunehmen. Da es in diesem Buch vor allem um die Menschen und ihre Gesellschaft geht, treten die politischen und militärischen Ereignissen, die in den bisherigen Schweizergeschichten ausgiebig behandelt worden sind, etwas in den Hintergrund. Nicht nur von der Schweiz, sondern von den Schweizern ist die Rede, ihr alltägliches Tun und Lassen soll ebenso aufgezeigt werden wie ihre gemeinsamen Erinnerungen und Erfahrungen. Diese kollektive Vergangenheit wird in die jeweiligen Zeitumstände hineingestellt und beleuchtet durch Beispiele aus allen Winkeln des Landes, das schliesslich zur Schweizerischen Eidgenossenschaft geworden ist. Vor allem aber geht es darum, die Zusammenhänge aufzuspüren und sie verständlich machen. Inhaltsverzeichnis
Einleitung 11
Von den Chroniken der alten Eidgenossenschaft bis zur neuen "Geschichte der Schweiz und der Schweizer" 13 Ulrich Im Hof Bibliographie und Forschungsstand 22 Kapitel 1 Vorzeit, Kelten und Römer (bis 401 n. Chr.) 23 Pierre Ducrey A. Die ersten Menschen 23 1. Die frühesten Spuren 23 2. Der Mensch als Wildbeuter 26 B. Die ersten Kulturen zwischen Alpen und Jura 27 1. Die neolithische Revolution 27 2. Neuer wirtschaftlicher, technologischer und kultureller Aufschwung 36 3. Die Alpen - Ort des Handels und der Begegnungen 42 4. Die Welt der Kelten 48 5. Die Schweiz und ihre Bewohner am Vorabend der römischen Eroberung 54 C. Die römische Schweiz 58 1. Die Etappen der Eroberung 58 2. Die römische Schweiz: ein Modellfall der Akkulturation 74 3. Der Alltag 79 4. Arbeit, Güteraustausch, Geld und Verwaltung 86 5. Heidentum und Christentum 95 6. Vom römischen Reich zum Mittelalter 100 Bibliographie und Forschungsstand 106 Kapitel 2 Die Ursprünge der Unabhängigkeit (401-1394) 109 Guy P. Marchal A. Nach dem Turmbau von Babel 111 1. Die Romanen: Wegzug und Beharrung 112 2. Die Stunde der Burgunder 113 3. Die Stunde der Alemannen 116 4. Die Ausbildung von Sprachgrenzen 119 B. Christliche Schweiz 122 1. Die bischöflichen Zentren 122 2. Die Christianisierung des Landes 124 3. Zwei Zentren von europäischer Bedeutung: St. Gallen und Saint-Maurice 127 C. Die Schweiz "im Herzen Europas" 128 1. Land am Gotthard - Land am "End der Welt"? 129 2. Zwischen zwei politischen Polen: das Königreich Hochburgund und das Herzogtum Schwaben 133 3. Der Vorstoß in den zentralen Alpenraum: die Zähringer 136 4. St. Gotthard - der neue Handelsweg 138 5. Herren der Pässe: die Grafen von Savoyen im Westen 139 6. Eine schicksalhafte Erbschaft: die Habsburger im Norden 141 7. Eine Vielzahl weltlicher und kirchlicher Herrschaften im Osten und Süden 142 8. Die Schweiz um 1300 144 D. Von der Selbstversorgung zur Austauschwirtschaft 146 1. Die Grundherrschaft: Adlige, Freie und Unfreie 146 2. Die Wiedergeburt der Städte und des Handelsverkehrs 148 3. Die neuen Kräfte: Stadtbürger und "Hirten" 150 4. Die charakteristischen Züge der schweizerischen Entwicklung 154 E. Die "alpine Gesellschaft" 155 1. Die "Hirtenkultur" 157 2. Von der Freiheit und der alpinen Gemeindebildung 158 3. Der herrschaftliche Zugriff 163 F. Von der Abwehr einer unsicheren Zukunft zum Streben nach einem kollektiven Sicherheitssystem 165 1. Bern und die burgundische Eidgenossenschaft 168 2. Zürich und die Bodenseestädte 170 3. Der Bund der Waldstätte 171 4. Der Bund zwischen Städten und Ländern 177 5. Genf und das Wallis im Kampf gegen Savoyen 189 6. Umworbene Säumer: das Tessin 196 7. Vom feudalherrschaftlichen Partikularismus zur föderativen Sammlung: Graubünden 198 8. Entscheidung bei Sempach 200 9. Das schweizerische 14. Jahrhundert 209 Bibliographie und Forschungsstand 212 Kapitel 3 Auf der Höhe der Macht (1394-1536) 215 Nicolas Morard A. Die Schweiz in Europa 215 1. Die Schweiz und die europäische Krise (1350 1450) 215 2. Die gesellschaftlichen Kräfte 228 B. Die Verfestigung der Territorialherrschaft: die natürlichen Grenzen (1389 -1460) 248 1. Ziele und Grenzen einer friedlichen Ausdehnung 249 2. Die Versuchung der Gewalt: Schwyz und Appenzell, Uri und die Leventina 258 3. Ein Sezessionskrieg 270 4. Die Nachkriegszeit: Bilanz und Ausblick 283 C. Die Eidgenossen auf der europäischen Bühne (1469-1536) 295 1. Die Burgunderkriege: Verstrickung oder Absicht? 295 2. Der schwierige innere Ausgleich 309 3. Weder Österreich noch das Reich 316 4. Die italienischen Kriege: ein unnötiges Unternehmen? 326 Bibliographie und Forschungsstand 354 Kapitel 4 Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515-1648) 357 Martin Körner A. Bevölkerungsentwicklung 358 1. Größe und Dichte der Bevölkerung 358 2. Bevölkerungsverhalten: Heiraten, Zeugung, Sterben 361 B. Arbeit und Einkommen 367 1. Landwirtschaft 367 2. Vom Handwerk zur Industrie 371 3. Dienstleistungen: Handel, Bank, Solddienst 375 4. Preise, Löhne, Vermögensbildung 380 C. Staat und Gesellschaft 384 1. Politische Struktur der Schweiz 384 2. Soziale Gegensätze in der Gesellschaft 388 3. Die Abhängigkeit der Landschaft von der Stadt 392 4. Unruhen und Volksaufstände 396 D. Tradition und Erneuerung 399 1. Die Reformation 399 2. Die katholische Erneuerung 402 3. Häresie, Intoleranz und verpaßte Reformen 407 4. Wissenschaften, Geist und Kunst 411 E. Politische Kräfte und Ereignisse 417 1. Die Politisierung der Reformation 417 2. Der Weg zum Religionskrieg 419 3. Auswirkungen des zweiten Landfriedens 422 4. Die politische Tragweite der Gegenreformation 425 5. Eskalation der Gewalt 429 6. Die Schweiz im Dreißigjährigen Krieg 433 Bibliographie und Forschungsstand 440 Kapitel 5 Beharren und Umsturz (1648-1815) 447 François de Capitani A. Die Bevölkerungsentwicklung 447 B. Die Wirtschaft 453 1. Die landwirtschaftliche Produktion 453 2. Transport und Reisen 459 3. Gewerbe und Industrie 460 4. Der Handel und die Banken 464 5. Die Verflechtung des wirtschaftlichen Lebens 465 C. Die Gesellschaft 466 1. Die ländliche Gesellschaftsordnung 466 2. Die städtische Gesellschaft 469 D. Die Politik 473 1. Europa und die Schweiz - Der Einfluß Frankreichs 473 2. Das Spiel der Mächte unter den Orten 475 3. Die interne Politik der Orte 482 E. Die Kultur 492 1. Die europäischen Strömungen 492 2. Die traditionelle Volkskultur 494 3. Die offizielle Kultur 495 4. Die Verbreitung der Ideen 501 5. Literatur, bildende Kunst und Wissenschaft 505 6. Der Helvetismus 506 F. Übergang und Erneuerung 508 1. Das Ende des Ancien Régime 508 2. Die Helvetische Republik 514 3. Die Mediation 519 Bibliographie und Forschungsstand 523 Kapitel 6 Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798-1848) 527 Georges Andrey A. Ein erster Überblick 527 B. Bevölkerung und Wirtschaft 532 1. Bevölkerungszunahme und Wanderungen 534 2. Wirtschaftsstruktur und Konjunktur 541 3. Ausbau der Dienstleistungen 549 C. Gesellschaft und Alltag 563 1. Lebenshaltung und Umwelt 564 2. Lebenserwartung und Familienverhalten 579 3. Die Wege des Wissens 583 D. Das Werden des modernen Staates 593 1. Äußere und innere Grenzen 593 2. Entstehung eines Nationalbewußtseins 600 3. Die politischen Institutionen 608 E. Die Kantone und der Bund 613 1. Die Anfange der liberalen Demokratie 613 2. Krieg und Frieden zwischen den Kantonen 621 Bibliographie und Forschungsstand 631 Kapitel 7 Die Schweiz des Freisinns (1848-1914) 639 Roland Ruffieux A. Die Anfänge des Bundesstaates (1848 -1870) 640 1. Vom Bundesvertrag zur Bundesverfassung 641 2. Die Modernisierung von Politik und Verwaltung 646 3. Die Außenpolitik im Zeitalter der Nationalbewegungen 652 4. Auf dem Weg zu einer Wirtschaft von europäischem Format 656 5. Ein neuer politischer Aufbruch 666 B. Umgruppierung und Integrationskrisen (1871-1891) 669 1. Von der Totalrevision zum dauernden Kompromiß 670 2. Auf dem Weg zur Demokratie der Gruppen 678 3. Die "große Depression" und die erste Umstrukturierung der Wirtschaft 685 4. Zurückhaltung in der Außenpolitik 692 C. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert (1891-1914) 700 1. Die politischen Entwicklungslinien 700 2. Spezialisierung als wirtschaftlicher Entwicklungsfaktor 707 3. Glanz und Elend der Gesellschaft 714 4. Vom Wissenschaftsglauben zum ästhetischen Bruch 723 Bibliographie und Forschungsstand 727 Kapitel 8 Bedrohung und Enge (1914-1945) 731 Hans Ulrich Jost A. Die wichtigsten Themen und Phasen in der Zeit von 1914 bis 1945 731 1. Stellung der Schweiz in der Weltwirtschaft 731 2. Die Außenpolitik 734 3. Das politische System 738 B. Bevölkerung und Wirtschaft 741 1. Bevölkerungsentwicklung 741 2. Abriß der Konjunkturentwicklung 744 3. Soziale Lage 746 4. Sozialpolitik 748 C. Kultur, Staat und Gesellschaft 749 1. Prolog: Ungleichzeitigkeiten und Entfremdungen in der politischen Kultur 749 2. Kulturpolitik am Vorabend des Ersten Weltkrieges 751 3. Die Kulturkrise nach dem Ersten Weltkrieg 753 4. Die Kultur der Geistigen Landesverteidigung 758 5. Die Kirchen in der Gesellschaft 759 6. Epilog: Kulturelle Verarmung in der Enge von Abwehr und Geistiger Landesverteidigung 761 D. Erster Weltkrieg und Nachkriegskrisen (1914-1923) 762 1. Verlust der Illusionen 762 2. Kriegsende und Landesstreik 765 3. Nachkriegskrise 1921/22 770 E. Prosperität und Weltwirtschaftskrise (1924-1936) 797 1. Verwirtschaftlichung der Politik 774 2. Entwicklung der innenpolitischen Verhältnisse 776 3. Weltwirtschaftskrise 779 4. Schweiz und Faschismus 783 F. Sammlung und Integration der Kräfte (1937-1943) 788 1. Der außenpolitische Druck 788 2. Innenpolitische Stabilisierung ohne grundlegende Reformen 792 3. Mobilisation und Krieg 797 4. Widerspruchsvolle Innenpolitik 803 G. Am Ende des Zweiten Weltkrieges 807 1. Umstellung auf die neuen Machtverhältnisse in Europa 807 2. Innenpolitik und Gesellschaft 810 Bibliographie und Forschungsstand 815 Kapitel 9 Beschleunigter Wandel und neue Krisen (seit 1945) 821 Peter Gilg und Peter Hablützel A. Geschichte unserer Zeit 821 B. Die Wirtschaft 827 1. Kapitalismus der Nachkriegszeit 827 2. Entwicklung der Schweiz - Musterbeispiel und Sonderfall 830 3. Das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit 832 4. Belastende Folgen des Wachstumsprozesses 840 5. Von der Konjunkturüberhitzung in die Wirtschaftskrise 843 6. Auf dem Weg in eine neue Wachstumsphase? 848 C. Infrastruktur und öffentliche Finanzen 850 1. Raumordnung und Umweltschutz 851 2. Energie 854 3. Verkehr 856 4. Wohnungsbau und Miete 858 5. Gesundheit, Bildung und Forschung 860 6. Die öffentlichen Finanzen 862 D. Die Gesellschaft 869 1. Entwicklung von Wohlstand und Sozialstaat 869 2. Ausbau der sozialen Sicherung 871 3. Das Arbeitsverhältnis im Zeichen der Sozialpartnerschaft 876 4. Wandlung der Bevölkerungs- und Sozialstruktur 878 5. Neue sozialpolitische Probleme und Forderungen 880 6. Wirtschaftskrise und Grenzen des Sozialstaates 885 E. Vorstellungswelt und Verhaltensweisen 887 1. Auf der Suche nach der Normalität 887 2. Neue Abwehrhaltung 889 3. Überfremdungsangst 890 4. Alternative Bewegungen 892 5. Zwischen Bewegung und Restabilisierung 898 F. Kultureller Ausdruck 901 1. Wandlungen des künstlerischen Ausdrucks 901 2. Äußere Bedingungen des Kulturlebens 907 3. Die Kirchen 909 G. Die politische Struktur 911 1. Ausbau der Verhandlungsdemokratie 911 2. Erweiterung demokratischer Mitwirkungsrechte 917 3. Wandlung der politischen Kräfte und Ausdrucksformen 919 4. Entwicklung und Grenzen der Staatstätigkeit 927 5. Veränderungen in der föderativen Struktur 930 6. Bestrebungen zur Bildung neuer Kantone 932 7. Auswege aus der politischen Krise? 937 H. Äußere und innere Sicherheit des Staates 939 1. Militärische Landesverteidigung im Wandel 939 2. Von der Landesverteidigung zur Sicherheitspolitik 942 I. Die Schweiz in der Welt 944 1. Die Grundfragen der schweizerischen Außenpolitik 944 2. Wirtschaftliche Integration 947 3. Die Schweiz in einer sich wandelnden Welt 950 K. Überlegungen zu einer historischen Ortsbestimmung der Gegenwart 954 Bibliographie und Forschungsstand 960 Anhang Zeittafel 969 Erklärung der Fachausdrücke 1013 Allgemeine bibliographische Hinweise 1023 Nachweis der Abbildungen 1028 Orts- und Personenregister 1031 Sachregister 1045 Karte der Schweiz 1056 |
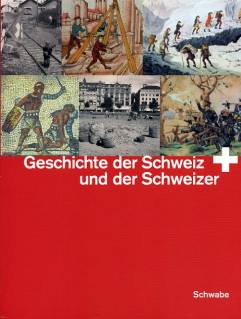
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen