|
|
|
Umschlagtext
Dieser illustrierte Überblicksband zum Kirchengebäude bietet eine theologische, liturgische und baugeschichtliche Gesamtdarstellung der Entwicklung des Kirchenbaus von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei werden die historischen Entwicklungen in den Bautypen ebenso dargestellt wie die konfessionellen Besonderheiten. So entsteht ein umfassendes Bild der „religiösen Topographie" in Theologie und Geschichte.
Franz-Heinrich Beyer, geb. 1949, ist Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Rezension
Was sind die Besonderheiten des christlichen Kirchengebäudes? Wodurch unterscheidet sich dieser Bautyp von anderen und welche Merkmale lassen sich an ihm beschreiben? Woran kann man konfessionelle Unterschiede festmachen? Fragen dieser Art geht Franz-Heinrich Beyer in diesem Band auf den Grund. Der Autor behandelt anschaulich und auch für den historisch und kunstgeschichtlich interessierten Laien verständlich alle Formen des Kirchenbaus mit ihren Besonderheiten. Theologische, liturgische, historische und kunstgeschichtliche Aspekte verschränken sich dabei und tragen zur Übersicht über die Fülle der Erscheinungsformen bei. Die Spanne reicht vom frühchristlichen Raum über die gotischen Kathedralen bis hin zum Historismus des 19. Jahrhunderts. Auch die Bauform der Synagoge wird berücksichtigt und mit den Innen- und Außenräumen christlicher Kirchen verglichen.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
WBG-Preis EUR 29,90 Buchhandelspreis EUR 49,90 Der Autor bietet eine theologische, liturgische und baugeschichtliche Gesamtdarstellung der Entwicklung des Kirchenbaus von der Antike bis zum Ende des 19. Jh.s. Dabei geht er auf die historische Entwicklung der Bautypen ebenso ein wie auf konfessionelle Besonderheiten. Das christliche Kirchengebäude – was ist das? / Jüdische und christliche Sakralbauten im Römischen Reich / Kirchengebäude im Mittelalter / Das Kirchengebäude im konfessionellen Zeitalter (16.-18. Jh.) / Kirchengebäude bis zum Ende des Staatskirchentums (von der Aufklärung bis 1918) / Aspekte des Kirchenbaus nach dem Ende des Staatskirchentums / Literatur. Rezensionen: »Der Band bietet eine handliche Überblicksdarstellung (mit zahlreichen Illustrationen), in welcher die theologischen, liturgischen und baugeschichtlichen Aspekte geschickt verwoben sind.« reformierte presse Inhaltsverzeichnis
Vorwort 10
I. Das christliche Kirchengebäude - was ist das? 11 1. Gottesdienstfeier und Kirchengebäude 11 1.1 Der Kirchenraum - ein Thema der Liturgiewissenschaft 12 1.2 „Liturgischer Raum" und „öffentlicher Raum"? - kirchliche Stellungnahmen zum Thema ,Kirchengebäude' und,Kirchenraum' 13 2. Der durch ein Kirchengebäude herausgehobene, symbolisch gestaltete Ort 15 2.1 „Memoria" und das Kirchengebäude 15 2.2 Wo in älterer Zeit Kirchengebäude errichtet wurden 16 2.2.1 „Heiliger Ort", „heiliger Raum"? 16 2.2.2 Symbolische Gehalte eines ,heiligen Raums' 17 3. Das Kirchengebäude als Ausdrucksgestalt 17 3.1 Votivkirchen 18 3.2 Kirchengebäude und Atmosphären 18 4. Die plurale Gesellschaft und die Kirchengebäude 19 II. Grundlagen für die Kirchenbauten des Mittelalters in Deutschland: Jüdische und christliche Sakralbauten im Römischen Reich 21 1. Synagogen - Aspekte der frühen Baugeschichte 21 2. Christliche Kirchengebäude 22 2.1 Christlicher Gottesdienst und Kirchengebäude in vorkonstantinischer Zeit 23 2.2 Christliche Kirchengebäude in der Ära Konstantins 24 2.3 Christliche Kirchengebäude und spätantike Stadt 25 2.4 Das christliche Kirchengebäude in der Kontinuität der lokalen religiösen Topographie 25 3. Die herausragende Bedeutung Jerusalems 26 3.1 Steinwerdung des christlichen Credo - Jerusalem als Mnemotop 27 3.2 Sakralbauten in Jerusalem zwischen Islam und Christentum 28 4. Das christliche Rom - das „neue Jerusalem" 30 III. Kirchengebäude im Mittelalter 33 1. Topographie der Kirchengebäude im Mittelalter 33 1.1 Kontinuität in der lokalen religiösen Topographie 33 1.2 Die „religiöse" Anweisung des Bauplatzes für ein Kloster bzw. ein Stift 34 1.3 Die Heiligenverehrung (Heiligengrab) und das Patrozinium 35 1.4 „Roma secunda" - die Hereinnahme des Kultes in die Stadt 35 2. Kirchengebäude-Typen 36 2.1 Die Kathedrale (Bischofskirche) 37 2.2 Stifts-und Klosterkirchen 39 2.2.1 Das Kloster - der benediktinische Weg 40 2.2.2 Die Klosterkirche 41 2.2.3 Weitere Orden und Klöster 42 2.2.4 Stift und Stiftskirche - ordo canonicus 43 2.3 Pfarrkirche 44 2.3.1 Die Pfarrei 44 2.3.2 Die Stadtpfarrkirche 46 2.3.3 Die Pfarrkirche als Medium städtischer Selbstdarstellung 48 3. Kirchengebäude und Kirchenraum - Symbolik und Ausstattung 49 3.1 Das Kirchengebäude 49 3.2 Der Kirchenraum und seine Ausstattung 59 4. Stadttopographie und Kirchengebäude 70 4.1 Die topographische Lage der Kirchengebäude 70 4.2 Die Kirchtürme und die Glocken 71 4.3 Die Immunität 72 5. Kirchengebäude und Synagoge in der mittelalterlichen Stadt 72 5.1 Zur Geschichte der Juden im Mittelalter 73 5.2 Die Darstellung von Juden im Zusammenhang christlicher Bildthemen 74 5.3 Synagoge und Ritus 75 5.4 Synagogenbauten im Mittelalter 76 5.5 Christliche Kirchenbauten am Ort von Synagogen 78 IV. Das Kirchengebäude in konfessioneller Zeit (16.-18. Jahrhundert) 80 1. Das Kirchengebäude im lutherischen Kontext 81 1.1 Das Kirchengebäude in der Reformationszeit 81 1.1.1 Erste Konsequenzen aus der Reformation für die vorhandenen Kirchengebäude 81 1.1.2 Martin Luther zu Gottesdienst und Kirchengebäude 82 1.2 Kontinuität und Neuakzentuierung im überkommenen Kirchenraum 84 1.2.1 Die lutherische Pfarrkirche und ihre Nutzung 84 1.2.2 Der lutherische Kirchenraum 84 1.3 Die Herausbildung einer Theorie des protestantischen, lutherischen Kirchenbaus seit dem 17. Jahrhundert 98 1.4 Kirchengebäude und Gottesdienst in lutherischen Territorien im 18. Jahrhundert 100 1.4.1 Repräsentative Kirchengebäude prägen das Stadtbild 100 1.4.2 Der lutherische Kirchenraum in seiner Vollendung 100 1.4.3 Der evangelische Gottesdienst im 17. und 18. Jahrhundert 104 1.5 Ausstattungsstücke des lutherischen Kirchenraums 104 2. Das Kirchengebäude im reformierten Kontext 108 2.1 Die pragmatische und theoretische Grundlegung für den reformierten Kirchenraum in der Schweiz 109 2.1.1 Das Urbild des reformierten Kirchenraums in Zürich 109 2.1.2 Johannes Calvin zu Bilderverbot und Kirchengebäude 109 2.2 Reformierte Gottesdienste und reformierte Kirchenräume in Deutschland 110 2.2.1 Umgestaltete und neuerrichtete Kirchenräume 111 2.2.2 Vorbilder für reformierte Kirchenbauten in deutschen Territorien 112 2.3 Die Einrichtung des reformierten Kirchenraums 114 2.4 Das Nebeneinander verschiedener Konfessionen in einem Territorium 117 2.4.1 Die konfessionelle Topographie der Orte 117 2.4.2 Die Dominanz des reformiert geprägten Kirchenraums in Nordwestdeutschland 119 2.4.3 Protestantische Simultankirchen des 17. und 18. Jahrhunderts 119 3. Das Kirchengebäude im Kontext der katholischen Reform 121 3.1 Katholische Konfessionalisierung und das barocke Kirchengebäude 122 3.2 Bauaufgaben in katholischen Territorien 122 3.2.1 Jesuitenkirchen 122 3.2.2 Klosterkirchen 124 3.2.3 Wallfahrtskirchen und Kalvarienberge 124 3.2.4 Pfarrkirchen 127 3.3 Katholische Kirchenneubauten in protestantischen Territorien 127 3.4 Der katholische Kirchenraum des Barock 129 3.4.1 Gegenreformatorische Akzente 129 3.4.2 Die Ausstattung des Kirchenraums 132 4. Die Synagoge in der frühen Neuzeit - Synagogenbauten des 16. bis 18. Jahrhunderts 136 Exkurs: Die Synagoge in der Sicht von Martin Luther 136 V. Kirchengebäude der großen Konfessionskirchen bis zum Ende des Staatskirchentums (von der Aufklärung bis 1918) 140 1. Säkularisation - Toleranz - Patriotismus. Rahmenbedingungen und Anlässe zum Kirchenbau am Beginn des 19. Jahrhunderts 140 1.1 Säkularisation - der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 140 1.2 Toleranz - Reichsdeputationshauptschluss und Wiener Kongress 141 1.3 Patriotismus - Kriegerdenkmale im Kirchenraum 142 2. Konfessionsübergreifende Orientierungen im Kirchenbau 143 2.1 Erwartungen an den Kirchenraum in der Zeit der Aufklärung 143 2.2 Die Orientierung an Formen der vorchristlichen Antike 144 2.3 Die Orientierung an Formen der frühen Kirche 146 2.4 Die Orientierung an Formen der Gotik 148 2.4.1 Neugotische Umgestaltungen und Vollendungen von Kirchenbauten 148 2.4.2 Die vorherrschende Orientierung am gotischen Stil 149 2.4.3 Die Errichtung von Kirchengebäuden in neugotischen Formen 150 2.4.4 Das Erscheinungsbild neugotischer Kirchengebäude 152 2.5 Orientierung an Formen der Romanik 154 3. Aspekte einer Rekonfessionalisierung des Kirchenbaus 155 3.1 Kirchengebäude des Neuprotestantismus 155 3.1.1 „Protestantisch" - Entwicklungen im 19. Jahrhundert 155 3.1.2 Schleiermacher zu Gottesdienst und Kirchengebäude 156 3.1.3 Urbilder des protestantischen Kirchengebäudes? 157 3.1.4 Das Kirchengebäude des Neuprotestantismus - das „Wiesbadener Programm" 157 3.1.5 Gruppenbauten 159 3.2 Katholische Kirchenneubauten 161 4. „Kirchengebäude" und „Synagoge" im Fokus pragmatischer, ästhetischer und theoretischer Überlegungen an der Wende zum 20. Jahrhundert 162 4.1 Industrialisierung und Urbanisierung, Kirchenbau und Rechristianisierung 163 4.1.1 Entkirchlichung und Urbanisierung 163 4.1.2 Rechristianisierung 165 4.1.3 Inkulturation 166 4.2 Formalisierung sakraler Bauaufgaben - Kirchengebäude und Synagogen in Fachbüchern für Architekten 167 4.3 Kunstausstellungen - Manifestationen einer protestantisch-katholischjüdischen „Kulturökumene" 168 4.4 „Christliche Baukunst" und „Synagoge" in protestantischen Lexika 168 4.5 Neue Baumaterialien - eine Herausforderung für den Sakralbau 169 4.6 Monumentalität und religiös-kultureller Anspruch - Kirchengebäude und Synagogen im frühen 20. Jahrhundert 170 4.6.1 Aspekte der allgemeinen Entwicklung 170 4.6.2 Exemplarisch: Drei repräsentative „Kultusbauten" in Essen 171 VI. Kirchengebäude, Synagogen, Kapellen und Bethäuser in Deutschland -monumentale Zeichen einer kulturellen Modernisierung in der letzten Phase des Staatskirchentums (1803 bis 1918) 176 1. Synagogenbauten 177 1.1 Toleranz, Emanzipation, Antisemitismus: Zur Geschichte der Juden in Deutschland 177 1.2 Synagogenbauten im frühen 19. Jahrhundert 178 1.3 Synagogen im ägyptischen und im maurischen Stil 179 1.4 Synagogen im „deutschen Baustil" 179 1.5 „Monument in der Stadt" - Synagogenbauten des frühen 20. Jahrhunderts 181 2. Bethäuser und Kapellen 181 2.1 Duldung - die älteren evangelischen Freikirchen 183 2.1.1 Mennonitenkirchen 183 2.1.2 Die Kirchensäle der (erneuerten) Brüder-Unität 183 2.2 „Erlaubte Privatgesellschaften" bzw. „Geduldete Kirchengesellschaften" - jüngere evangelische Freikirchen in Deutschland 185 2.2.1 Baptistische Bethäuser 185 2.2.2 „Evangelisch-Lutherische Kirche in Preußen" 187 2.2.3 Evangelisch-methodistische Kirchengebäude 187 2.3 Staatliche Anerkennung per Gesetz - die Altkatholische Kirche 188 3. Kirchengebäude ausländischer Kirchen und Konfessionen 188 3.1 Russisch-orthodoxe Kirchen 189 3.2 Englische/Anglikanische Kirchen 189 3.3 Amerikanische Kirchen 189 Exkurs: Islamische Sakralbauten in Deutschland bis 1918 190 VII. Städtebauliche Dominante, Sakralbau, zeit- und menschengerechter Raum - Aspekte des Kirchenbaus nach dem Ende des Staatskirchentums 191 1. Nach dem Ende des Staatskirchentums 191 2. Kirchengebäude - monumentale Dokumente „ihrer Zeit" 192 3. Kirchlich-theologische Leitideen und Kirchen-Neubauten 198 4. Architekturentwicklung und Kirchenbau 199 5. Zur religiösen Topographie von Landschaften und Städten in der Gegenwart 200 Anmerkungen 203 Literaturverzeichnis 213 Bilderläuterungen und Abbildungsverzeichnis 221 |
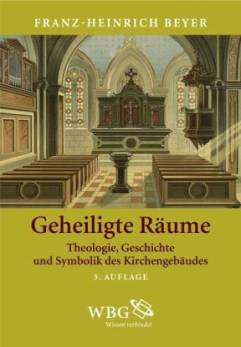
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen