|
|
|
Rezension
Nach langer Zeit jetzt auch als deutsche Übersetzung erhältlich. Bisher nur für erlesene Fachleute ein Begriff, jetzt durch die Übersetzung auch einem größerem Kreis zugänglich.
Leichter Einstieg, Super Aufbau, gut strukturiert, unzählig gute und unverwechselbare Abbildungen. Verständlich geschrieben bzw. aus dem Original sehr gut übersetzt. Zur Erweiterung der Originalfassung ist das Scoring und die Funktionelle Bewegungslehre mit in die deutsche Ausgabe genommen worden. Wie schon auf dem Umschlagtext erwähnt, ein Referenzwerk für Mediziner, Physiotherapeuten, Orthopädiemechaniker sowie Sportwissenschaftler. Günther Klein für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Von der "Gangpäpstin" Erstmals in deutscher Übersetzung: Das Grundlagenwerk von Dr. Perry komplett und ungekürzt Weltweit ist die Analyse des menschlichen Gehens mit einem Namen verbunden: Dr. Jacquelin Perry. Sie hat die Normalität und Pathologie des Gehens über Jahrzehnte am renommierten Rancho Los Amigos Rehabilitation Center in Los Angeles erforscht. Ihre Ergebnisse setzen Maßstäbe in der Ganganalyse. Kein Wunder, dass ihr Grundlagenbuch zu dem unentbehrlichen Lehr- und Referenzwerk für alle geworden ist, die sich mit dem Gehen beschäftigen: Mediziner, Physiotherapeuten, Orthopädiemechaniker sowie Wissenschaftler aus den Bereichen Medizin und Sport. Dr. Perry analysiert zunächst den physiologischen Gang detailliert, systematisch und in der ihr eigenen Anschaulichkeit: Einteilung und Beschreibung der einzelnen Gangphasen Analyse jedes Gelenks der unteren Extremität hinsichtlich Bewegungsumfang, Drehmomenten und muskulärer Kontrolle Funktionelle Betrachtung der Gelenke in den einzelnen Gangphasen Untersuchung der Bewegungen von Kopf, Armen und Rumpf während des Gehens. Auf dieser Grundlage wird anschließend der pathologische Gang untersucht: knapp 50 häufige Gangstörungen - von den Zehen bis zum Rumpf sind mit Störungsbild, Ursachen und Auswirkungen genau beschrieben. Den Transfer in die Praxis leistet Dr. Perry anhand ausgewählter klinischer Beispiele, die sie methodisch analysiert und interpretiert: Anschauungsunterricht auf hohem, professionellem Niveau. Der Abschnitt zur instrumentengestützten Ganganalyse vervollständigt das Buch: Wer den Gang nicht nur beobachten, sondern weitergehende Parameter heranziehen will, findet hier ausführliche Informationen zur Erstellung und Interpretation von Messdaten. Das für die Ganganalyse maßgebliche Originalwerk von Dr. Perry mit detaillierten Beschreibungen und unverwechselbaren Abbildungen - für alle die nicht "auf der Stelle treten" wollen! Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen
1.1 Der Gangzyklus 1.1.1 Reziproker Bodenkontakt 1.1.2 Gliederung des Gangzyklus 1.1.3 Schritt und Doppelschritt 1.2 Die Gangphasen 1.2.1 Übernahme Körperlast 1. Unterphase: Initialer Bodenkontakt 2. Unterphase: Belastungsantwort 1.2.2. Monopedales Stehen 3. Unterphase: Mittlere Standphase 4. Unterphase: Terminale Standphase 1.2.3 Vorschwingen des Beines 5. Unterphase: Vor-Schwungsphase 6. Unterphase: Initiale Schwungphase 7. Unterphase: Mittlere Schwungphase 8. Unterphase: Terminale Schwungphase 1.3 Basisfunktionen 1.3.1 Gliederung des Körpers Die „Passagier“-Einheit Die Antriebseinheit 1.3.2 Lokomotion Stabilität Fortbewegung Stoßdämpfung Energieerhaltung 2 Der physiologische Gang 2.1 Oberes Sprunggelenk und Fuß 2.1.1 Das obere Sprunggelenk Bewegungen Bewegungsumfang Körpervektor Muskuläre Kontrolle Dorsalextensoren Plantarflexoren 2.1.2 Funktionelle Betrachtung des oberen Sprunggelenks Funktionen des oberen Sprunggelenks in den Gangphasen Zusammenfassung 2.1.3 Der Fuß Bewegung Muskuläre Kontrolle 2.1.4 Funktionelle Betrachtung des Fußes 2.1.5 Bodenkontakt Stützflächen am Fuß 2.1.6 Druckbelastung des Fußes Zusammenfassung 2.1.7 Das Kniegelenk 2.2.1 Bewegungen Bewegungen in der Sagittalebene Rotation in der Transversalebene Bewegungen in der Frontalebene 2.2.2 Vektoren 2.2.3 Muskuläre Kontrolle Extension des Kniegelenks Flexion des Kniegelenks 2.2.4 Funktionelle Betrachtung des Kniegelenks Funktion des Kniegelenks in den Gangphasen Zusammenfassung 2.3 Das Hüftgelenk 2.3.1 Bewegungsumfang Bewegungen in der Sagittalebene Bewegungen in der Frontalebene Bewegung in der Transversalebene 2.3.2 Schwerkraftvektor Das Drehmoment in der Sagittalebene Das Drehmoment in der Frontalebene 2.3.3 Muskuläre Kontrolle Extensoren des Hüftgelenks Abduktoren des Hüftgelenks Flexoren des Hüftgelenks Adduktoren des Hüftgelenks 2.3.4 Funktionelle Betrachtung des Hüftgelenks Funktion des Hüftgelenks in den Gangphasen Zusammenfassung 2.4 Kopf, Rumpf und Becken 2.4.1 Gangdynamik Bewegungen Becken 2.4.2 Vektoren Sagittalebene Frontalebene 2.4.3 Muskuläre Kontrolle Becken Rumpf 2.4.4 Funktionelle Betrachtung Zusammenfassung 2.5 Der Arm 2.5.1 Gangmechanik Bewegungen 2.5.2 Muskuläre Kontrolle 2.5.3 Funktionelle Betrachtung 2.6 Das Bein als funktionelle Einheit 2.6.1 Funktionen nach Gangphasen 2.6.2 Muskuläre Kontrolle in den Standphasen 2.6.3 Muskuläre Kontrolle in der Schwungphase 2.6.4 Kontrollfunktion der intrinsischen (tiefen) Fußmuskeln 3 Der pathologische Gang 3.1 Pathologische Faktoren 3.1.1 Fehlbildungen 3.1.2 Muskelschwäche 3.1.3 Verlust sensorischer Funktionen 3.1.4 Schmerz 3.1.5 Störungen der motorischen Kontrolle (Spastizität) 3.2 Oberes Sprunggelenk und Fuß als Ursache von Gangstörungen 3.2.1 Oberes Sprunggelenk Terminologie Übermäßige Plantarflexion des oberen Sprunggelenks Auswirkungen übermäßiger Plantarflexion des oberen Sprunggelenks in den Gangsphasen Ursachen für übermäßige Plantarflexion Übermäßige Dorsalextension des oberen Sprunggelenks Ursachen einer übermäßigen Dorsalextension des oberen Sprunggelenks 3.2.2 Funktionsstörungen des Fußes Abweichungen in der Sagittalebene (Progressionsstörungen) Ursachen für anormalen Bodenkontakt in der Sagittalebene Abweichungen in der Frontalebene Ursachen von Abweichungen in der Frontalebene Ursachen für übermäßige Varusstellung 3.3 Anomalien am Kniegelenk als Ursache von Gangstörungen 3.3.1 Abweichungen in der Sagittalebene Unzureichende Flexion Übermäßige Extension 3.3.2 Ursachen unzureichender Flexion und übermäßiger Extension des Kniegelenks Schwäche des M. quadriceps fem. Schmerz Spastizität des M. quadriceps fem. Übermäßige Plantarflexion des oberen Sprunggelenks Schwäche der Hüftgelenksflexoren Extensionskontraktur des Kniegelenks Übermäßige Flexion des Kniegelenks Unzureichende Extension 3.3.3 Ursachen übermäßiger Flexion und unzureichender Extension Unangemessene Aktivität der ischiokruralen Muskeln Flexionskontraktur des Kniegelenks Schwäche des M. soleus Übermäßige Plantarflexion des oberen Sprunggelenks „Schlottern“ (Wobble) 3.3.4 Gangstörungen in der Frontalebene Ursachen für Gangstörungen in der Frontalebene 3.4 Das Hüftgelenk als Ursache von Gangstörungen 3.4.1 Unzureichende Extension Mittlere Standphase Terminale Standphase 3.4.2 Übermäßige Flexion Vor-Schwung- und initiale Schwungphase Mittlere Schwungphase 3.4.3 Ursachen unzureichender Extension und übermäßiger Flexion des Hüftgelenks Flexionskontraktur am Hüftgelenk Kontraktur des Tractus iliotibialis Spastizität der Hüftgelenksflexoren Schmerz Arthrodese Willkürliche Flexion Pendelbewegung 3.4.4 Unzureichende Flexion des Hüftgelenks Initiale Schwungphase Mittlere Schwungphase Terminale Schwungphase, Initialer Bodenkontakt und Belastungsantwort 3.4.5 Ursachen für unzureichende Flexion des Hüftgelenks Insuffizienz der Hüftgelenksflexoren Arthrodese des Hüftgelenks Kompensatorische Abläufe 3.4.6 Übermäßige Bewegungen in der Frontalebene Übermäßige Adduktion 3.4.7 Ursachen für übermäßige Adduktion Ipsilaterale pathologische Phänomene Kontralaterale pathologische Phänomene Übermäßige Abduktion 3.4.8 Ursachen für übermäßige Abduktion Ipsilaterale pathologische Phänomene Kontralaterale pathologische Phänomene Skoliose mit Beckenschiefstand 3.4.9 Übermäßige Rotation in der Transversalebene 3.4.10 Ursachen für übermäßige Rotation Außenrotation Innenrotation 3.5 Becken und Rumpf als Ursachen von Gangstörungen 3.5.1 Becken Sagittalebene Ursachen der ventralen Beckenkippung Frontalebene Ursachen für das Absinken der kontralateralen Beckenhälfte Transversalebene 3.5.2 Rumpf Rückneigung Ursachen der Rückneigung Vorneigen des Rumpfes Gangphasenspezifische Vorneigung des Rumpfes Seitneigung Ursachen für eine Seitneigung des Rumpfes Ursachen für ipsilaterale Rumpfneigung Übermäßige Rotation des Rumpfes Dynamische Ursachen für übermäßige Rotation des Rumpfes 3.6 Klinische Beispiele 3.6.1 Kontrakturen Posttraumatische Plantarflexionskontrakur des oberen Sprunggelenks (posttraumatischer Pes equinus) Knieflexionskontraktur (Gonarthrose) Hüftbeugekontraktur (durch Verbrennungsverletzung) 3.6.2 Muskelschwäche Quadricepsschwäche (Poliomyelitis) Schwäche der Hüftgelenks- und Kniegelenksextensoren (Muskeldystrophie) Schwäche des M. soleus und der Hüftgelenksextensoren (Myelodysplasie) Schwäche M. soleus (rheumatoide Arthritis) Schwäche des M. tibialis anterior (Rückenmarksverletzungen auf Höhe der Cauda equina) Schwäche der Hüftgelenksabduktoren Unterschenkelamputation Muskelschwäche: Zusammenfassung 3.6.3 Verlust der motorischen Kontrolle Hemiparese beim Erwachsenen Der Spitzfuß Dynamische Varusdeformität (in der Schwungphase) Spitzfußdeformität in Kombination mit einer Extensionskontraktur des Kniegelenks „Stiff knee gait“ (infolge Rückenmarksverletzung mit Querschnittslähmung) Infantile Zerebralparese 4 Systeme der Ganganalyse 4.1 Objektive und subjektive Ganganalyse Instrumentelle (objektive) Ganganalyse Beobachtende (subjektive) Ganganalyse 4.2 Bewegungsanalyse 4.2.1 Goniometer Eindimensionaler Goniometer Mehrdimensionaler Goniometer Entwicklung 4.2.2 Laufstrecke Streckenlänge und Beschaffenheit Entwicklung 4.2.3 Kamerasysteme Videodokumentation Computergestützte Bewegungsanalyse 4.2.4 Markersysteme Orientierungspunkte in der sagittalen Ebene Markierungspunkte der Frontalebene Rotationsmarker Dreidimensionale Markersysteme 4.2.5 Referenzskalen der Bewegungsanalyse 4.2.6 Interpretation der Daten 4.2.7 Zusammenfassung 4.3 Dynamische Elektromyographie 4.3.1 Ursprung der elektromyographischen Signale 4.3.2 Die motorische Einheit 4.3.3 Muskelfaseraktivierung 4.3.4 Elektromyographische Signalerfassung 4.3.5 Zeitlicher Verlauf („timing“) 4.3.6 EMG-Quantifizierung 4.3.7 Normalisierung 4.3.8 Interpretation des EMG Zeitlicher Ablauf Relative Muskelanstrengung Muskelkraft Zusammenfassung 4.3.9 EMG-Analyse des pathologisch veränderten Gangbildes Abnormaler zeitlicher Verlauf Abnormale Intensität Kontrolle der motorischen Funktion 4.3.10 EMG-Technik Elektroden Vorzüge der Elektrodentypen Signalverstärkung, -filtration und –speicherung 4.4 Bodenreaktionskräfte und Vektoranalyse 4.4.1 Bodenreaktionskräfte Die vertikale Belastung Horizontale Scherkräfte Vektoren Drehmomente Belastungszentren Intrinsische Fußbelastung Schlussfolgerung 4.5 Schrittanalyse 4.5.1 Normale Variabilität Alter Willkürliche Variabilität 4.5.2 Messsysteme Stoppuhr Druckmesssysteme am Fuß Individuelle Druckmesssysteme In eine Sohle eingearbeitete Druckmesssysteme Instrumentengestützte Laufbänder Testverfahren 4.6 Energieverbrauch 4.6.1 Einführung Arbeit, Energie und Leistung Kalorimetrie Energieeinheiten 4.6.2 Energiestoffwechsel Aerobe Oxidation Anaerobe Oxidation Aerober und anaerober Stoffwechsel Respiratorischer Quotient und respiratorische Gasaustauschrate 4.6.3 Maximale aerobe Kapazität Training mit Armen oder Beinen Konditionsverlust Training Ausdauer Sauerstoffpuls 4.6.4 Messung der Stoffwechselenergie Stabiler Zustand Spirometrie Testverfahren: Laufband oder Teststrecke Methoden aus dem Labor für Pathokinesiologie 4.6.5 Der Stoffwechsel in Ruhe und im Stand 4.6.6 Der physiologische Gang Schwankungsbreite der bevorzugten Ganggeschwindigkeiten Energieverbrauch bei bevorzugter Ganggeschwindigkeit Energieverbrauch bei hoher Ganggeschwindigkeit Unterschiede zwischen Männern und Frauen Das Verhältnis von Energie zu Geschwindigkeit Das Verhältnis zwischen Sauerstoffkosten und Geschwindigkeit Bodenbeschaffenheit und Schuhwerk Traglasten Gehen auf geneigtem Untergrund Reichweite und Dauer 4.6.7 Der pathologische Gang Gelenkversteifung Versteifung des oberen Sprunggelenks Versteifung des Hüftgelenks Versteifung des Kniegelenks 4.6.8 Das Gehen mit Stützen und Durchschwungtechnik Fraktur Paraplegie 4.6.9 Rückenmarksläsion, reziproker Gang Der gangspezifische motorische Index Gangspezifischer motorischer Index und Gangleistung Gangspezifischer motorischer Index und Energieverbrauch Gangspezifischer motorischer Index und axiale Spitzenbelastung Orthesen Gehhilfen Spinale Läsionshöhe Langzeitergebnisse 4.6.10 Myelodysplasie Durchschwung-Technik Reziproker Gang Gegenüberstellung von Durchschwung- und reziprokem Gang 4.6.11 Amputation Prothese oder Armstütze Amputationshöhe Amputation aufgrund von Gefäßschäden Stumpflänge Beidseitig Amputierte 4.6.12 Arthritis Hüftgelenk Kniegelenk Rheumatoide Arthritis Gehhilfen mit Ansatz an der oberen Extremität Konditionsverlust 4.6.13 Hemiplegie 4.6.14 Energieverbrauch beim Gehen mit gebeugten Knien 4.6.15 Spastische Diplegie 4.7 Die Ökonomie des Gangs in der hypothetischen Idealnorm 4.7.1 Normabweichungen erkennen 4.7.2 Acht Kriterien, die ökonomisches Gehen ausmachen Kriterium 1: Die Masse von Brustkorb und Kopf wird so geradlinig wie möglich nach vorn in die Fortbewegungsrichtung transportiert Kriterium 2: Gangtempo Kriterium 3: Breite der Gangspur Kriterium 4: Schrittlänge Kriterium 5: Aufrechte Haltung der Wirbelsäule Kriterium 6: Erhaltung der virtuellen Fußachse und Einordnung der funktionellen Fußlängsachse in die Fortbewegungsrichtung Kriterium 7: Gehbewegungen der Beine und des Beckens Kriterium 8: Pendelbewegung der Arme 4.7.3 Schlussbetrachtung 4.8 Nicht-apparative Ganganalyse Videoaufzeichnung Strukturierte Ganganalyse Bislang eingesetzte Beurteilungsskalen Bewertung 5 Ganganalyse als Bestandteil der täglichen Arbeit 5.1 Die Sicht des Mediziners 5.2 Die Sicht des Physiotherapeuten Stichwortverzeichnis |
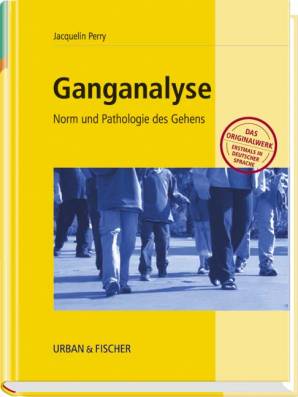
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen